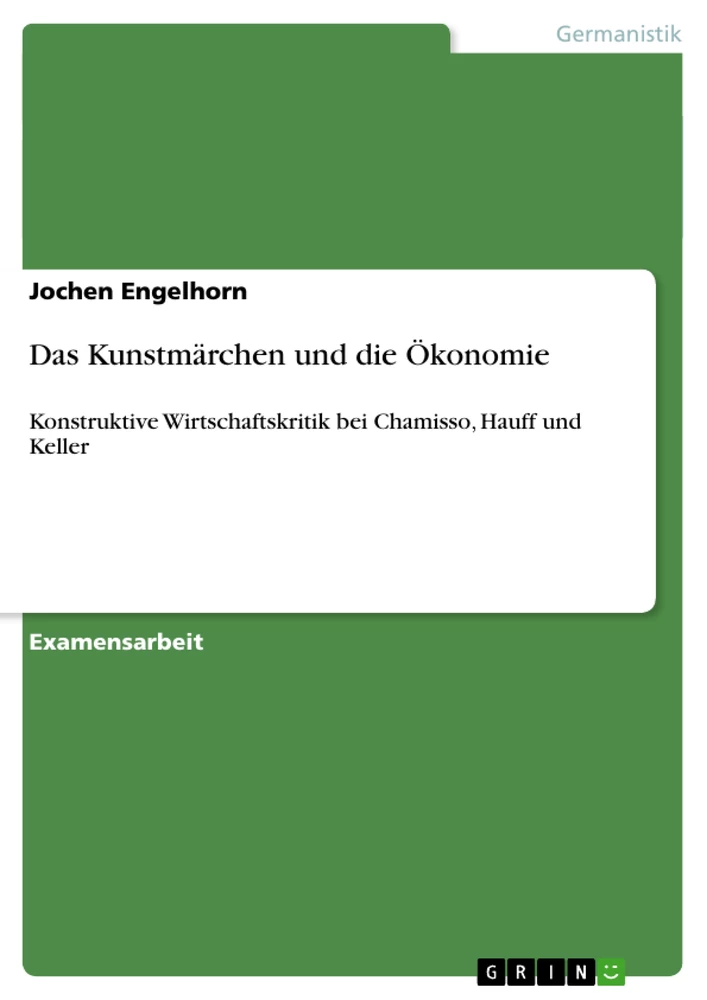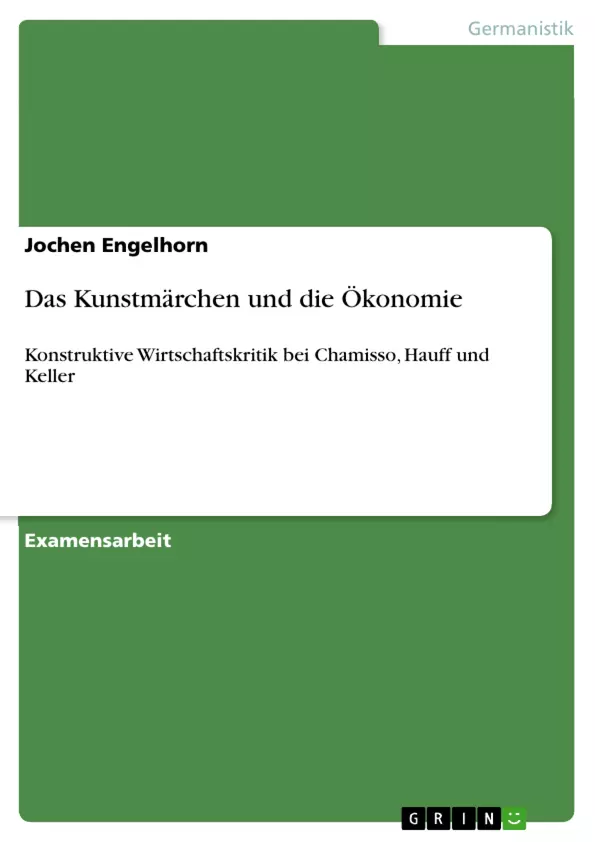Was macht der Kapitalismus aus dem Menschen? Diese Frage stellte jüngst der Autor und Journalist Adam Soboczynski, der im Hinblick auf aktuelle Diskussionen um Wirtschaft und Finanzen die Rolle der Literatur beleuchtet. Sein Urteil beruht auf einer gängigen Gegenüberstellung: der Konkurrenz von Geld und Poesie. Der Zeit-Redakteur verweist hierbei unter anderem auf Sophokles’ Antigone: „Denn kein so schmählich Übel, wie des Geldes Wert, / Erwuchs den Menschen“; und schlägt den Bogen bis zu Thomas Mann, der im Zauberberg nicht nur die „Satansherrschaft des Geldes“ thematisiert. In einer Art literaturhistorischen Abriss werden Literaten zu Kritikern von Wirtschaft und Geld, gleichzeitig zu Bewahrern von Moral und Tradition. Doch hält diese Bewertung einer näheren Überprüfung stand? Steht die Literatur der Wirtschaft und ihren Ideen grundsätzlich ablehnend gegenüber? Und macht sie den Menschen dabei wirklich schlechter als er ist?
Der scheinbare Gegensatz dieser beiden Welten, der Welt der Poesie und der Welt des Geldes, wird auch bereits im Titel dieser Untersuchung angedeutet: Das Kunstmärchen, geradezu der Inbegriff des Spiels um Fiktion und Realität, wird mit einem Fachgebiet ver-knüpft, dessen lebensweltliche Bedeutung kaum größer sein könnte: der Wirtschaft. Doch lässt sich diese stereotypische Gegenüberstellung aufrechterhalten? Besteht hier wirklich eine Art Konkurrenzverhältnis von Poesie und Geldwirtschaft? Die strittige Beziehung zwischen literarischen und ökonomischen Konzepten dürfte sich wohl gerade in einer Gattung fokussieren, die sich allgemeinhin durch wunderbare, märchenhafte Elemente wie Zauber-kräfte, übernatürliche Fähigkeiten und fantastische Gegenstände auszeichnet. Was hat also eine Welt, in der Naturgesetze und die Regeln der menschlichen Existenz auf den Kopf ge-stellt werden, in der das Wunderbare alltäglich erscheint und Rationales mit Irrationalem ver-mischt wird, mit der Welt der Finanzen und Bilanzen zu schaffen? Was haben sprechende Katzen, Glückssäckel und Waldgeister mit Kapitalakkumulation, Profitstreben und Waren-werten zu tun? Debatten um das Verhältnis von Mensch und Ökonomie, von Geschäft und Moral sind keineswegs nur ein Phänomen unserer heutigen Zeit; vor allem in Zeiten von Krise und Wandel wirtschaftlicher Systeme wird durch Schreiben gesellschaftliche ‚Wirklichkeit‘ verarbeitet. Warum also nicht auch im Märchen?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Gesellschaft, Literatur und ihr Verhältnis zur Ökonomie
- 1. Das 19. Jahrhundert aus sozio-ökonomischer Perspektive.
- 2. Der Teufelspakt, Faust und die Entstehung des ökonomischen Menschen.
- III. Das Kunstmärchen und die Ökonomie.
- 1. Vorstellung der Werke
- 2. Der (subjektive) Mangel und die Macht des Eigeninteresses
- Synthese: Eigennutz und die 'unsichtbare Hand' bei Adam Smith
- 3. Der Pakt mit dem 'Teufel'.
- a) Der Graue, Holländer-Michel und der Hexenmeister – Variationen eines teuflischen Verführers.
- b) Schatten, Herz und das eigene Leben gegen Geld und Gut – die Handelsgüter und ihr 'Wert'.
- Synthese: Tauschwert und Gebrauchswert
- c) Der Tausch als 'Sündenfall' ökonomischen Denkens.
- 4. Die Konsequenzen des Paktes
- 5. Alternativen zur ökonomischen Abhängigkeit
- Synthese: Strategien zur Zähmung des Geldes.
- IV. Schlussbetrachtung
- V. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht das Verhältnis von Kunstmärchen und Ökonomie im 19. Jahrhundert am Beispiel von Werken wie "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" von Adelbert von Chamisso, "Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff und "Spiegel, das Kätzchen" von Gottfried Keller. Ziel ist es, die literarische Verarbeitung von ökonomischen Realitäten und Gedanken in diesen Texten zu analysieren und die spezifische Funktion des Kunstmärchens als Teil eines Diskurses um die Ökonomie aufzuzeigen.
- Die Bedeutung des Tauschhandels und des Paktes mit dem Teufel in der Konstruktion von ökonomischer Kritik.
- Die literarische Auseinandersetzung mit dem Eigeninteresse und der 'unsichtbaren Hand' im Kontext des industriellen Wandels.
- Die Darstellung von Tauschwert und Gebrauchswert sowie die Konsequenzen des ökonomischen Denkens im Kunstmärchen.
- Die Suche nach Alternativen zur ökonomischen Abhängigkeit und Strategien zur Zähmung des Geldes.
- Die Funktion des Kunstmärchens als 'Spiegel der Zeit' und seine Bedeutung im gesellschaftlichen Diskurs.
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Arbeit stellt die Fragestellung vor und zeigt die Relevanz des Themas im Kontext aktueller Diskussionen um Wirtschaft und Moral. Sie beleuchtet den scheinbaren Gegensatz zwischen Literatur und Ökonomie und hebt die Relevanz des Kunstmärchens als Gegenstand der Analyse hervor.
- II. Gesellschaft, Literatur und ihr Verhältnis zur Ökonomie: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen und sozio-ökonomischen Kontext des 19. Jahrhunderts. Es untersucht die Entstehung des ökonomischen Menschen und analysiert die literarische Auseinandersetzung mit Themen wie dem Teufelspakt, Faust und der Macht des Geldes.
- III. Das Kunstmärchen und die Ökonomie: Dieses Kapitel präsentiert die drei ausgewählten Kunstmärchen und analysiert den zentralen Tauschakt. Es untersucht das Motiv des Paktes mit dem Teufel, die Gründe für den Handel und die Konsequenzen des Tauschs. Zudem werden Alternativen zur ökonomischen Abhängigkeit und Strategien zur Zähmung des Geldes diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Kunstmärchen, Ökonomie, Kapitalismus, Tauschhandel, Pakt mit dem Teufel, Eigennutz, 'unsichtbare Hand', Tauschwert, Gebrauchswert, Industrieller Wandel, gesellschaftlicher Diskurs, Moral, Literatur und Wirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Welches Verhältnis besteht zwischen Kunstmärchen und Ökonomie?
Die Arbeit untersucht, wie das Kunstmärchen im 19. Jahrhundert ökonomische Realitäten wie Kapitalakkumulation und Profitstreben literarisch verarbeitet und kritisch spiegelt.
Was symbolisiert der „Pakt mit dem Teufel“ in ökonomischer Hinsicht?
Der Teufelspakt dient als Metapher für den Sündenfall des ökonomischen Denkens, bei dem menschliche Werte (wie der Schatten oder das Herz) gegen Geld und Gut eingetauscht werden.
Welche Werke werden in der Analyse behandelt?
Analysiert werden Adelbert von Chamissos „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“, Wilhelm Hauffs „Das kalte Herz“ und Gottfried Kellers „Spiegel, das Kätzchen“.
Wie wird Adam Smiths „unsichtbare Hand“ im Märchen thematisiert?
Die Arbeit setzt literarische Motive des Eigennutzes in Bezug zu Smiths Theorie der „unsichtbaren Hand“, um die Auswirkungen des ökonomischen Menschenbildes auf das Individuum zu beleuchten.
Gibt es in den Märchen Alternativen zur ökonomischen Abhängigkeit?
Ja, die Untersuchung zeigt Strategien zur „Zähmung des Geldes“ auf und analysiert, wie die Protagonisten versuchen, ihre moralische Integrität gegenüber dem materiellen Wert zurückzugewinnen.
- Citar trabajo
- Jochen Engelhorn (Autor), 2010, Das Kunstmärchen und die Ökonomie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165366