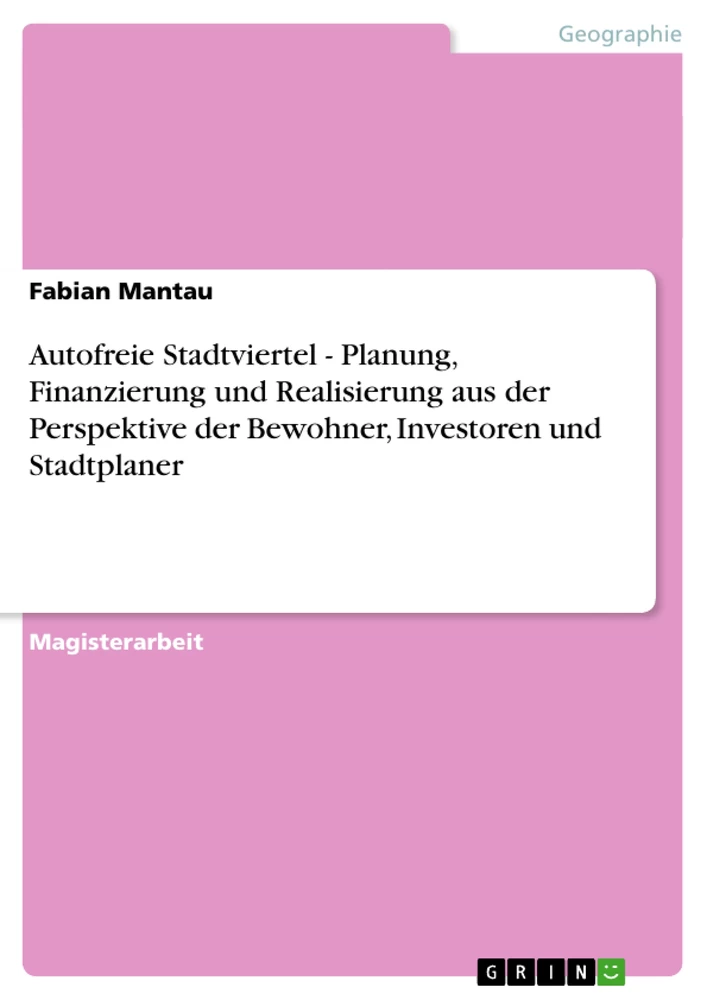Vielen Menschen in Deutschland steht täglich ein Auto zur Verfügung. Ohne Auto lässt sich der alltägliche Tagesablauf, die Fahrt zur Arbeit, zum Discounter oder zu Freunden nicht bewältigen. Ohne Auto lässt sich ein Haushalt mit Kindern nicht führen: Das ist ein verbreitetes Denkmuster.
In den Großstädten verfügen jedoch bis zu vierzig und mehr Prozent der Haushalte über keinen Pkw. Trotzdem ertragen auch (und vor allem) diese Haushalte täglich die Nachteile des Autoverkehrs: Erhöhte Lärmbelästigung, Luftverschmutzung und begrenzende Parkreihen vor der Haustüre, anstatt die Vorteile autofreien Wohnens wie eine ruhige, kinderfreundliche und sichere Umgebung zu genießen. Der Pkw als bequemes Verkehrsmittel hat seine Vorteile auf der Nutzerseite, die Nachteile trägt hauptsächlich die Allgemeinheit.
Wichtig soll in dieser Arbeit die Herausstellung von Kostentransparenz unter ökonomischen Gesichtspunkten auf verschiedenen Ebenen sein. Dazu zählen Kosten, die durch Unfälle im Straßenverkehr für die Allgemeinheit entstehen, die Stellplatzkosten für den Einzelnen oder der Flächenverbrauch auf Mikro- und Makroebene.
Während der Hinleitung zum Hauptteil soll mittels beispielhafter Alltagsbeschreibungen auf die Wahrnehmung des bisherigen Mobilitätsverständnisses aufmerksam gemacht werden. Auch wird auf psychologische Aspekte der Verkehrsmittelwahl eingegangen werden. Somit geht es in dieser Arbeit nicht nur um die Darlegung verschiedener Aspekte autofreien Wohnens, sondern als dessen Konsequenz muss es auch um das (veränderte) Verkehrsverhalten seiner Bewohner gehen.
Als Untersuchungsgegenstand wurden konkret zwei bereits bewohnte autofreie Siedlungen in Nordrhein-Westfalen ausgewählt. Die Weißenburgsiedlung in Münster beherbergt seine Bewohner bereits seit 2001. Ins so genannte Stellwerk 60 in Köln sind 2007 die ersten Bewohner eingezogen. Mittels einer in jedem Quartier durchgeführten Umfrage soll festgestellt werden, wie sich der Lebensstil und die Mobilität der dort wohnenden Menschen untereinander und von „Nicht-Autofreien“ unterscheiden. Es wird ein vom Autor entwickeltes, auf autofreie Quartiere zugeschnittenes Standortfaktoranalysemodell vorgestellt, um Investoren ein Instrument für die weitere Konzeption autofreier Siedlungen in die Hand zu geben. Schließlich folgt eine zusammenfassende Analyse und ein Ausblick, der die Zukunftsfähigkeit autofreier Stadtviertel auf Basis der in der Arbeit herausgearbeiteten Schlussfolgerungen beschreiben soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stadtplanung im Zeichen des Autoverkehrs
- 2.1 Kurzer Abriss der Stadtverkehrsentwicklung
- 2.2 (Externe) Kosten des Autoverkehrs
- 2.2.1 Verkehrsunfälle
- 2.2.2 Verkehrslärm
- 2.2.3 Autoschadstoffe
- 2.2.4 Energieverbrauch
- 2.2.5 Pkw-Entsorgung
- 2.2.6 Bilanzierung der (externen) Kosten
- 2.3 Stadtgestaltung in den Industrieländern
- 2.4 Gründe der Autofixierung
- 2.5 Politische und gesellschaftliche Barrieren
- 2.6 Neue Planungskulturen
- 3. Verkehrsmittel und Verkehrsverhalten im Stadtverkehr
- 3.1 Das Fahrrad im Stadtverkehr
- 3.2 ÖP(N)V
- 3.3 Fußgänger als Qualitätsmerkmal einer Stadt
- 3.4 Mobilitäts(miss)erfolge autogerechter Siedlungsstrukturen
- 3.5 Gesamtverkehrsmittelaufkommen der einzelnen Verkehrsträger
- 3.6 Verkehrsverhalten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen
- 3.7 Berufs-, Wirtschafts-, Einkaufs-, Ausbildungs- und Freizeitverkehr
- 4. Erfordernisse autofreier Lebensführung
- 4.1 Stellplatzkosten/Parkraumbewirtschaftung
- 4.2 Alltag autofreier Menschen: Arbeitswege, Einkaufen, sonstige Fahrten
- 4.3 Car-Sharing
- 4.4 Bring- und Lieferdienste
- 5. Autofreie Stadtviertel: Konsequente Umsetzung autofreien Lebens
- 5.1 Standortkriterien
- 5.2 Juristische Parkraumausgestaltung auf Bewohnerebene
- 5.3 Juristische Parkraumausgestaltung auf Wohnviertelebene
- 6. Beispiele autofreier Wohnkonzepte
- 6.1 Weißenburgsiedlung Münster
- 6.1.1 Initiierung/Vereinsgründung/Besitzverhältnisse
- 6.1.2 Grundstücksgröße/-schnitt/Neubau
- 6.1.3 Bewohnerschaft/Nutzungskonflikte
- 6.1.4 Rechtslage/Bewohnerverein
- 6.1.5 Kommunalpolitische Situation/Verwaltung
- 6.1.6 Bauliche Besonderheiten/Außenwirkung der Siedlung
- 6.1.7 Verkehrsanbindung
- 6.2 Siedlung Stellwerk 60/Köln
- 6.2.1 Initiierung/Besitzverhältnisse/Grundstücksgröße/-schnitt
- 6.2.2 Rechtslage
- 6.2.3 Bauliche Besonderheiten
- 6.2.4 Nutzungskonflikte
- 6.2.5 Verkehrsanbindung
- 6.2.6 Kommunalpolitische Situation/Verwaltung
- 6.2.7 Bewohnerschaft/Nachfrage
- 6.2.8 Infrastruktur/Bewohnerverein
- 6.3 Umfrageskizzierung
- 6.3.1 Umfragedurchführung
- 6.3.2 Deskriptive Auswertung der Datenerhebung
- 6.3.3 Zufallskritische Auswertung
- 6.3.4 Teildiskussion der Ergebnisse
- 6.4 Standortfaktoranalyse der Weißenburgsiedlung/Stellwerk 60
- 6.4.1 Standortfaktorbeschreibung
- 6.4.2 Standortfaktorbewertung und Darstellung
- 6.5 Bewertung eines Stadthauses im Stellwerk 60
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Planung, Finanzierung und Realisierung autofreier Stadtviertel aus der Perspektive von Bewohnern, Investoren und Stadtplanern. Die Hauptziele sind die Darstellung der Kostentransparenz des aktuellen Verkehrssystems und die Analyse der Lebensqualität und des Mobilitätsverhaltens in autofreien Siedlungen.
- Kosten des Autoverkehrs (ökonomische und ökologische Aspekte)
- Mobilitätsverhalten in Städten und alternativen Wohnformen
- Planung und Umsetzung autofreier Stadtviertel
- Juristische und gesellschaftliche Herausforderungen autofreien Wohnens
- Standortfaktoren für erfolgreiche autofreie Projekte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des Alltags mit und ohne Auto in deutschen Städten dar, wobei die Ungerechtigkeit zwischen den Vorteilen für den Autofahrer und den Nachteilen für die Allgemeinheit hervorgehoben wird. Die Arbeit untersucht die Kosten des Verkehrssystems und beleuchtet alternative Mobilitätsmuster, insbesondere das Konzept autofreier Stadtviertel, anhand von zwei Beispielsiedlungen in Nordrhein-Westfalen.
2. Stadtplanung im Zeichen des Autoverkehrs: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über die Stadtverkehrsentwicklung, beginnend im Mittelalter bis zur Gegenwart. Es analysiert die externen Kosten des Autoverkehrs (Unfälle, Lärm, Schadstoffe, Energieverbrauch, Entsorgung), die politischen und gesellschaftlichen Barrieren für eine Verkehrswende und neue Planungskulturen, die die Bürger stärker einbeziehen.
3. Verkehrsmittel und Verkehrsverhalten im Stadtverkehr: Dieses Kapitel untersucht das Verkehrsverhalten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und vergleicht die Vor- und Nachteile verschiedener Verkehrsmittel (Fahrrad, ÖP(N)V, Fußverkehr) im Stadtverkehr. Es analysiert den Modal Split und die Mobilitätsmuster, um die Herausforderungen und Potenziale einer Verkehrswende aufzuzeigen.
4. Erfordernisse autofreier Lebensführung: Dieses Kapitel befasst sich mit den praktischen Aspekten des autofreien Lebens. Es analysiert die Stellplatzkosten und -bewirtschaftung, beschreibt den Alltag autofreier Menschen (Arbeitswege, Einkaufen etc.) und bewertet die Rolle von Car-Sharing und Bringdiensten für die erfolgreiche Umsetzung autofreien Wohnens.
5. Autofreie Stadtviertel: Konsequente Umsetzung autofreien Lebens: Dieses Kapitel präsentiert ein vom Autor entwickeltes Standortfaktoranalysemodell für autofreie Stadtviertel. Es beschreibt die juristische Gestaltung des Parkraums auf Bewohnerebene und Wohnviertelebene, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für erfolgreiche autofreie Projekte zu verdeutlichen.
6. Beispiele autofreier Wohnkonzepte: Dieses Kapitel stellt zwei autofreie Siedlungen in Münster (Weißenburgsiedlung) und Köln (Stellwerk 60) vor. Es analysiert deren Planung, Umsetzung, Bewohnerschaft und Mobilitätsverhalten anhand von Experteninterviews und Umfragedaten und bewertet die Projekte mittels des in Kapitel 5 entwickelten Standortfaktoranalysemodells.
Schlüsselwörter
Autofreie Stadtviertel, Stadtplanung, Verkehrswende, Mobilität, Lebensqualität, Kosten des Autoverkehrs, ÖP(N)V, Fahrrad, Car-Sharing, Standortfaktoren, Bewohnerbeteiligung, Rechtslage, Münster, Köln, Sinus-Milieus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Autofreie Stadtviertel
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Planung, Finanzierung und Realisierung autofreier Stadtviertel aus verschiedenen Perspektiven (Bewohner, Investoren, Stadtplaner). Sie analysiert die Kosten des aktuellen Verkehrssystems und die Lebensqualität in autofreien Siedlungen.
Welche Ziele werden verfolgt?
Hauptziele sind die Darstellung der Kostentransparenz des Verkehrssystems und die Analyse der Lebensqualität und des Mobilitätsverhaltens in autofreien Siedlungen. Es wird untersucht, wie autofreie Stadtviertel geplant und umgesetzt werden können und welche juristischen und gesellschaftlichen Herausforderungen damit verbunden sind.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kosten des Autoverkehrs (ökonomisch und ökologisch), das Mobilitätsverhalten in Städten und alternativen Wohnformen, die Planung und Umsetzung autofreier Stadtviertel, die juristischen und gesellschaftlichen Herausforderungen autofreien Wohnens und die Standortfaktoren für erfolgreiche autofreie Projekte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Stadtplanung im Zeichen des Autoverkehrs, Verkehrsmittel und Verkehrsverhalten im Stadtverkehr, Erfordernisse autofreier Lebensführung, Autofreie Stadtviertel: Konsequente Umsetzung autofreien Lebens und Beispiele autofreier Wohnkonzepte (Weißenburgsiedlung Münster & Stellwerk 60 Köln). Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas.
Welche Kosten des Autoverkehrs werden betrachtet?
Die externen Kosten des Autoverkehrs werden umfassend analysiert: Verkehrsunfälle, Verkehrslärm, Autoschadstoffe, Energieverbrauch und Pkw-Entsorgung. Die Arbeit beleuchtet auch die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen.
Wie wird das Mobilitätsverhalten untersucht?
Das Mobilitätsverhalten wird anhand verschiedener Verkehrsmittel (Fahrrad, ÖPNV, Fußverkehr) und unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen untersucht. Der Modal Split und die Mobilitätsmuster in autogerechten und autofreien Siedlungen werden verglichen.
Welche Aspekte der Planung und Umsetzung autofreier Stadtviertel werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Standortkriterien für autofreie Stadtviertel, die juristische Gestaltung des Parkraums (auf Bewohnerebene und Wohnviertelebene) und die Rolle von Bewohnerbeteiligung bei der Planung und Umsetzung.
Welche rechtlichen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet die juristischen Rahmenbedingungen für autofreie Projekte und die rechtliche Gestaltung des Parkraums in autofreien Siedlungen.
Welche Fallstudien werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert zwei Fallstudien: die Weißenburgsiedlung in Münster und die Siedlung Stellwerk 60 in Köln. Diese werden anhand von Experteninterviews und Umfragedaten analysiert.
Wie werden die Fallstudien bewertet?
Die Fallstudien werden mit Hilfe eines vom Autor entwickelten Standortfaktoranalysemodells bewertet. Dieses Modell berücksichtigt verschiedene Faktoren, die den Erfolg autofreier Projekte beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Autofreie Stadtviertel, Stadtplanung, Verkehrswende, Mobilität, Lebensqualität, Kosten des Autoverkehrs, ÖPNV, Fahrrad, Car-Sharing, Standortfaktoren, Bewohnerbeteiligung, Rechtslage, Münster, Köln, Sinus-Milieus.
- Citation du texte
- Fabian Mantau (Auteur), 2010, Autofreie Stadtviertel - Planung, Finanzierung und Realisierung aus der Perspektive der Bewohner, Investoren und Stadtplaner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165491