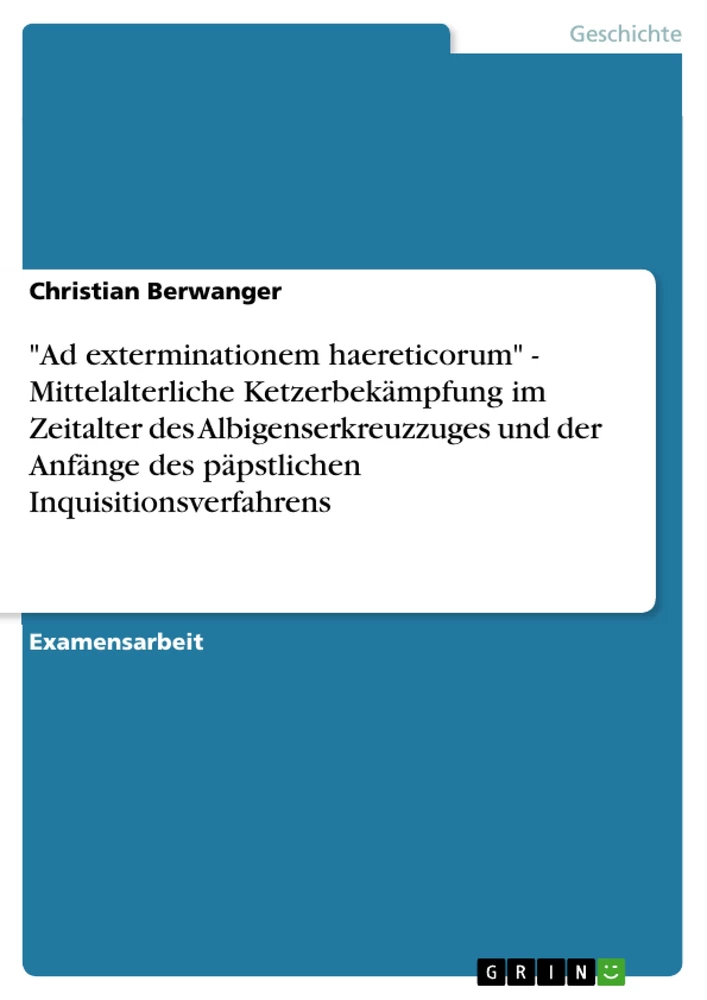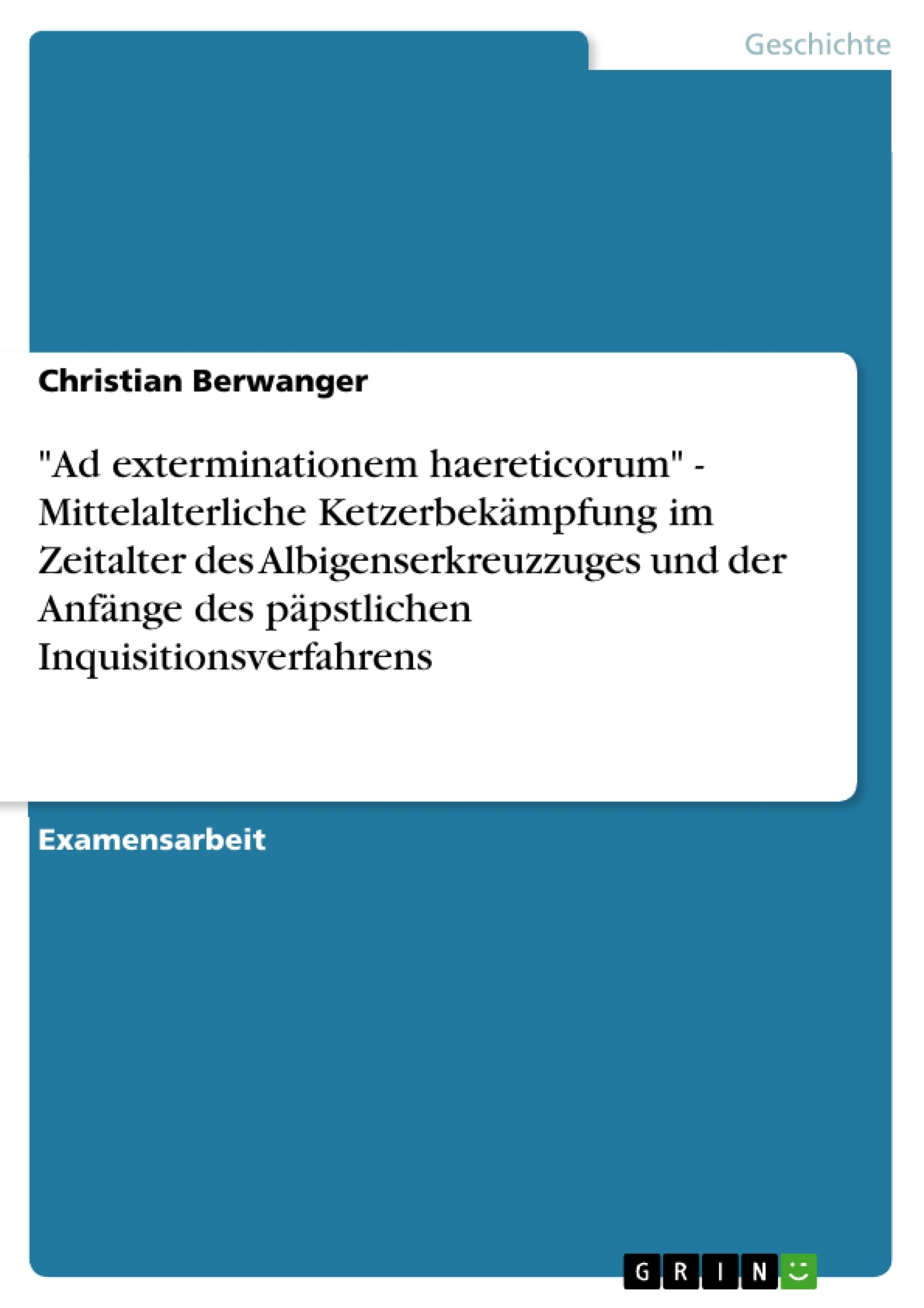Im 13. Jahrhundert sah sich die Kirche mit den neuen religiösen Bewegungen der Katharer und Waldenser einer ernsthaften Gefahr ausgesetzt, da diese Strömungen den kirchlichen Ordo in seinem Grundwesen in Frage stellten. Da das 11. Jahrhundert wenig von häretischen Bewegungen geprägt war, konnte man auf das Auftauchen als häretisch erscheinender Laienbewegungen nicht reagieren, was auch dazu führte, dass spätantike Bezeichnungen auf die neuen Ketzereien projiziert wurden, ohne dass man sich mit den Inhalten und den Lehren des neuen Phänomens näher beschäftigte. Somit fehlte ebenfalls ein grundlegendes Dogma der katholischen Kirche hinsichtlich eines orthodoxen Glaubens. Zwar wurden durch das Decretum Gratiani und die beiden Laterankonzilien von 1139 und 1179 grundsätzliche Kriterien zur Bestimmung der Heterodoxie festgelegt, doch gab es keine einheitlichen Kriterien für die Abgrenzung der Häresie von der Orthodoxie. Erst mit der Promulgation der päpstlichen Dekretale Ad abolendam 1184 wurden erste häretische Namen schriftlich fixiert, doch wurden durch den weiterhin im Unklaren gelassenen Begriff der Häresie Bewegungen, die sich deutlich von der der Katharer abgrenzten, in die Ketzerei getrieben und fortan unter die Häretiker gezählt. Durch die Bestimmung, den weltlichen Arm zur Eindämmung der Ketzergefahr hinzuziehen, wurde der Grundstein für die 50 Jahre später einsetzende Institutionalisierung der Inquisition gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Innovation: Der Aufstieg der Katharer
- Entstehung und Verbreitung
- Organisation
- Der katharische Glaube
- Tradition: Kirchenrecht und Ketzerei
- Das Decretum Gratian
- Die Laterankonzilien von 1139 und 1179
- Ad abolendam
- Vergentis in senium
- Das 4. Laterankonzil 1215
- Eskalation: Der Albigenserkreuzzug und das Konzil von Toulouse 1229
- Ein Kreuzzug ad exterminationem haereticorum?
- Der Friede von Paris 1229
- Das Languedoc unter Beobachtung: Das Konzil von Toulouse 1229
- Extermination: Die Anfänge der päpstlichen Inquisition
- Das Verfahren per inquisitionem
- Die Bulle ille humani generis
- Die Anfänge der Ketzerinquisition in Frankreich
- Die große Inquisition von 1245/46
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Ketzerbekämpfung im 12. und 13. Jahrhundert. Sie analysiert die Maßnahmen der katholischen Kirche gegen die Katharer und Waldenser, mit besonderem Fokus auf die Entstehung und Entwicklung des Häresiebegriffs und die Institutionalisierung der Inquisition.
- Der Aufstieg der Katharer als große häretische Bewegung in Südfrankreich und deren Ausbreitung in Europa
- Die Entwicklung des Kirchenrechts im Umgang mit Ketzerei, von den ersten Kanones bis zum 4. Laterankonzil
- Die Rolle des Albigenserkreuzzugs und des Konzils von Toulouse 1229 in der Bekämpfung der Katharer
- Die Entstehung und Entwicklung der päpstlichen Inquisition in Südfrankreich
- Die Bedeutung des Verfahrens per inquisitionem und die Rolle der Folter in der Ketzerinquisition
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die große häretische Bewegung der Katharer im 12. und 13. Jahrhundert vor und beleuchtet deren Entstehung, Verbreitung, Organisation und Glaubensvorstellungen. Sie zeigt auf, welche Herausforderungen die Katharer für die Amtskirche darstellten.
Das zweite Kapitel analysiert das kirchenrechtliche Vorgehen gegen Ketzerei, beginnend mit dem Decretum Gratiani und endend mit den Kanones des 4. Laterankonzils. Es beleuchtet die Entwicklung des Häresiebegriffs und die zunehmend verschärften Sanktionen gegen Ketzer und ihre Unterstützer.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Albigenserkreuzzug und dem Konzil von Toulouse 1229. Es beleuchtet den Verlauf des Kreuzzugs, die Rolle des Konzils in der Ketzerbekämpfung und die Frage, ob die Amtskirche durch den Kreuzzug und das Konzil neue Wege zur Vernichtung der Katharer beschritt.
Das vierte Kapitel behandelt die Anfänge der päpstlichen Inquisition in Südfrankreich. Es beleuchtet die Entwicklung des Verfahrens per inquisitionem, die ersten Inquisitionshandbücher und die großräumige Inquisition in der Grafschaft Toulouse nach dem Fall von Montsegur.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den Themen Ketzerbekämpfung, Häresie, Katharer, Albigenserkreuzzug, Kirchenrecht, Konzil von Toulouse, Inquisition, Verfahren per inquisitionem, Folter.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Katharer und warum bekämpfte die Kirche sie?
Die Katharer waren eine religiöse Bewegung im 12./13. Jahrhundert, die den kirchlichen Ordo und grundlegende Dogmen in Frage stellten, was von der Amtskirche als existenzielle Bedrohung wahrgenommen wurde.
Was war die Bedeutung der päpstlichen Dekretale „Ad abolendam“ von 1184?
Sie fixierte erstmals Namen häretischer Gruppen schriftlich und legte den Grundstein für die Zusammenarbeit mit dem weltlichen Arm zur Ketzerbekämpfung.
Was war das Ziel des Albigenserkreuzzuges?
Das Ziel war die physische Vernichtung der häretischen Bewegung („ad exterminationem haereticorum“) in Südfrankreich und die Wiederherstellung der kirchlichen Autorität.
Wie funktionierte das Verfahren „per inquisitionem“?
Es war ein Untersuchungsverfahren, bei dem die Kirche aktiv nach Häretikern suchte, Zeugen befragte und später auch Folter einsetzte, um Geständnisse zu erzwingen.
Welche Rolle spielte das Konzil von Toulouse 1229?
Es institutionalisierte die Überwachung des Languedoc und verschärfte die Maßnahmen zur Aufspürung von Ketzern nach dem Ende der militärischen Phase des Kreuzzugs.
- Citar trabajo
- Christian Berwanger (Autor), 2010, "Ad exterminationem haereticorum" - Mittelalterliche Ketzerbekämpfung im Zeitalter des Albigenserkreuzzuges und der Anfänge des päpstlichen Inquisitionsverfahrens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165529