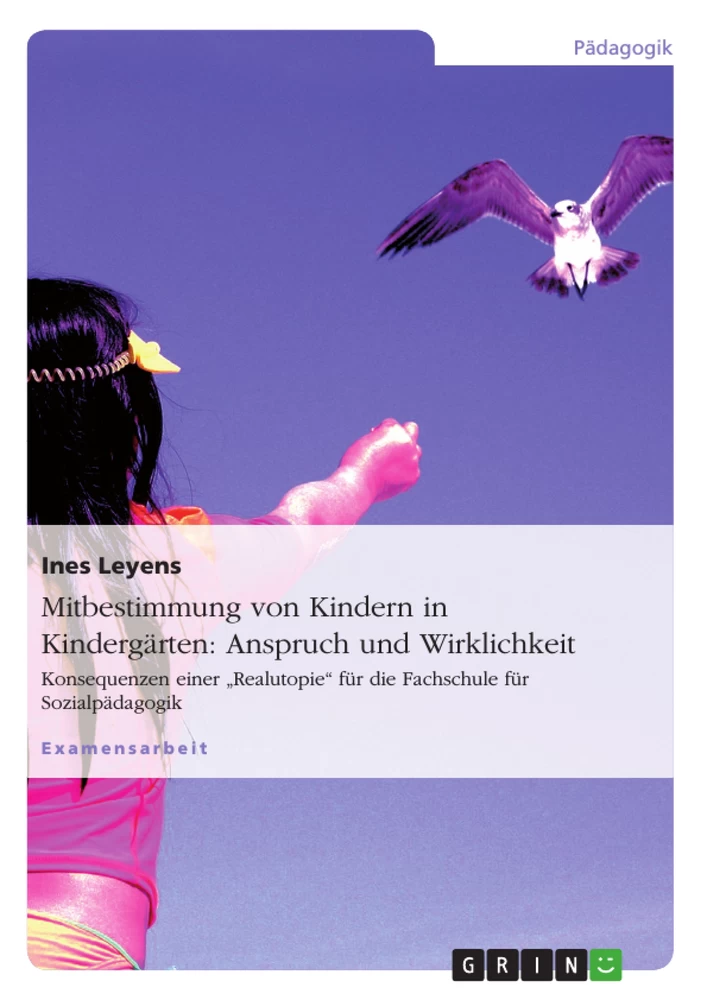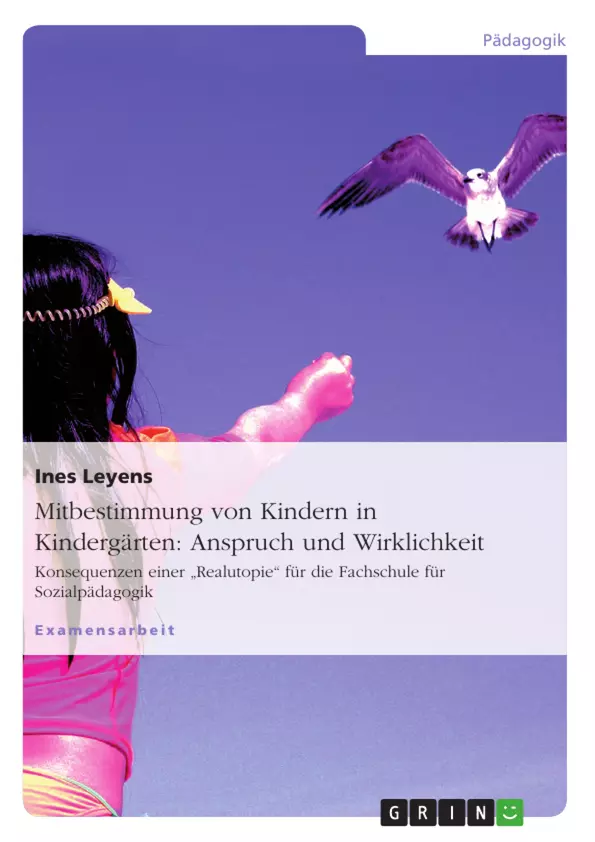Obwohl seit Jahrzehnten über die Notwendigkeiten von Reformen sowohl in der Kindergartenpädagogik wie auch parallel dazu in der ErzieherInnenausbildung diskutiert wird, erkennen Experten keine nennenswerte Weiterentwicklung. „Die Ideen über Schulen wechseln rasch ab, aber die Realität von Schule verändert und entwickelt sich nur langsam“(Fried, 2002).
Kritikpunkte finden sich in Theorie-Praxis-Vernetzungen, in verschulten Lernmethoden und bezüglich veralteter und mangelnder Wissenschaftstheorien. Durch das europaweit niedrigste Ausbildungsniveau deutscher ErzieherInnen geprägt, drehen sich vermeintliche Verbesserungen in Deutschland meist nur um organisatorische Fragen. „Die Schule scheint deshalb gut beraten, wenn sie ihr Entwicklungstempo steigert“ (ebd., S.8).
Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Ausbildungssituation von ErzieherInnen unter dem besonderen Aspekt der Partizipation von SchülerInnen in der Fachschule für Sozialpädagogik und im Gegenzug mit dem Anspruch und der Wirklichkeit von Partizipation von Kindern im Kindergarten. Mangelnde Partizipationsmöglichkeiten von Heranwachsenden werden als Ursache für die vielbeklagte politische Apathie angegeben, aber auch – und das ist vielleicht noch bedeutender – als Grund für ein wachsendes Gefühl der Minderwertigkeit von Kindern und Jugendlichen. Damit lautet die zentrale Fragestellung dieser Arbeit, welche professionellen Kompetenzen brauchen ErzieherInnen, um den Ansprüchen und Forderungen der Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern gerecht zu werden.
Im Laufe der Arbeit wurde die folgende These herausgearbeitet:
ErzieherInnen, die ein stabiles professionelles Selbst besitzen, die eigene Erfahrungen im selbstbestimmten Lernen machen durften, werden Partizipation von Kindern (in Zukunft) unterstützten.
In der von mir durchgeführten empirischen Untersuchung zeigte sich jedoch, dass in der Wirklichkeit eher Fremdbestimmung existiert, so dass sich die Frage stellt, ob ein Zusammenhang zwischen fremdbestimmter Ausbildung und fremdbestimmten Kindern besteht? Hierauf aufbauend wurde ein neuartiger Entwurf zur selbstbestimmten und mitbestimmungsgerechten Ausbildung in der Fachschule für Sozialpädagogik entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
-
- Ansprüche und Forderungen nach Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern
-
- Politische Ansprüche
- Die Rechte der Kinder durch die UN-Kinderrechtskonvention
- Nationale Rechte
- Demokratische Ansprüche und Konzepte in der Kindergartenpädagogik
- Psychologische Ansätze zur Begründung der Mitbestimmung
-
- Sozialisation und Moral
- Ökologische Systemtheorie
- Denken und Kommunikation
- Kognitive und sozial-kognitive Theorien
- Humanistische Psychologie als Grundlage für ein neues Menschenbild
- Das Selbst
- Pädagogische Perspektiven der partizipatorischen Erziehung
-
- Wegbereiter praktizierter Demokratie mit Kindern
- Ansprüche der aktuellen Elementarpädagogik
-
- Veränderte Kindheit
- Ideen, Konzepte und Ansprüche aus praxisorientierter Literatur
- Forderungen des Partizipationsgedankens im Situationsansatz
- Empirische Studie
-
- Schwerpunkte und Fragestellungen
- Forschungsmethoden
-
- Methodenkritik
- Stichprobenbeschreibung
- Ergebnisse und Auswertung
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Gesamtdiskussion
- Konsequenzen für die Fachschule für Sozialpädagogik
-
- Komponenten der Ausbildung
-
- Analyse des Ist-Zustandes
- Professionelles Selbst
- Neue Konzepte
-
- Die Situationsorientierte Fachschule
- Lernfelddidaktik
- Selbstbestimmtes und kooperatives Lernen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der aktuellen Ausbildungssituation von ErzieherInnen in Deutschland und analysiert die Bedeutung der Partizipation von Kindern im Kindergarten sowie die entsprechenden Anforderungen an die Fachschule für Sozialpädagogik. Der Fokus liegt dabei auf dem Spannungsfeld zwischen dem Anspruch auf Mitbestimmung und den tatsächlichen Möglichkeiten von Kindern, an Entscheidungen zu partizipieren.
- Analyse der politischen und pädagogischen Ansprüche an die Mitbestimmung von Kindern
- Einblick in psychologische Ansätze, die die Bedeutung von Mitbestimmung für die Entwicklung von Kindern beleuchten
- Diskussion der Rolle der Fachschule für Sozialpädagogik bei der Vorbereitung von ErzieherInnen auf die Umsetzung des Partizipationsgedankens
- Prüfung der Praxisrelevanz der Partizipation von Kindern im Kindergarten durch eine empirische Untersuchung
- Entwicklung von Konzepten, die eine stärkere Berücksichtigung von Partizipation in der Fachschule für Sozialpädagogik ermöglichen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der unzureichenden Partizipation von Kindern im Kindergarten und die mangelnde Berücksichtigung des Themas in der Fachschule für Sozialpädagogik dar. Die zentrale Fragestellung der Arbeit wird formuliert.
- Ansprüche und Forderungen nach Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern: Dieses Kapitel untersucht die rechtlichen und pädagogischen Grundlagen des Partizipationsgedankens. Es werden die Rechte der Kinder durch die UN-Kinderrechtskonvention, nationale Rechte und verschiedene demokratische Konzepte in der Kindergartenpädagogik vorgestellt.
- Psychologische Ansätze zur Begründung der Mitbestimmung: Hier werden psychologische Theorien beleuchtet, die die Bedeutung von Mitbestimmung für die Entwicklung von Kindern belegen. Es werden verschiedene Ansätze wie die Sozialisations- und Moraltheorie, die ökologische Systemtheorie, kognitive und sozial-kognitive Theorien sowie die humanistische Psychologie betrachtet.
- Pädagogische Perspektiven der partizipatorischen Erziehung: Dieses Kapitel diskutiert die Umsetzung des Partizipationsgedankens in der Praxis. Es werden verschiedene Modelle und Konzepte vorgestellt, die die Möglichkeiten von Kindern zur Mitbestimmung im Kindergarten fördern.
- Empirische Studie: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Partizipation von Kindern in Kindergärten. Die Forschungsmethoden werden vorgestellt und die Ergebnisse der Untersuchung werden analysiert und diskutiert.
- Konsequenzen für die Fachschule für Sozialpädagogik: Dieses Kapitel analysiert den Ist-Zustand der Fachschule für Sozialpädagogik und entwickelt Konzepte, die die Ausbildung von ErzieherInnen an den Bedürfnissen der Partizipation von Kindern anpassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf zentrale Themen wie Partizipation von Kindern, Mitbestimmung, Kindergartenpädagogik, Fachschule für Sozialpädagogik, ErzieherInnenbildung, demokratische Bildung, pädagogische Ansätze, empirische Forschung und pädagogische Praxis. Die zentralen Themenbereiche umfassen die Analyse der rechtlichen und pädagogischen Grundlagen der Partizipation von Kindern sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung der Ausbildung von ErzieherInnen im Hinblick auf die Berücksichtigung der Partizipationsbedürfnisse von Kindern.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Arbeit zur Mitbestimmung in Kindergärten?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen dem theoretischen Anspruch auf Partizipation von Kindern und der tatsächlichen pädagogischen Wirklichkeit sowie die Ausbildungssituation von Erziehern.
Welche rechtlichen Grundlagen gibt es für die Partizipation von Kindern?
Zentrale Grundlagen sind die UN-Kinderrechtskonvention sowie nationale Gesetze, die Kindern das Recht auf Beteiligung an sie betreffenden Entscheidungen zusichern.
Welche Kompetenzen benötigen Erzieher für gelebte Mitbestimmung?
Erzieher benötigen ein stabiles professionelles Selbst und sollten idealerweise selbst Erfahrungen in selbstbestimmtem Lernen während ihrer Ausbildung gemacht haben, um Partizipation authentisch unterstützen zu können.
Was ergab die empirische Untersuchung zur Partizipation?
Die Untersuchung zeigte, dass in der Realität oft noch Fremdbestimmung dominiert. Es wird ein Zusammenhang zwischen einer fremdbestimmten Erzieherausbildung und der späteren Praxis im Kindergarten vermutet.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die Fachschulen für Sozialpädagogik?
Es wird ein neuartiger Entwurf gefordert, der Lernfelddidaktik sowie selbstbestimmtes und kooperatives Lernen in den Mittelpunkt stellt, um zukünftige Erzieher besser auf Partizipationskonzepte vorzubereiten.
- Quote paper
- Ines Leyens (Author), 2002, Mitbestimmung von Kindern in Kindergärten: Anspruch und Wirklichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165586