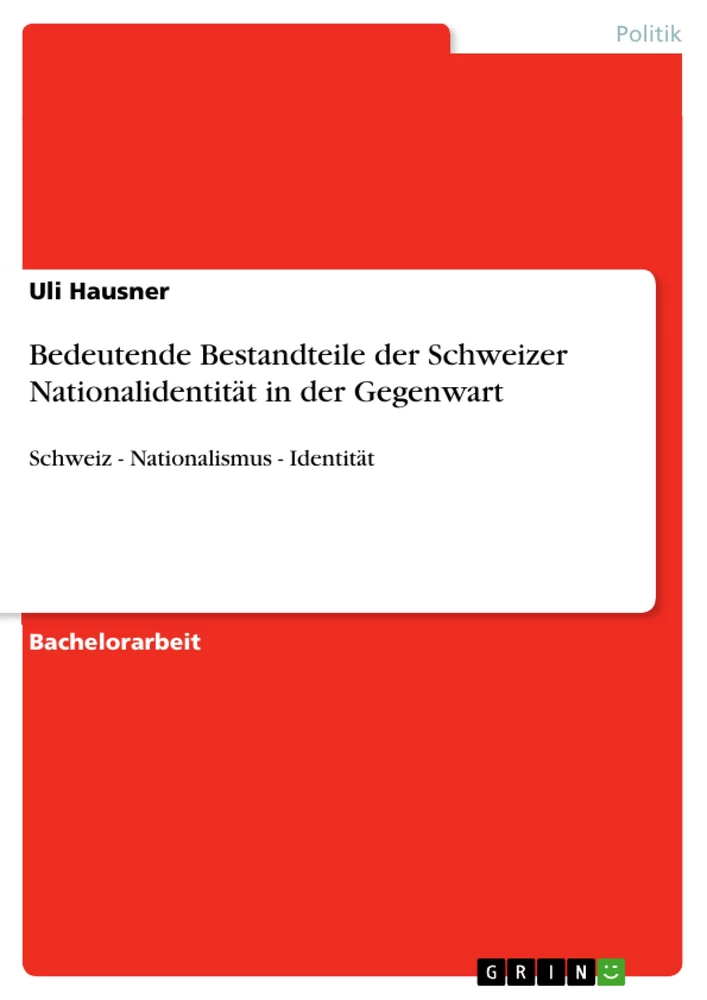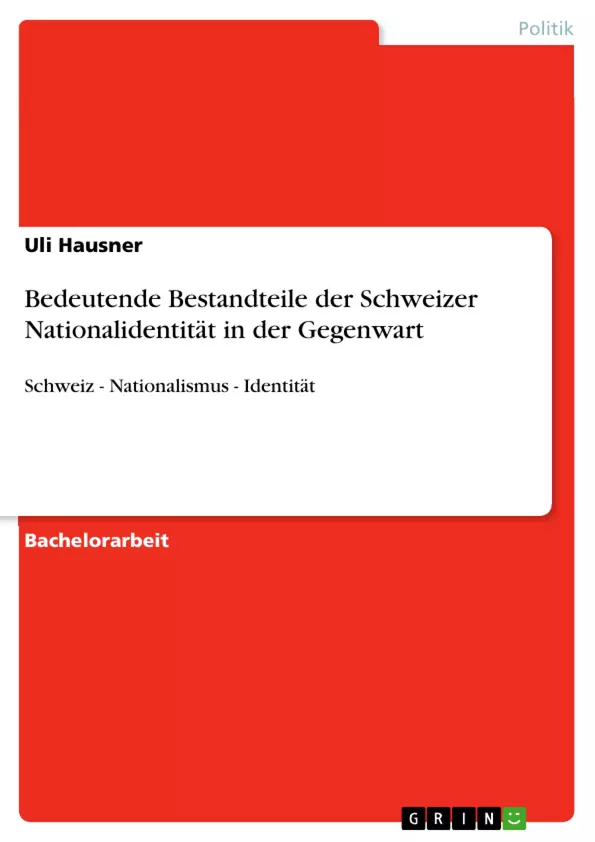Mediale Äußerungen und wissenschaftliche Analysen zum politischen Zustand der Schweiz verkünden in den letzten beiden Jahrzehnten selten Gutes: Ob aus der Feder von Journalisten, Politikwissenschaftlern, Soziologen oder Ökonomen – zumeist steht am Ende der Publikationen eines fest: Die Schweiz befindet sich in einer Krise. Innerhalb des Landes wuchs sich diese Vorstellung in den vergangenen Jahren zu einem „professionellen Negativismus“ aus, womit das Befinden der – schenkt man den Klischees Glauben – zu
Kritik und Unzufriedenheit neigenden Bevölkerung wohl bestens beschrieben ist. Besonders im Mittelpunkt steht dabei häufig die nationale Identität, die in Abhandlungen über die Schweiz als zunehmend erodiert und in Gefahr dargestellt wird. Es bestehe eine gravierende Diskrepanz zwischen Selbstbild der Schweizer auf der einen Seite und der Realität bzw. dem Fremdbild auf der anderen Seite. Zudem seien die althergebrachten Leitlinien und Identitätsmerkmale mit dem für nötig befundenen Modernisierungsprozess im politischem System und im Verhältnis zum internationalen Umfeld nicht vereinbar. Der Historiker Georg
Kreis fordert deshalb die Konstituierung einer „offenen, optimistischen und zukunftsorientierten Variante“ des schweizerischen Nationalbewusstseins. Die Feststellung einer Identitätskrise und die damit verbundene Forderung nach einer gegenwarts- und zukunftsträchtigen Neuorientierung der Identitätsfaktoren lassen oft die Tatsache vergessen,
dass das Zusammenfinden und schon über 160 Jahre währende Bestehen der Schweiz eine höchst bewundernswerte Leistung darstellt. Die Schweiz demonstriert, dass friedliches Zusammenleben in einem Staat unabhängig von gemeinsamer Sprache und Kultur sowie ohne homogene Gemeinschaft funktionieren kann. Die heterogene Struktur, welche vor allem auf ethnischer und sprachlicher Ebene sowie am Stadt-Land-Gegensatz evident ist, bedingt die Definition der Nationalidentität mit Hilfe einigender Traditionen, Werte und Mythen. Diese emotionalen Bindemittel werden ergänzt durch die politische Komponente der nationalen Identität, welche in Form von ausgeprägtem Föderalismus und starker direkter Demokratie in
das schweizerische politische System integriert ist. Doch wie ist das Phänomen nationale Identität theoretisch und abstrakt zu erklären?
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Die konstruktivistische Nationalismustheorie Benedict Andersons
- Bedeutende Faktoren der Schweizer Nationalidentität heute
- Mehrsprachigkeit
- Entstehung
- Viersprachigkeit oder Vielsprachigkeit?
- Geschichtsbewusstsein, Mythen und Symbole
- Konstruktion einer gemeinsamen Geschichte
- Mythen und Symbole
- Kollektive Werte
- Demokratie, Freiheit und Mehrheitsfähigkeit von Minderheiten
- Multikulturalität
- Sonderfallmentalität und Abgrenzung
- Kleinstaatlichkeit
- Neutralität
- Neutralität als identitätsstiftendes Element
- Zwischen Sendungsbewusstsein und Isolationismus
- Mehrsprachigkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Schweizer Nationalidentität in der Gegenwart und analysiert die Faktoren, die diese Identität prägen. Ziel ist es, die aktuelle Situation der schweizerischen Nationalidentität im Kontext der konstruktivistischen Nationalismustheorie Benedict Andersons zu betrachten und zu untersuchen, wie sich die Schweizer Gesellschaft mit ihrer heterogenen Struktur einigende Traditionen, Werte und Mythen geschaffen hat.
- Die Konstruktion der schweizerischen Nationalidentität im Kontext der konstruktivistischen Nationalismustheorie
- Bedeutende Faktoren der Schweizer Nationalidentität in der Gegenwart, wie Mehrsprachigkeit, Geschichtsbewusstsein, Mythen und Symbole, kollektive Werte und Neutralität
- Die Rolle der Schweizer Nationalidentität im Kontext der Modernisierungsprozesse und der internationalen Beziehungen
- Die Bedeutung von Traditionen, Werten und Mythen für die Stabilität und das Zusammenleben in der Schweiz
- Der Sonderfall der Schweiz im Vergleich zu anderen Nationalstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Problemstellung dar und beleuchtet die Debatte über die Schweizer Nationalidentität in der gegenwärtigen Gesellschaft. Es werden Argumente für die Existenz einer Identitätskrise in der Schweiz aufgezeigt und die Bedeutung einer Neuorientierung der Identitätsfaktoren diskutiert. Das zweite Kapitel widmet sich der konstruktivistischen Nationalismustheorie von Benedict Anderson und stellt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es wird die Bedeutung der Konstruktion von Nation und Nationalität anhand der Theorie Andersons erläutert.
Das dritte Kapitel analysiert die wesentlichen Faktoren der Schweizer Nationalidentität im Detail. Es beleuchtet die Rolle von Mehrsprachigkeit, Geschichtsbewusstsein, Mythen und Symbolen, kollektiven Werten und Neutralität für die Schweizer Identität und untersucht die aktuelle Relevanz dieser Elemente.
Schlüsselwörter
Schweizer Nationalidentität, konstruktivistische Nationalismustheorie, Benedict Anderson, Mehrsprachigkeit, Geschichtsbewusstsein, Mythen und Symbole, kollektive Werte, Neutralität, Sonderfall Schweiz, heterogene Gesellschaft, Identitätskrise, Modernisierung, internationale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Faktoren der Schweizer Nationalidentität?
Zu den bedeutendsten Faktoren gehören die Mehrsprachigkeit, ein ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein mit Mythen und Symbolen, kollektive Werte wie Demokratie und Freiheit sowie die politische Neutralität.
Welche Rolle spielt die Mehrsprachigkeit für die Identität der Schweiz?
Die Mehrsprachigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der heterogenen Struktur der Schweiz. Sie zeigt, dass ein friedliches Zusammenleben unabhängig von einer gemeinsamen Sprache funktionieren kann, erfordert jedoch einigende Traditionen als Bindemittel.
Was besagt die konstruktivistische Nationalismustheorie von Benedict Anderson?
Anderson betrachtet die Nation als eine „vorgestellte Gemeinschaft“. Die Arbeit nutzt diesen Ansatz, um zu erklären, wie die schweizerische Nationalidentität aktiv konstruiert und durch Symbole aufrechterhalten wird.
Gibt es eine Identitätskrise in der Schweiz?
In wissenschaftlichen und medialen Debatten wird oft von einer Krise gesprochen, die durch eine Diskrepanz zwischen dem traditionellen Selbstbild und der modernen Realität sowie internationalen Anforderungen entsteht.
Was ist unter der „Sonderfallmentalität“ zu verstehen?
Die Sonderfallmentalität beschreibt das schweizerische Selbstverständnis einer einzigartigen politischen und sozialen Struktur, die sich oft durch Abgrenzung gegenüber dem internationalen Umfeld definiert.
- Citation du texte
- Uli Hausner (Auteur), 2009, Bedeutende Bestandteile der Schweizer Nationalidentität in der Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166196