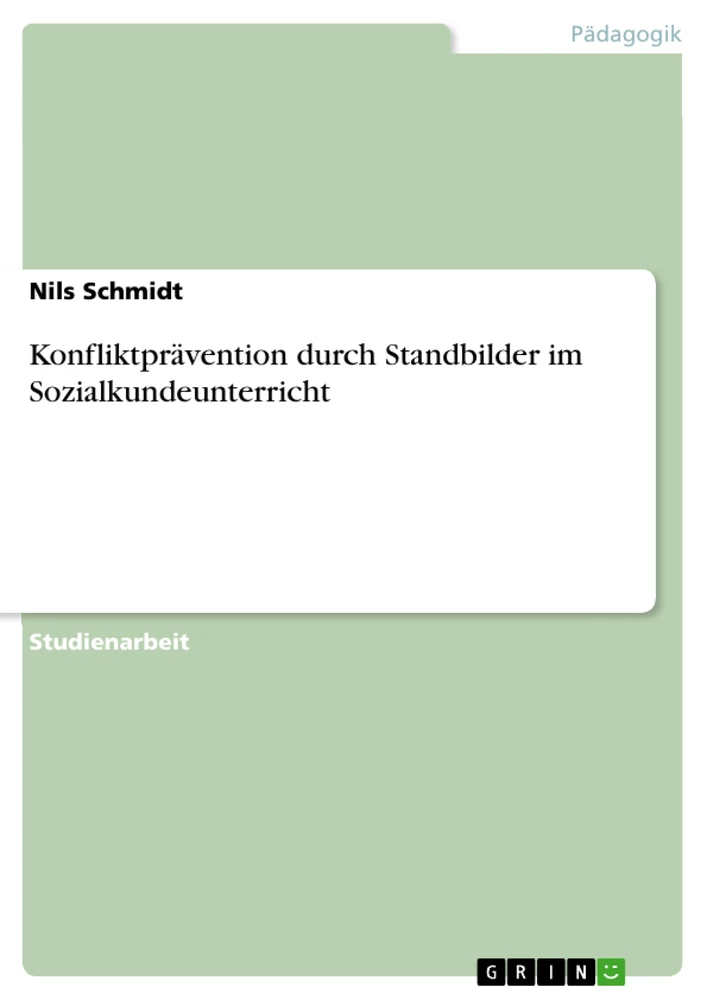Konflikte sind ein unumgehbarer Teil des menschlichen Lebens. Sie können zwar in einer kanalisierten Austragungsform, beispielsweise in einer anregenden Diskussion, durchaus gewinnbringend sein, das geläufigere Verständnis des Begriffes Konflikt ist aber ein anderes: Konflikte sind oft mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden und hinterlassen häufig auch nach der Lösung ein ungutes Gefühl bei den Beteiligten. Grundsätzlich ist das Zusammenleben von Menschen jedoch ohne Konflikte nicht möglich, ebenso ist es auch kaum vorstellbar, dass ein Mensch nie in einen inneren Konflikt gerät. Deshalb scheint eine wesentliche personale Kompetenz darin zu bestehen, mit Konflikten in ihren unterschiedlichen Ausprägungen sinnvoll und angemessen umzugehen. Diese Kompetenz muss jeder Schüler in der Schule erwerben können. Doch lassen sich bestimmte Konfliktsituationen gewissermaßen auch antizipieren und so offene Konflikte verhindern. Die Bedingungen für eine solche Antizipationsfähigkeit sind vielfältig, doch gerade der Sozialkundeunterricht bietet die Möglichkeit, mit den Schülern durch Symbolisierungsformen Präventionsstrategien zu entwickeln und zu üben, denn in keinem anderen Unterrichtsfach spielen insbesondere soziale Konflikte eine so explizite Rolle wie im Sozialkundeunterricht. Zu nennen sind hier beispielhaft familiäre, gesellschaftliche oder internationale Konflikte.
Diese Arbeit befasst sich mit dem unterrichtsspezifischen Ziel der Konfliktprävention und setzt dieses zu der Unterrichtsmethode des Standbildes in Bezug.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konflikte
- Kriterien zur Konfliktbestimmung
- Der Schüler-Schüler-Konflikt
- Der Lehrer-Schüler-Konflikt
- Das Standbild als Unterrichtsmethode
- Ablauf und Ziele des Standbildbauens
- Allgemeine Vor- und Nachteile der Methode
- Konfliktprävention durch Standbilder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konfliktprävention im Sozialkundeunterricht und bewertet die Methode des Standbildbaus als Werkzeug hierfür. Sie analysiert den vielschichtigen Konfliktbegriff, untersucht Schüler-Schüler- und Lehrer-Schüler-Konflikte und beleuchtet die didaktischen Aspekte des Standbildbaus. Das Ziel ist es, die Eignung des Standbildbaus zur Konfliktprävention im Sozialkundeunterricht zu evaluieren und praktische Anwendungshinweise zu geben.
- Der Konfliktbegriff und seine verschiedenen Ausprägungen
- Schüler-Schüler- und Lehrer-Schüler-Konflikte im schulischen Kontext
- Die Methode des Standbildbaus im Unterricht
- Potenzial und Grenzen des Standbildbaus zur Konfliktprävention
- Praktische Implikationen für den Einsatz im Sozialkundeunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Konfliktprävention im Sozialkundeunterricht ein. Sie betont die Bedeutung des Umgangs mit Konflikten als personale Kompetenz und die Rolle des Sozialkundeunterrichts bei der Entwicklung von Präventionsstrategien. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Standbildbaus als Methode zur Konfliktvermeidung. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise der folgenden Kapitel.
Konflikte: Dieses Kapitel beleuchtet den vielschichtigen Konfliktbegriff. Es differenziert zwischen intrapersonalen und interpersonalen Konflikten, ordnet Konflikte nach ihrer Reichweite in einem Systemebenenmodell (Mikro-, Meso-, Makroebene) und diskutiert das Kriterium der Gewalt als Klassifizierungshilfe. Es werden verschiedene Konfliktformen im schulischen Kontext vorgestellt (Schein-, Extrem-, Rand- und Zentralkonflikte), wobei der Schwerpunkt auf Schüler-Schüler- und Lehrer-Schüler-Konflikten liegt. Das Kapitel betont die subjektive Komponente bei der Bewertung von Konflikten und deren Ausmaß an Gewalt.
Das Standbild als Unterrichtsmethode: Dieses Kapitel beschreibt die Methode des Standbildbaus. Es erläutert den Ablauf und die didaktischen Ziele dieser Methode. Darüber hinaus werden allgemeine Vor- und Nachteile des Standbildbaus im Unterricht diskutiert, um die Möglichkeiten und Grenzen dieser Methode aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Methode und ihrer didaktischen Relevanz, ohne explizit auf die Konfliktprävention einzugehen, die im nächsten Kapitel behandelt wird.
Schlüsselwörter
Konfliktprävention, Sozialkundeunterricht, Standbildmethode, Schüler-Schüler-Konflikt, Lehrer-Schüler-Konflikt, Konfliktlösung, Didaktik, Präventionsstrategien, interpersonale Konflikte, Systemebenenmodell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Konfliktprävention im Sozialkundeunterricht mittels Standbilder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung des Standbildbaus als Methode zur Konfliktprävention im Sozialkundeunterricht. Sie analysiert den Konfliktbegriff, verschiedene Konflikttypen (Schüler-Schüler, Lehrer-Schüler), und die didaktischen Aspekte des Standbildbaus, um dessen Potenzial und Grenzen für die Konfliktprävention zu evaluieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: den vielschichtigen Konfliktbegriff und seine Ausprägungen, Schüler-Schüler- und Lehrer-Schüler-Konflikte im schulischen Kontext, die Methode des Standbildbaus im Unterricht, das Potenzial und die Grenzen des Standbildbaus zur Konfliktprävention sowie praktische Implikationen für den Einsatz im Sozialkundeunterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt: Einleitung, Konflikte (mit Unterkapiteln zu Konfliktkriterien und verschiedenen Konflikttypen), Das Standbild als Unterrichtsmethode (Ablauf, Ziele, Vor- und Nachteile), und Konfliktprävention durch Standbilder. Jedes Kapitel wird zusammengefasst und Schlüsselbegriffe werden am Ende genannt.
Welche Arten von Konflikten werden untersucht?
Die Arbeit untersucht intrapersonale und interpersonale Konflikte, wobei der Schwerpunkt auf Schüler-Schüler- und Lehrer-Schüler-Konflikten im schulischen Kontext liegt. Es werden verschiedene Konfliktformen (Schein-, Extrem-, Rand- und Zentralkonflikte) und Kriterien zur Konfliktbestimmung diskutiert.
Was ist ein Standbild im Unterrichtskontext?
Das Kapitel "Das Standbild als Unterrichtsmethode" beschreibt den Ablauf und die didaktischen Ziele dieser Methode. Es werden die Vor- und Nachteile des Standbildbaus im Unterricht erörtert, um die Möglichkeiten und Grenzen dieser Methode aufzuzeigen. Die Anwendung im Kontext der Konfliktprävention wird im darauf folgenden Kapitel behandelt.
Wie wird die Eignung des Standbildbaus zur Konfliktprävention bewertet?
Die Arbeit evaluiert die Eignung des Standbildbaus zur Konfliktprävention, indem sie dessen Potenzial und Grenzen im Kontext des Sozialkundeunterrichts analysiert. Sie liefert praktische Anwendungshinweise für den Einsatz dieser Methode.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konfliktprävention, Sozialkundeunterricht, Standbildmethode, Schüler-Schüler-Konflikt, Lehrer-Schüler-Konflikt, Konfliktlösung, Didaktik, Präventionsstrategien, interpersonale Konflikte, Systemebenenmodell.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Eignung des Standbildbaus zur Konfliktprävention im Sozialkundeunterricht zu evaluieren und praktische Anwendungshinweise zu geben. Sie analysiert den Konfliktbegriff, untersucht Schüler-Schüler- und Lehrer-Schüler-Konflikte und beleuchtet die didaktischen Aspekte des Standbildbaus.
- Citation du texte
- Nils Schmidt (Auteur), 2010, Konfliktprävention durch Standbilder im Sozialkundeunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166571