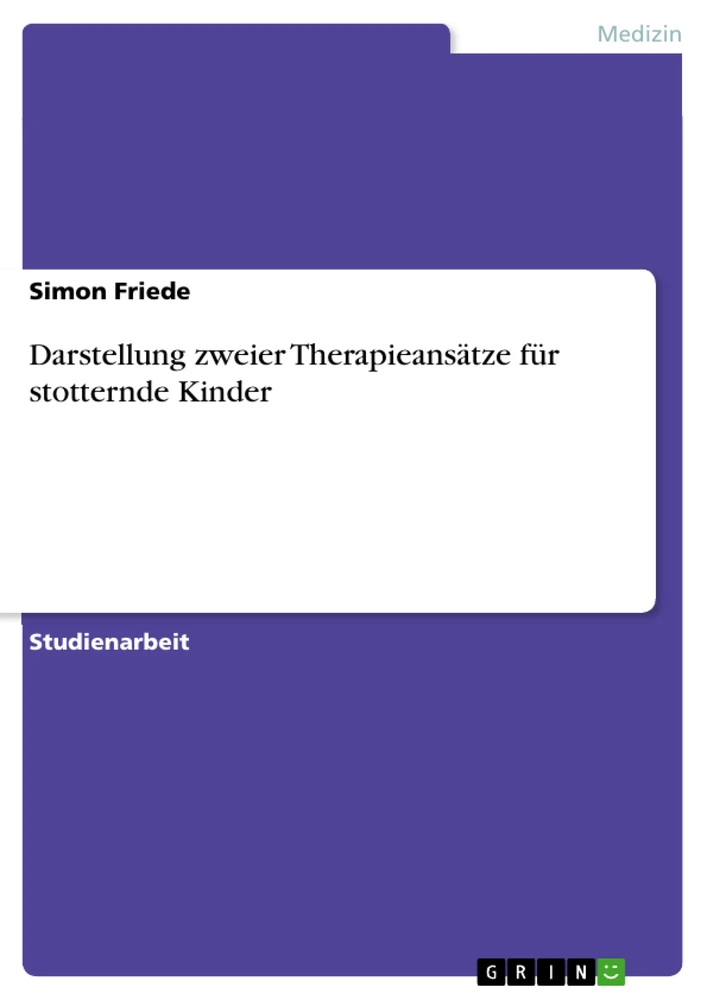Im Folgenden werden zwei Therapiekonzepte für Kinder mit Sprechunflüssigkeiten bzw. Stottern vorgestellt.
Der direkte Therapieansatz KIDS nach Sandrieser und Schneider ist für die Behandlung von stotternden Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren (und auch für ältere Kinder) geeignet. Das Ziel dieses Ansatzes ist die Remission zu erhöhen. Sollte keine Remission erfolgen, sollen mindestens die Begleitsymptome vermindert bzw. vollständig abgebaut werden und ein lockeres, an-strengungsfreies Stottern möglich sein. Der Ansatz ist denen der Stottermodifikation zuzuordnen. Die kontinuierliche Einbeziehung der Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil (Sandrieser, 2003, S. 14).
Das Therapiekonzept nach Hansen und Iven basiert auf einem systemisch-konstruktiven Menschenbild. Die Integration verschiedener Methoden steht im Mittelpunkt des Konzeptes, welches aus verschiedenen Therapiebausteinen besteht. Diese sind entwicklungspsychologisch begründet und werden individuell für jedes Kind ausgewählt (Hansen/Iven, 2002, S. 1-2). Die Einbeziehung der Eltern ist hierbei ebenfalls entscheidend. Ziel dieses Ansatzes ist die „Entlastung des Kindes und seiner Kommunikationspartner durch die Reduktion unterbrechender Faktoren und das gezielte Angebot von Strukturen, in denen flüssiges Sprechen oder flüssigeres Stottern ermöglicht wird“ (Hansen/Iven, 2002, S. 68-69). Zudem sollen den Kindern im Spiel Erfahrungen mit flüssigerem Sprechen ermöglicht und dafür Sorge getragen werden, dass möglichst oft sprechflüssigkeitsfördernde Bedingungen herrschen (Hansen/Iven, 2002, S. 49).
Dieser Ansatz ist auf Grund des Konzeptes der Methodenintegration weder dem Prinzip des fluency-shaping noch dem non-avoidance (stutteringmanagement) Ansatz eindeutig zuzuordnen.
Auf andere Therapieansätze sowie die Behandlung des Stotterns bei Erwachsenen wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. Auch werden keine Diagnoseverfahren, Methoden oder weitere Hypothesen zur Ätiologie des Stotterns vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- KIDS - Kinder dürfen Stottern
- Therapieansatz
- Indikation
- Ziele
- Therapiebereiche
- Stottersymptomatik
- Psychische Reaktionen
- Risikofaktoren
- Bezugspersonen
- Therapieende und Nachsorge
- Methoden und Techniken
- Allgemeine Therapieprinzipien
- Sprach- und Kommunikationstherapie mit unflüssig sprechenden (Vor-) Schulkindern
- Therapieansatz
- Indikation
- Ziele
- Therapiebausteine
- Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau
- Begriffe begreifen können
- Weiches, leichtes und langsameres Sprechen
- Ausdehnung und Automatisierung der flüssigen Sprechanteile
- Konkrete und offene Auseinandersetzung mit Unflüssigkeiten und Stottern
- Stimme, Atmung und Entspannung
- Selbstaktualisierung und Kreativität
- Einstellungen und Selbstkonzept
- Frustrationstoleranz
- Reduzierung der kommunikativen Verantwortung
- Aufgreifen weiterer (Sprach-) Entwicklungsrückstände
- Transfer
- Nachsorge und Ende der Therapie
- Abschließende Bemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert zwei verschiedene Therapieansätze für Kinder mit Sprechunflüssigkeiten. Der Fokus liegt dabei auf dem direkten Therapieansatz KIDS nach Sandrieser und Schneider sowie dem systemisch-konstruktiven Ansatz nach Hansen und Iven.
- Analyse und Vergleich der beiden Therapiekonzepte
- Beschreibung der Therapieziele und -bereiche
- Untersuchung der Relevanz der Elternarbeit in beiden Ansätzen
- Einblick in die Methoden und Techniken der Therapie
- Bewertung der beiden Ansätze hinsichtlich ihrer Effektivität und Eignung für verschiedene Altersgruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Sprechunflüssigkeiten bei Kindern ein und stellt die beiden untersuchten Therapieansätze vor. Kapitel 2 widmet sich dem KIDS-Ansatz, der die offene Thematisierung des Stotterns betont und die Reduzierung von Begleitsymptomen sowie das Erreichen einer spontanen Sprechflüssigkeit als Ziele formuliert. Kapitel 3 behandelt den Ansatz nach Hansen und Iven, der auf einem systemisch-konstruktiven Menschenbild basiert und die Integration verschiedener Methoden beinhaltet. Der Fokus liegt dabei auf der Entlastung des Kindes und seinen Kommunikationspartnern sowie der Förderung flüssigen Sprechens im Spiel.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Stottern, Sprechunflüssigkeiten, Kinder, Therapieansätze, KIDS, Sandrieser und Schneider, Hansen und Iven, Methodenintegration, systemisch-konstruktiv, Remission, Elternarbeit, Sprechflüssigkeit, Begleitsymptome, Therapieziele, Therapiebereiche.
- Citation du texte
- B.Sc. Simon Friede (Auteur), 2008, Darstellung zweier Therapieansätze für stotternde Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166703