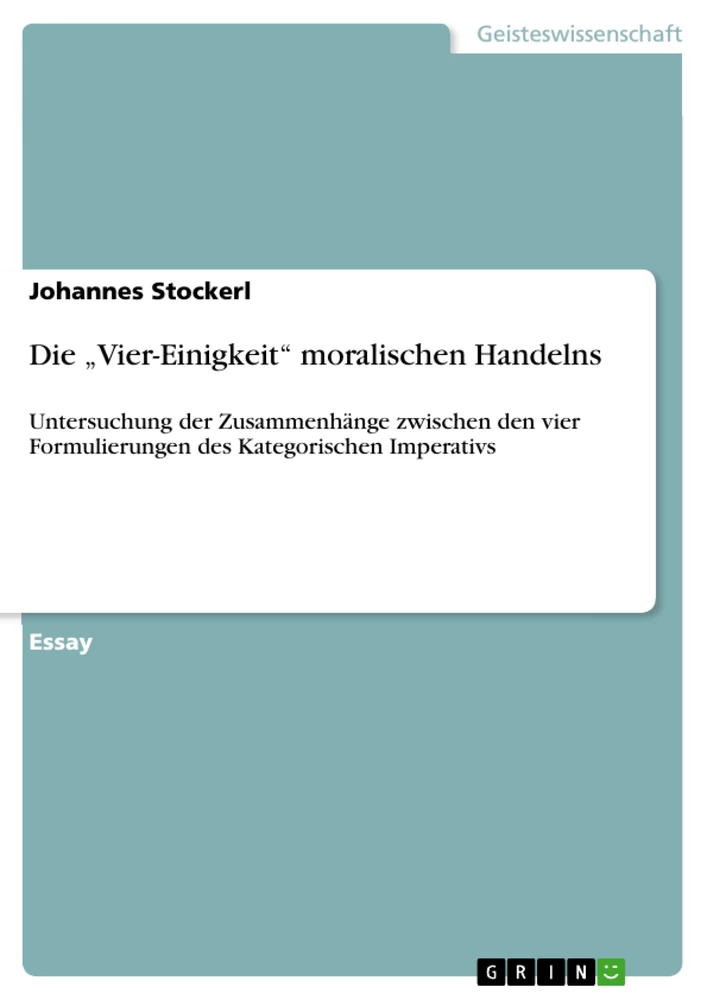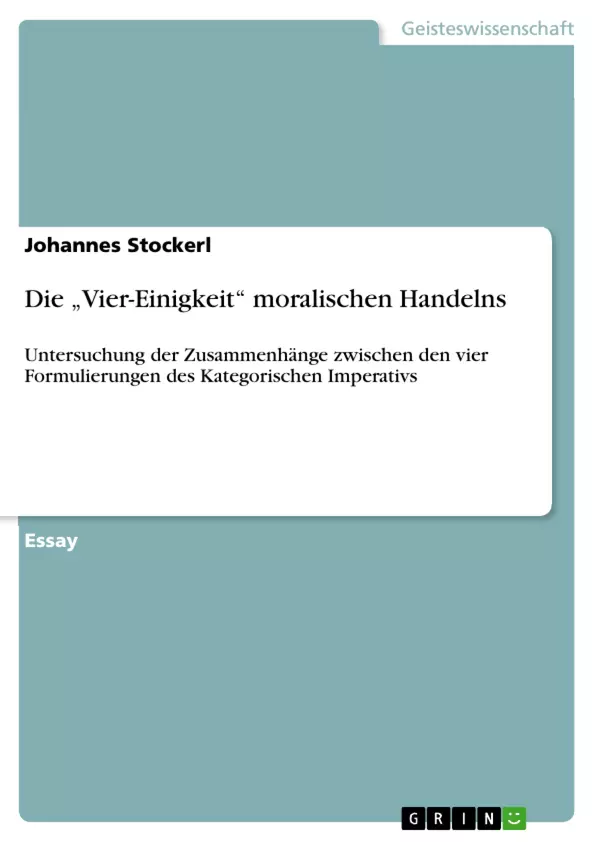Wenn der Name „Kant“ fällt, kommt dem einen oder anderen sicherlich so etwas wie: „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg’ auch keinem andern zu“, in den Sinn. Doch diese so genannte „Goldene Regel“ stammt nicht nur nicht von Kant, sie unterscheidet sich ganz grundsätzlich von der Kant’schen Moralphilosophie, kann uns aber bei näherer Betrachtung zumindest dabei helfen, deren komplexen Charakter besser zu verstehen.
Dabei ist es durchaus möglich, dass man als Leser der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS) zumindest den Anfangsverdacht einer argumentativen Schizophrenie, d.h. einer tief sitzenden, inneren Widersprüchlichkeit in den Ausführungen des Philosophen auszumachen glaubt. Besonders knifflig ist das Kernstück des moralischen Gedankengebäudes Kants’, nämlich der so genannte Kategorische Imperativ (KI). Zunächst scheint die Situation klar, wenn er diesen wie folgt definiert: „Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“
Inhaltsverzeichnis
- Die „Vier-Einigkeit“ moralischen Handelns – Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den vier Formulierungen des Kategorischen Imperativs
- Einleitung
- Die vier Formulierungen des Kategorischen Imperativs
- Die Universalisierungsformel
- Die Selbstzweckformel
- Die Naturgesetzformel
- Die Reich-der-Zwecke-Formel
- Die „Doppelbindungen“
- Der Mensch als Zweck an sich
- Das Reich der Zwecke
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den vier verschiedenen Formulierungen des Kategorischen Imperativs in Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Die Analyse soll aufzeigen, wie diese Formulierungen miteinander verbunden sind und welchen Stellenwert sie im moralischen Gedanken Kants einnehmen.
- Analyse des Aufbaus und der Argumentationslinie in Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
- Untersuchung der Beziehung zwischen den vier Formulierungen des Kategorischen Imperativs
- Bedeutung des Menschen als Zweck an sich und seine Rolle im moralischen Handeln
- Relevanz des Reich-der-Zwecke-Konzepts für die praktische Anwendung des Kategorischen Imperativs
- Kritik an egozentrischen Moralvorstellungen und Verdeutlichung des Kantianischen Konzepts der Universalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die „Goldene Regel“ als Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit der Kant'schen Moralphilosophie vor und hebt die grundlegenden Unterschiede zwischen beiden Konzepten hervor. Sie führt in das Thema der vier Formulierungen des Kategorischen Imperativs ein und kündigt die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen ihnen an.
- Dieses Kapitel präsentiert die vier Formulierungen des Kategorischen Imperativs: die Universalisierungsformel, die Selbstzweckformel, die Naturgesetzformel und die Reich-der-Zwecke-Formel. Es wird eine erste, grobe Analyse des Zusammenhangs zwischen den Formulierungen anhand der räumlichen Anordnung der Passagen in Kants Text vorgenommen.
- Dieses Kapitel beleuchtet die inhaltliche Ebene der „Doppelbindungen“ zwischen der Universalisierungs- und der Naturgesetzformel sowie der Selbstzweck- und der Reich-der-Zwecke-Formel. Der Unterschied zwischen dem egoistischen Charakter der Goldenen Regel und Kants Universalisierungsformel wird hervorgehoben. Die Bedeutung des menschlichen Willens als Prinzip des moralischen Handelns wird erläutert.
- Dieses Kapitel setzt sich mit dem „falschen Kant“ auseinander, d.h. mit der Missinterpretation seines moralischen Systems als eines leeren Pflichtbegriffs. Es wird gezeigt, dass Kants Moralphilosophie nicht auf einem subjektiven, sondern auf einem objektiven Prinzip basiert, das den Menschen als vernünftiges Wesen zum Ausgangspunkt des moralischen Handelns nimmt.
- Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle des Willens als Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung und als Grund für ein objektives Handeln, das sich auf den Zweck an sich aller vernünftigen Wesen richtet. Es wird die Abgrenzung zwischen Zweck und Mittel dargestellt und die Bedeutung des Menschen als Zweck an sich für die Moralität betont.
- Dieses Kapitel erklärt den Zusammenhang zwischen der Selbstzweckformel und der Reich-der-Zwecke-Formel. Das Reich der Zwecke als eine „mundus intelligibilis“ wird als ein überindividuelles System verstanden, das durch die Gesetzgebung aller Personen als Glieder ermöglicht wird.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Arbeit sind der Kategorische Imperativ, Universalisierung, Selbstzweckformel, Naturgesetzformel, Reich der Zwecke, menschlicher Wille, Vernunft, Moralität, Zweck an sich, Mittel, Handlungsmaximen, Goldene Regel und Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Die Arbeit analysiert Kants Moralphilosophie und seine Auseinandersetzung mit egozentrischen Moralvorstellungen, wobei der Mensch als Zweck an sich und die Universalisierung als zentrale Themen im Fokus stehen.
- Quote paper
- Johannes Stockerl (Author), 2011, Die „Vier-Einigkeit“ moralischen Handelns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167062