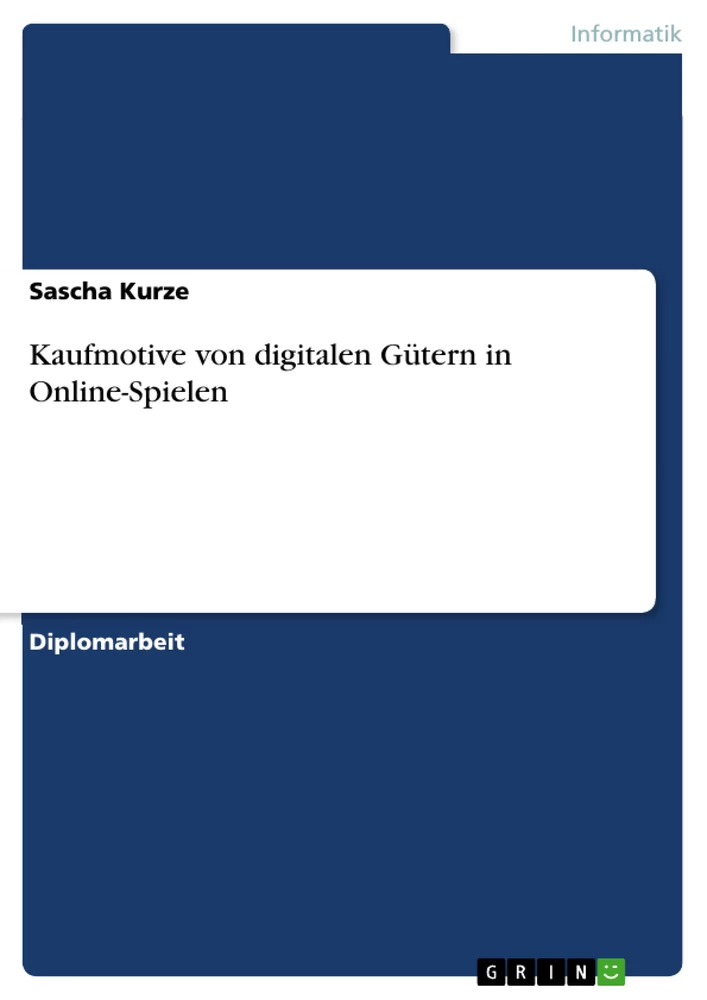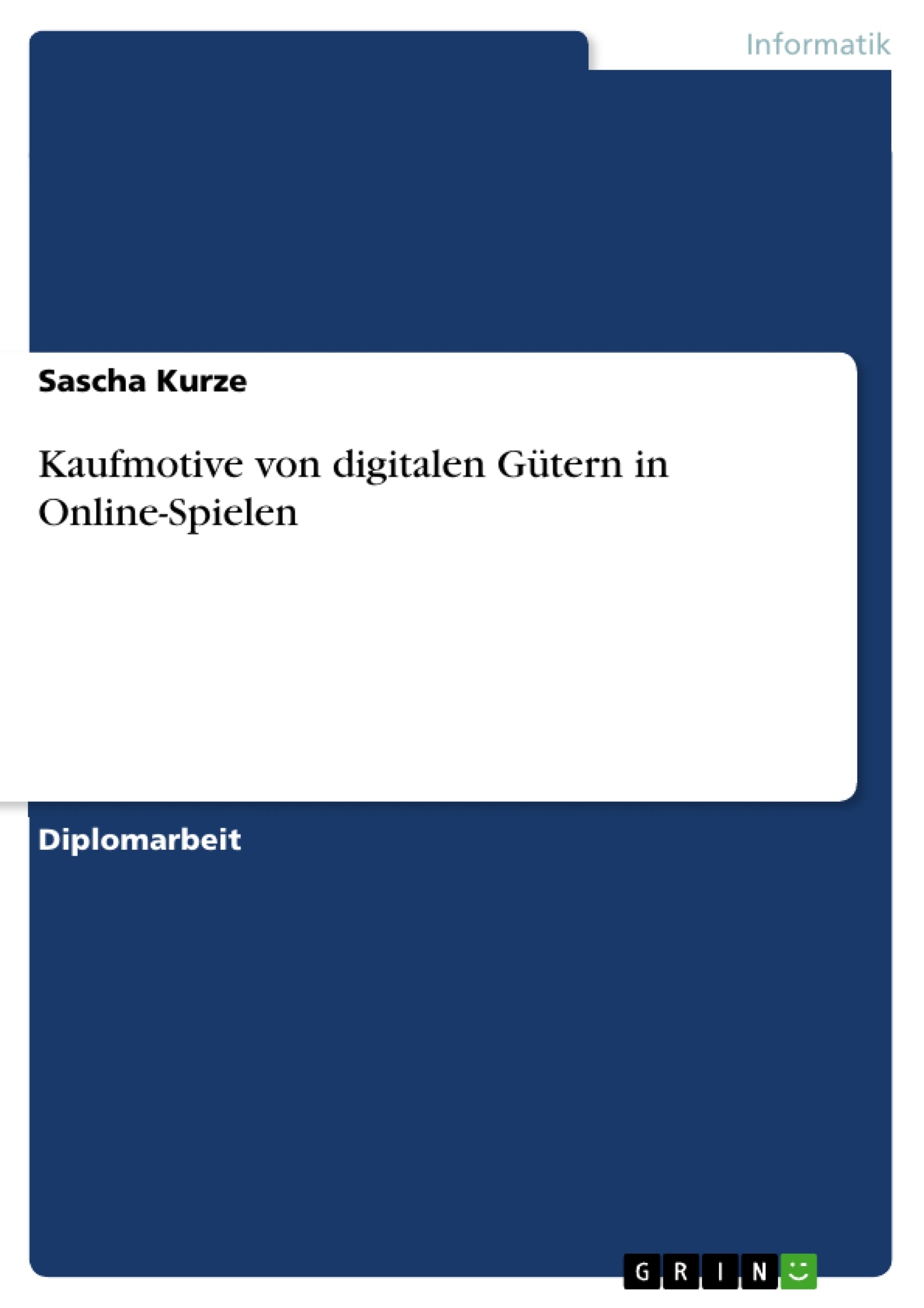Das Jahr 1999 war ein besonderes Jahr für die im Internet angebotenen Onlinespiele. In dem Jahr begannen die Spieler von MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) auf eBay ihre im Spiel hart verdienten Besitztümer an den Meistbietenden zu versteigern. Ein neuer Markt war kreiert worden: der Markt der virtuellen Güter. Eine Schätzung geht davon aus, dass dieser weltweite digitale Gütermarkt für Onlinespiele bereits im Jahr 2009 einen Umsatz von fast 5 Milliarden US-Dollar erreicht hat. 52,6 Millionen Euro Umsatz entfielen dabei auf den deutschen Markt. Gleichzeitig wächst der Markt für Onlinespiele pro Jahr um circa 60 Prozent. Diese Entwicklungen charakterisieren einen jungen, stark wachsenden Markt. Das haben auch die ersten New-Economy-Unternehmen erkannt und sind bereit, viel Geld für Entwicklerschmieden von Onlinespielen zu bezahlen. So hat Google im Juli 2010 etwa 100 Millionen US-Dollar (circa 71,9 Millionen Euro) in den Onlinespiele-Entwickler Zynga investiert. Ein Jahr zuvor hatte der Spielehersteller Electronic Arts bereits das Unternehmen Playfish übernommen. Bei dieser rasanten Entwicklung sind etliche Fragen zu diesem neuartigen Ort des Angebotes und der Nachfrage nicht hinreichend beantwortet worden. Kann man mit unserem heutigen klassischen Güterverständnis überhaupt erklären, warum Menschen bereit sind, für „Nullen und Einsen“ Geld auszugeben? Warum kaufen die Menschen Güter, die sie weder anfassen noch riechen oder schmecken können? Eine eingehende Untersuchung dieses neuen Marktes, an dem mit virtuellen Gütern gehandelt wird, fand bisher kaum statt. Die vorliegende Arbeit will einen Beitrag dazu leisten, mithilfe einer empirischen Untersuchung, diese Lücke zu schließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziele der Untersuchung
- Gegenstand und Gang der Untersuchung
- Terminologische Grundlagen
- Das digitale Gut
- Das virtuelle Gut
- Definition und Abgrenzung
- Produktion
- Einordnung in die Gütersystematik
- Einordnung in die Gütersystematik nach Maleri
- Der Digitalisierungsgrad als Kriterium
- Handelbares versus nicht handelbares Gut
- Onlinespiele
- Massively Multiplayer Online Game (MMOG)
- Browsergames
- Virtuelle Welten
- Sonstige Spieletypen
- Motiv, Kaufmotiv
- Modelle
- Marktmodell
- Erlösmodelle
- Durchführung der empirischen Untersuchung
- Aufbau des Fragebogens
- Erhebung der Daten
- Auswertung der empirischen Untersuchung
- Beschreibung der Stichprobe
- Spieletypnutzung und Spielhäufigkeit
- Besondere Käufereigenschaften
- Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest
- Abonnementkunden
- Käufer virtueller Güter
- Motive für den Kauf virtueller Güter
- Kenngrößen der Kaufmotive
- Clusteranalyse der Käufer
- Überblick
- Der Geltungsbedürftige
- Der Zeitsparer
- Der Tester
- Der Machthungrige
- Motive des nicht getätigten Kaufs virtueller Güter
- Kenngrößen des nicht getätigten virtuellen Güterkaufes
- Faktorenanalytische Eignungsprüfung
- Clusteranalyse der Nicht-Käufer
- Kaufbereitschaft unter veränderten Bedingungen
- Der Käufer
- Der Nicht-Käufer
- Lösungsansatz für das Dilemma des Akzeptanzproblems
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Kaufmotiven von digitalen Gütern in Online-Spielen. Ziel ist es, die Determinanten des Kaufverhaltens von Spielern zu identifizieren und zu analysieren. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Kaufmotive und deren Einfluss auf die Kaufentscheidung.
- Definition und Abgrenzung von digitalen und virtuellen Gütern
- Analyse der verschiedenen Onlinespieltypen und deren Einfluss auf das Kaufverhalten
- Identifizierung und Analyse von Kaufmotiven für virtuelle Güter
- Untersuchung der Faktoren, die den nicht getätigten Kauf von virtuellen Gütern beeinflussen
- Entwicklung eines Lösungsansatzes für das Dilemma des Akzeptanzproblems bei virtuellen Gütern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung ein und definiert die Ziele der Untersuchung. Im zweiten Kapitel werden die terminologischen Grundlagen erläutert, wobei die Definition und Abgrenzung von digitalen und virtuellen Gütern im Vordergrund steht.
Das dritte Kapitel präsentiert verschiedene Modelle, die für die Untersuchung relevant sind. Das vierte Kapitel beschreibt die Durchführung der empirischen Untersuchung, einschließlich des Aufbaus des Fragebogens und der Erhebung der Daten.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Auswertung der empirischen Untersuchung. Es werden die Stichprobe beschrieben, die Spieletypnutzung und Spielhäufigkeit analysiert und besondere Käufereigenschaften untersucht.
Im sechsten Kapitel werden die Kaufmotive für virtuelle Güter analysiert, wobei eine Clusteranalyse der Käufer durchgeführt wird.
Das siebte Kapitel untersucht die Motive des nicht getätigten Kaufs von virtuellen Gütern.
Das achte Kapitel beschäftigt sich mit der Kaufbereitschaft unter veränderten Bedingungen.
Das neunte Kapitel präsentiert einen Lösungsansatz für das Dilemma des Akzeptanzproblems bei virtuellen Gütern.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen Kaufmotive, digitale Güter, virtuelle Güter, Online-Spiele, MMOG, Browsergames, virtuelle Welten, Clusteranalyse, Kaufbereitschaft und Akzeptanzproblem.
Häufig gestellte Fragen
Warum geben Menschen Geld für virtuelle Güter in Online-Spielen aus?
Die Kaufmotive sind vielfältig und reichen von Zeitersparnis über Geltungsbedürfnis bis hin zum Wunsch nach Macht oder dem bloßen Testen neuer Funktionen.
Was sind die wichtigsten Käufer-Cluster bei digitalen Gütern?
Die empirische Untersuchung identifiziert Typen wie den „Zeitsparer“, den „Geltungsbedürftigen“, den „Tester“ und den „Machthungrigen“.
Wie groß ist der Markt für virtuelle Güter?
Bereits im Jahr 2009 erreichte der weltweite Umsatz fast 5 Milliarden US-Dollar, wobei der deutsche Markt einen signifikanten Anteil beisteuerte.
Was ist der Unterschied zwischen einem digitalen und einem virtuellen Gut?
Digitale Güter sind immaterielle Datenprodukte im Allgemeinen; virtuelle Güter existieren spezifisch innerhalb einer simulierten Welt oder eines Spielkontexts und haben dort einen Nutzwert.
Welche Barrieren gibt es beim Kauf von virtuellen Gütern?
Viele Nicht-Käufer haben Akzeptanzprobleme, da sie den Wert von „Nullen und Einsen“ kritisch hinterfragen oder die Vergänglichkeit der Güter fürchten.
- Quote paper
- Sascha Kurze (Author), 2011, Kaufmotive von digitalen Gütern in Online-Spielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167465