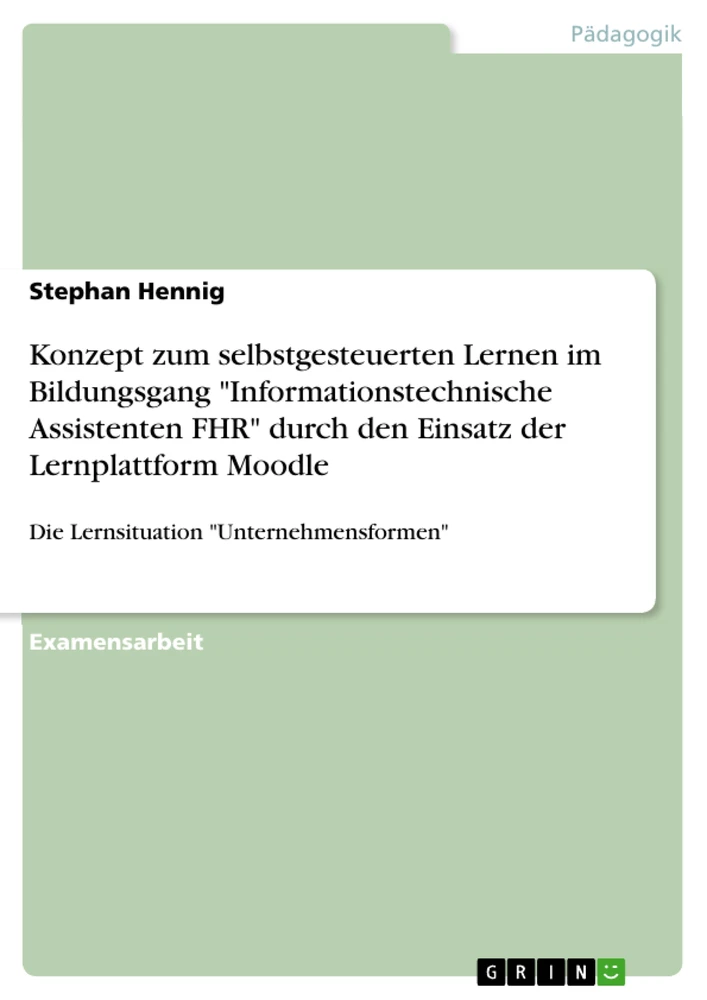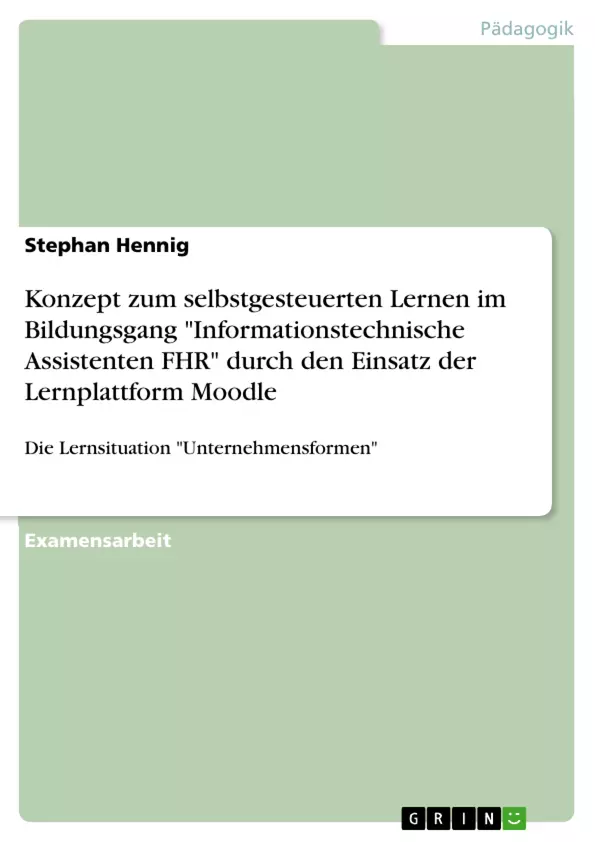Das Konzept des selbstgesteuerten Lernens nimmt seit geraumer Zeit einen immer bedeutsameren Stellenwert in der pädagogischen Diskussion ein und findet in der beruflichen Bildung große Beachtung. Dies mag unter anderem damit zusammen hängen, dass sich sowohl die Gesellschaft wie auch die Wirtschaft in einem permanenten, sich ständig beschleunigenden Strukturwandel befinden. Die Arbeitswelt verändert sich rapide und ist durch ständig neue Anforderungen an die Bewältigung offener Handlungsvollzüge und die Strukturierung von Arbeitsabläufen geprägt. Die Anforderungen an die beteiligten Fachkräfte steigen und verlangen ein wachsendes Maß an Selbststeuerung und Eigenverantwortung. Vom einzelnen Mitarbeiter wird dabei eine immer größere Bereitschaft erwartet, sich den veränderten Konstellationen der Arbeitswelt selbstständig und eigenverantwortlich zu stellen, an den Veränderungen mitzuwirken, stärker Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und sich selbstständig neues Wissen anzueignen, wenn dies erforderlich ist.
Neben diesen Tendenzen in der Berufswelt können auch weitreichende Veränderungen in der Gesellschaft ausgemacht werden, die von einer Erhöhung der Mobilität, von schnellem und stetigem Wertewandel und Planungsunsicherheiten sowie von Veränderungen in der Familie, die in einer zunehmenden Individualisierung münden, geprägt sind. Zur erfolgreichen Gestaltung der eigenen Lebensführung sind in hohem Maße Fähigkeiten zur Selbstreflexivität und Selbstorganisation notwendig, die in den meisten Fällen von jungen Menschen erst noch erworben werden müssen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziele der Arbeit
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Das Ziel: Erwerb von Handlungskompetenz
- Konstruktivismus
- Begriffe
- Selbst gesteuertes Lernen/Selbst organisiertes Lernen
- Moodle
- Sandwich-Prinzip
- Advanced Organizer
- Selbst gesteuertes Lernen/Selbst organisiertes Lernen (SOL)
- Was ist SOL?
- Didaktisch-methodische Grundlagen
- Lehr- und Lernkultur
- Merkmale selbst gesteuerten Lernens
- E-Learning
- Praktischer Teil: Umsetzung von SOL im Unterricht
- Unterrichtsreihe und Kompetenzen
- Didaktische Analyse
- Lernausgangslage
- SOL-basierter Unterrichtsentwurf mit Moodle
- Veröffentlichung der Lernsituation
- Methodisch-didaktischer Aufbau
- Lernziele
- Zeitplanung
- Einteilung der Klasse in Stammgruppen mit Moodle
- Das Lerntagebuch
- Bildung und Arbeitsauftrag der Expertengruppen
- Wissensvermittlung in der Stammgruppe
- Übung und Feedback während der Unterrichtssequenz
- Besprechung der Lösungen (Lerntempoduett)
- Metakognition
- Möglicher Ablauf der Unterrichtssequenz (Phasen)
- Ergebnis
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept des selbstgesteuerten Lernens (SOL) in der beruflichen Bildung und untersucht dessen Umsetzung in der Lernsituation „Rechtsformen der Unternehmen“ im Bildungsgang Informationstechnische Assistentinnen/Assistenten FHR.
- Die Arbeit analysiert die didaktischen Grundlagen und methodischen Ansätze des SOL.
- Sie erörtert die Rolle der Lernplattform Moodle in der Förderung von SOL.
- Die Arbeit präsentiert einen konkreten Unterrichtsentwurf, der den Einsatz von Moodle zur Umsetzung von SOL in der Praxis verdeutlicht.
- Sie untersucht, wie Moodle die einzelnen Merkmale des SOL unterstützen kann.
- Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Handlungskompetenz im Kontext der beruflichen Bildung und zeigt auf, wie SOL zur Entwicklung dieser Kompetenz beitragen kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung ein und beschreibt die Ziele der Arbeit. Sie beleuchtet die Relevanz des selbstgesteuerten Lernens im Kontext der sich verändernden Arbeitswelt und den damit verbundenen Anforderungen an Fachkräfte.
Der theoretische Bezugsrahmen analysiert das Konzept des selbstgesteuerten Lernens und seine didaktischen Grundlagen. Er erläutert die Bedeutung des Konstruktivismus für den Lernprozess und definiert zentrale Begriffe wie Selbstgesteuertes Lernen/Selbst organisiertes Lernen, Moodle, Sandwich-Prinzip und Advanced Organizer.
Der praktische Teil widmet sich der konkreten Umsetzung von SOL im Unterricht. Er beschreibt die Unterrichtsreihe und Kompetenzen, die in der Lernsituation „Rechtsformen der Unternehmen“ vermittelt werden sollen. Die didaktische Analyse beleuchtet die Lernausgangslage der Schüler und beschreibt den SOL-basierten Unterrichtsentwurf mit Moodle.
Der Abschnitt über den SOL-basierten Unterrichtsentwurf mit Moodle beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der methodischen und didaktischen Vorgehensweise. Hier wird der Einsatz von Moodle zur Veröffentlichung der Lernsituation, zur Einteilung der Klasse in Stammgruppen und zur Bereitstellung von Arbeitsmaterialien erläutert. Zudem werden die einzelnen Phasen der Unterrichtssequenz dargestellt, die von der Wissensvermittlung in der Stammgruppe über Übungen und Feedback bis hin zur Besprechung der Lösungen und Metakognition reichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: selbstgesteuertes Lernen, Selbst organisiertes Lernen, Handlungskompetenz, Konstruktivismus, Moodle, Lernplattform, Unterrichtsentwurf, Rechtsformen der Unternehmen, Bildungsgang Informationstechnische Assistentinnen/Assistenten FHR, didaktische Analyse, Lernkultur, E-Learning.
Häufig gestellte Fragen
Was ist selbstgesteuertes Lernen (SOL)?
SOL bezeichnet Lernformen, bei denen die Lernenden die wesentlichen Entscheidungen über ihren Lernprozess (Ziele, Methoden, Zeitplanung) selbst treffen und Verantwortung für ihren Lernerfolg übernehmen.
Wie unterstützt Moodle das selbstgesteuerte Lernen?
Moodle dient als zentrale Plattform für die Bereitstellung von Lernmaterialien, die Organisation von Arbeitsgruppen, das Führen von Lerntagebüchern und die Bereitstellung von Feedback.
Was versteht man unter dem Sandwich-Prinzip?
Das Sandwich-Prinzip beschreibt einen Wechsel zwischen kollektiven Lernphasen (Wissensvermittlung durch den Lehrer) und individuellen oder kooperativen Selbstlernphasen der Schüler.
Welche Rolle spielt die Metakognition beim SOL?
Metakognition bedeutet das Nachdenken über den eigenen Lernprozess. Sie ist essenziell für SOL, damit Schüler ihre Strategien bewerten und für zukünftige Aufgaben optimieren können.
Was ist ein Advanced Organizer?
Ein Advanced Organizer ist eine vorangestellte Lernhilfe, die den Schülern einen Überblick über die neue Thematik gibt und es ihnen ermöglicht, neues Wissen in vorhandene Strukturen einzuordnen.
- Citation du texte
- Stephan Hennig (Auteur), 2010, Konzept zum selbstgesteuerten Lernen im Bildungsgang "Informationstechnische Assistenten FHR" durch den Einsatz der Lernplattform Moodle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167543