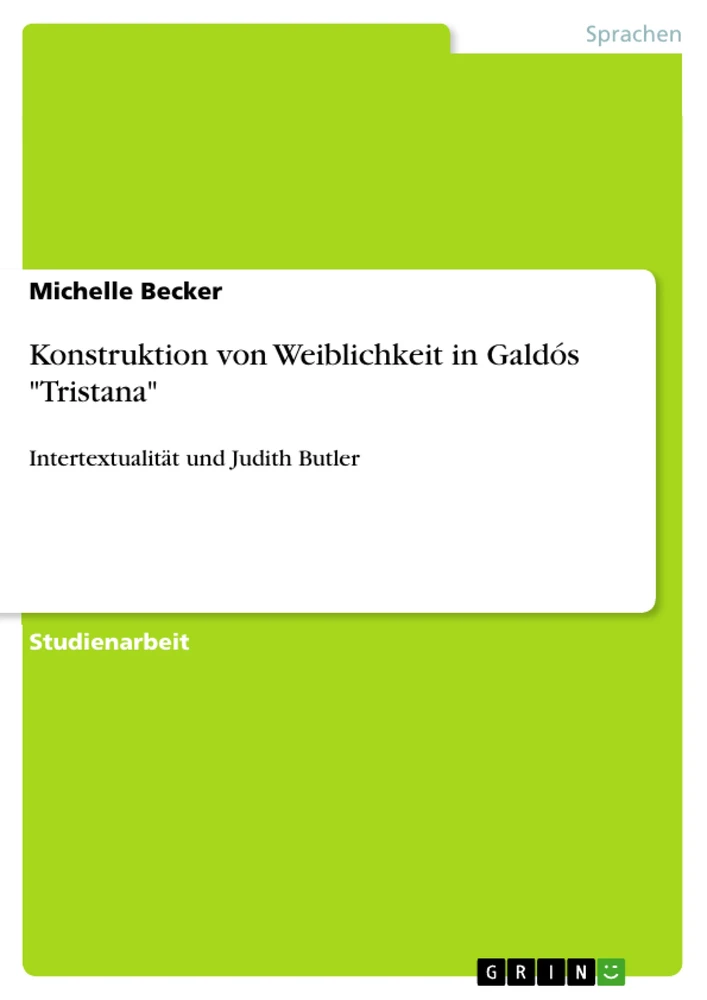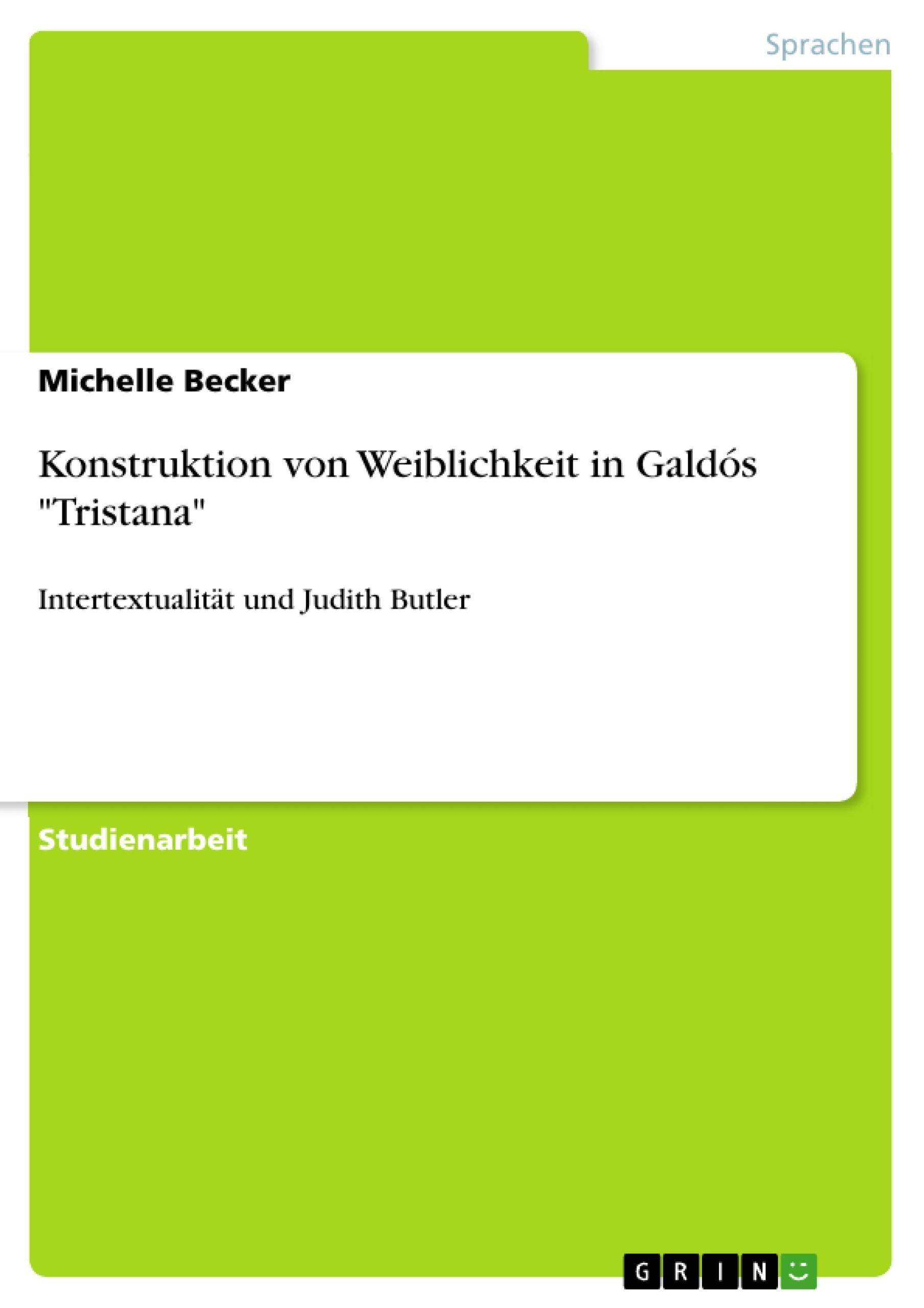Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Überblick über die theoretischen und methodischen Grundzüge der feministischen Literaturwissenschaft und Gender Studies
2 Analyse der narrativen Struktur des Romans unter gender-orientierten Gesichtspunkten
2.1 Stimme
2.2 Blick auf Weiblichkeit (Fokalisierung)
2.3 Körperkonzepte
2.4 Plotstruktur und Handlungsermächtigung (agency)
2.5 Raumanalyse
3 Intertextualität
4 Schluss
5 Bibliographie
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick über die theoretischen und methodischen Grundzüge der feministischen Literaturwissenschaft und Gender Studies
- Analyse der narrativen Struktur des Romans unter gender-orientierten Gesichtspunkten
- Stimme
- Blick auf Weiblichkeit (Fokalisierung)
- Körperkonzepte
- Plotstruktur und Handlungsermächtigung (agency)
- Raumanalyse
- Intertextualität
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Benito Pérez Galdós' Roman "Tristana" (1892) unter gender-orientierten Gesichtspunkten. Sie untersucht, wie die narrative Struktur des Romans die Geschlechterrollen und -verhältnisse darstellt und welche Rolle die intertextuellen Verweise im Werk spielen.
- Die Konstruktion von Weiblichkeit in "Tristana"
- Die Rolle der Stimme und Fokalisierung in der Erzählstruktur
- Die Bedeutung von Raum und Plot für die Geschlechterkonstruktion
- Die Funktion intertextueller Bezüge in der Darstellung von Weiblichkeit
- Die Frage, ob Galdós einen feministischen Roman im klassischen Sinne geschaffen hat
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Roman "Tristana" und seine Hauptfigur vor. Sie beleuchtet die Kontroverse um die Frage, ob Galdós mit seiner Darstellung von Tristana einen feministischen Roman geschaffen hat.
- Überblick über die theoretischen und methodischen Grundzüge der feministischen Literaturwissenschaft und Gender Studies: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Entwicklung und die wichtigsten Ansätze der feministischen Literaturwissenschaft und der Gender Studies. Er behandelt Themen wie die Gesellschaftskritik, die Analyse von Texten im Hinblick auf die Kategorie Geschlecht und die Untersuchung von Produktions- und Rezeptionsprozessen im Kontext patriarchalischer Geschlechterverhältnisse.
- Analyse der narrativen Struktur des Romans unter gender-orientierten Gesichtspunkten: Dieser Abschnitt untersucht die Stimme und Fokalisierung in "Tristana" und analysiert, wie diese Elemente die Geschlechterkonstruktion im Roman beeinflussen. Es werden auch die Raumkonstrukte und Plotstrukturen auf ihre Bedeutung für den textuellen Geschlechtsdiskurs befragt.
- Intertextualität: Dieser Abschnitt analysiert die intertextuellen Verweise im Roman und ihre Bedeutung für die Konstruktion von Weiblichkeit in "Tristana".
Schlüsselwörter
Feministische Literaturwissenschaft, Gender Studies, "Tristana", Benito Pérez Galdós, Geschlechterrollen, Weiblichkeit, Stimme, Fokalisierung, Raumanalyse, Plotstruktur, Intertextualität, Judith Butler, Travestie.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von Galdós' "Tristana"?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von Weiblichkeit und Geschlechterrollen in Benito Pérez Galdós' Roman aus dem Jahr 1892 unter Anwendung der Gender Studies.
Ist "Tristana" ein feministischer Roman?
Die Arbeit beleuchtet die literaturwissenschaftliche Kontroverse darüber, ob Galdós mit der Figur der Tristana ein emanzipatorisches Werk geschaffen hat oder patriarchale Strukturen reproduziert.
Welche narrativen Elemente werden untersucht?
Analysiert werden die Erzählstimme, die Fokalisierung (Blick auf Weiblichkeit), Körperkonzepte, Plotstrukturen und die Handlungsermächtigung (Agency) der Protagonistin.
Welche Rolle spielt die Raumanalyse in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie räumliche Konstrukte im Roman zur Darstellung und Zuweisung von Geschlechterrollen beitragen.
Was bedeutet Intertextualität in diesem Kontext?
Es wird geprüft, auf welche anderen literarischen oder kulturellen Texte Galdós Bezug nimmt und wie diese Verweise die Wahrnehmung von Weiblichkeit im Werk beeinflussen.
- Citar trabajo
- Michelle Becker (Autor), 2010, Konstruktion von Weiblichkeit in Galdós "Tristana", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167619