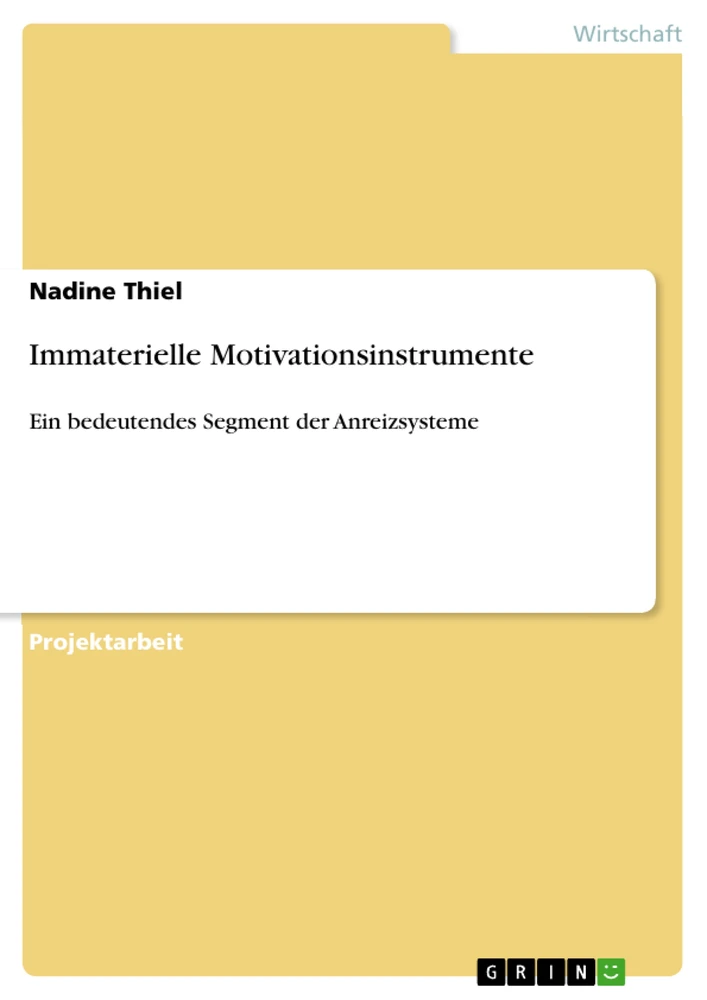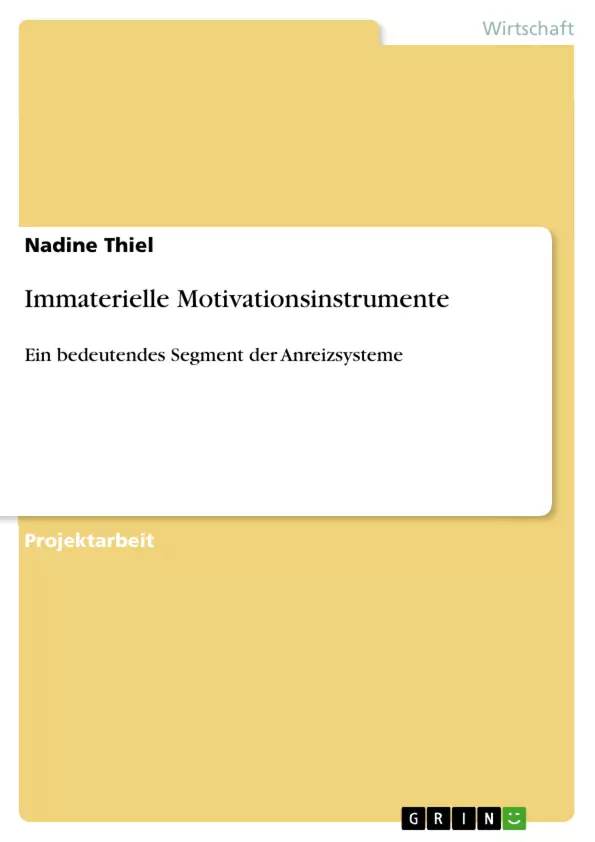Die zentrale Frage dieser Projektarbeit ist, inwieweit und in welcher Form be-stimmte Anreize die Zufriedenheit und Motivation von Mitarbeitern beeinflussen können und in welchem Maße diese eingesetzt werden sollen. Dabei werden materielle und immaterielle Motivationsinstrumente differenziert behandelt. Der Fokus liegt dabei auf den immateriellen Instrumenten, da sie sehr individuell eingesetzt werden können, mehrdimensional sind und oft unterschätzt werden.
In der Vergangenheit wurden die positiven Auswirkungen von Mitarbeitermoti-vation lange Zeit vernachlässigt. Nur langsam, aber kontinuierlich, ist diese Thematik seit den 1960er Jahren zu einem immer bedeutsameren Element der Unternehmensführung in Deutschland gereift. In dieser Phase des Umdenkens sind zahlreiche Management-Theorien, die sich mit Motivation und Arbeitszu-friedenheit befassen, entstanden.
Im Verlauf dieser Arbeit wird Aufschluss darüber gegeben, ob und in welchem Zusammenhang die in den 1950er bis 1970er Jahren entstandenen Motivati-onstheorien noch heute Anwendung und Bestätigung finden und wie sich die Ansprüche der Arbeitnehmer im Laufe der letzten Jahre verändert haben.
Zufriedenstellende Arbeitsentgelte spielten früher wie heute beim Erreichen einer bestmöglichen Mitarbeiterzufriedenheit mit Hilfe von immateriellen Motiva-tionsinstrumenten eine entscheidende Rolle, dennoch lassen sich qualifizierte und motivierte Mitarbeiter nicht käuflich erwerben, man muss sie gewinnen und immer wieder durch neue Anreize motivieren bzw. motiviert halten. Welche Maßnahmen und Instrumente dabei erfolgreich sein können, soll im Verlauf dieser Arbeit näher beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Motivation und Motiv
- 2.2 Anreizarten
- 2.2.1 Intrinsischer Anreiz
- 2.2.2 Extrinsischer Anreiz
- 2.2.2.1 Materielle Motivationsinstrumente
- 2.2.2.2 Immaterielle Motivationsinstrumente
- 3. Motivationstheorien
- 3.1 Bedürfnispyramide von A. Maslow
- 3.2 Zwei-Faktoren-Theorie von F. Herzberg
- 3.3 Zieltheorie von Locke
- 3.4 Motivationsmodell von Porter/ Lawler
- 4. Immaterielle Motivationsinstrumente
- 4.1 Führungsstil
- 4.2 Information und Kommunikation
- 4.3 Mitarbeitergespräch
- 4.4 Delegation und Verantwortung
- 4.5 Personalentwicklung und Aufstiegschancen
- 4.6 Arbeitsinhalt
- 4.7 Teambildung und Gruppenarbeit
- 4.8 Arbeitszeitgestaltung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit der Frage, wie Anreize die Zufriedenheit und Motivation von Mitarbeitern beeinflussen können. Dabei stehen materielle und immaterielle Motivationsinstrumente im Mittelpunkt, wobei der Fokus auf den immateriellen Instrumenten liegt. Ziel ist es, die Bedeutung immaterieller Motivationsinstrumente zu verdeutlichen und aufzuzeigen, wie sie individuell eingesetzt werden können.
- Definition und Abgrenzung von Motivation und Motiv
- Unterscheidung zwischen materiellen und immateriellen Anreizen
- Analyse und Anwendung von Motivationstheorien
- Detaillierte Beschreibung von immateriellen Motivationsinstrumenten
- Relevanz von immateriellen Anreizen für die Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den strukturellen Aufbau und die zentrale Themenstellung der Arbeit vor. Im zweiten Kapitel werden wichtige Grundlagen, wie Motivation und Motiv sowie Anreizarten, definiert und erläutert. Kapitel drei beschäftigt sich mit verschiedenen Motivationstheorien und deren Bedeutung für die Praxis. In Kapitel vier werden die am häufigsten eingesetzten immateriellen Motivationsinstrumente im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Mitarbeitermotivation, Anreizsysteme, immaterielle Motivationsinstrumente, Motivationstheorien, Führungsstil, Kommunikation, Delegation, Personalentwicklung und Arbeitszeitgestaltung. Sie untersucht die Bedeutung dieser Themen für die Arbeitszufriedenheit und die Leistungserbringung von Mitarbeitern in Unternehmen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind immaterielle Motivationsinstrumente?
Das sind nicht-monetäre Anreize wie Führungsstil, Lob, Verantwortung, flexible Arbeitszeiten oder Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung.
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation?
Intrinsische Motivation kommt aus der Aufgabe selbst (Spaß, Sinn), extrinsische Motivation wird durch äußere Anreize (Geld, Lob, Strafvermeidung) erzeugt.
Welche Rolle spielt die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg?
Herzberg unterscheidet zwischen Hygienefaktoren (verhindern Unzufriedenheit, z.B. Gehalt) und Motivatoren (erzeugen echte Zufriedenheit, z.B. Anerkennung).
Kann man motivierte Mitarbeiter "kaufen"?
Die Arbeit argumentiert, dass Gehalt zwar wichtig ist, aber qualifizierte Mitarbeiter langfristig nur durch immaterielle Anreize gewonnen und motiviert gehalten werden können.
Warum ist Delegation ein Motivationsinstrument?
Durch das Übertragen von Verantwortung fühlen sich Mitarbeiter wertgeschätzt und kompetent, was ihr Engagement und ihre Zufriedenheit steigert.
- Arbeit zitieren
- Nadine Thiel (Autor:in), 2011, Immaterielle Motivationsinstrumente, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167937