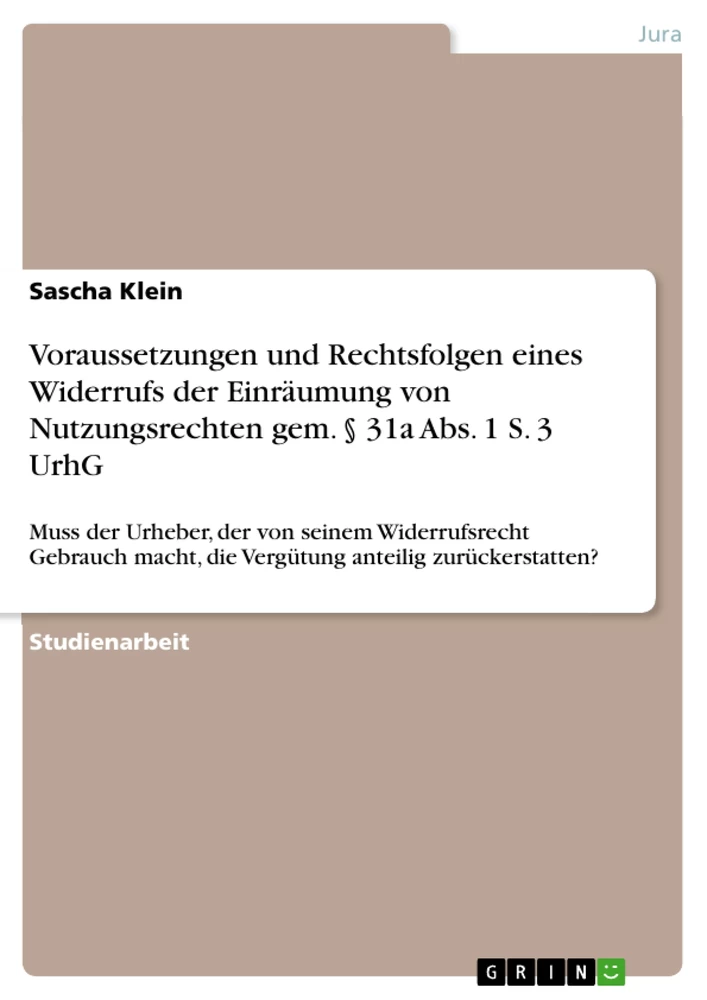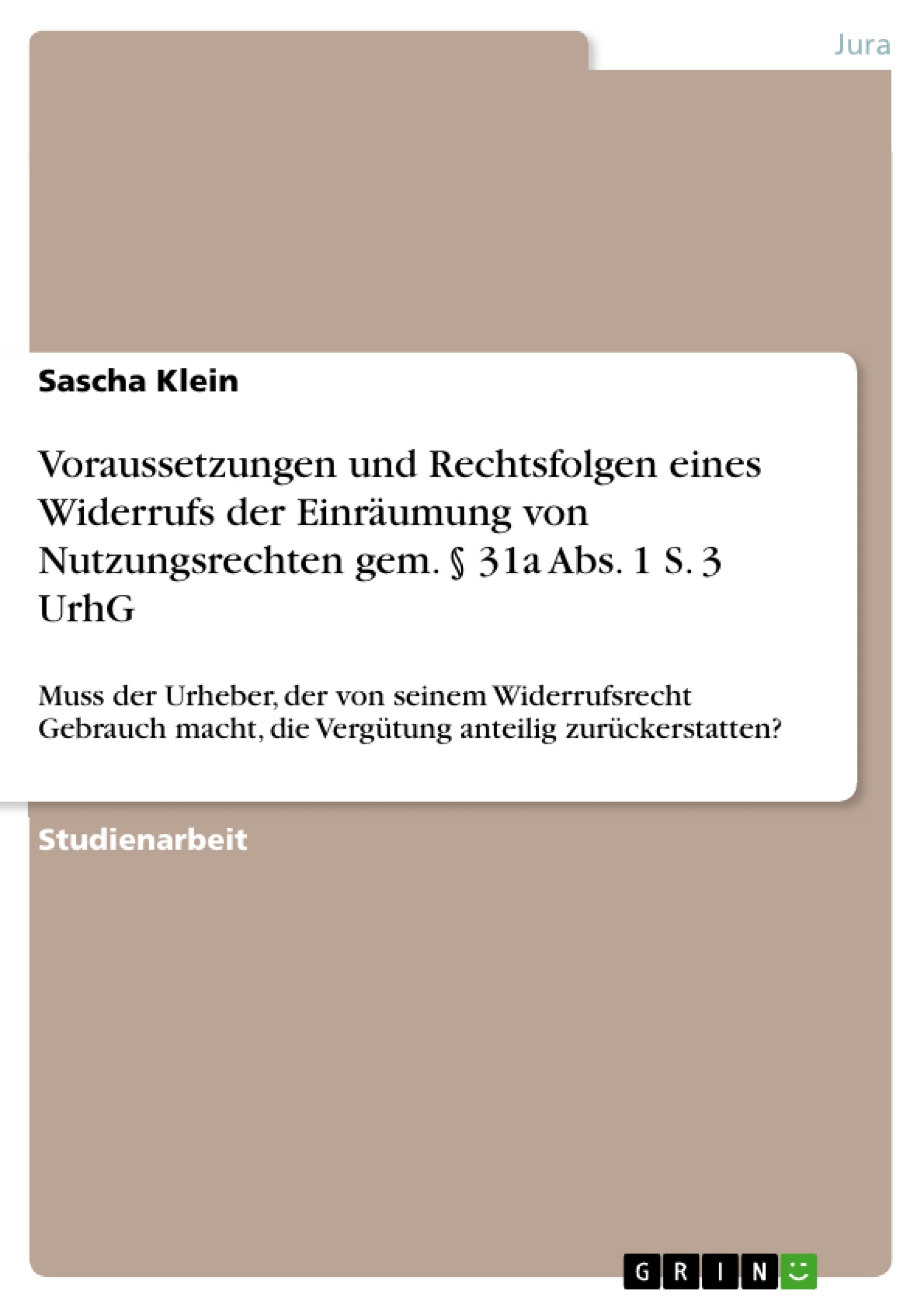Inhalte sollen in neue Medien überführt werden, damit sie ihren zeitlosen Geist in neuen Gewändern verbreiten. Sie stellen aber auch einen wirtschaftlich relevanten Markt dar. Existiert eine neue Nutzungsart zu jener Rechte eingeräumt sind, so ist sie wirtschaftlich verwertbar und ein geldwertes Gut. Mit dem „Ersten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“ wurden die zwingenden Vorgaben der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft umgesetzt. Der „Zweite Korb“ erfolgte hingegen ohne zwingende Vorgaben der Gemeinschaft als weitere Anpassung des Urheberrechts an die Bedürfnisse der Informationsgesellschaft. Im Mittelpunkt stand hierbei der zunehmende Einsatz digitaler Technik. Die fakultativen Schrankenbestimmungen insbes. der Privatkopie, die Anpassung des pauschalen Vergütungssys-tems und die Lockerung des Verbotes der Verfügung unbekannter Nutzungsarten, die für diese Arbeit von großer Bedeutung sind, bildeten die Eckpfeiler des „Zweiten Korbes“. In Bezug darauf wurde die Verfügung unbekannter Nutzungsarten gem. § 31 IV UrhG a.F. aufgehoben und an seine Stelle die § 31a, sowie §§ 32c, 137l eingeführt. § 31a I S. 3 beinhaltet hierbei ein Widerrufsrecht des Urhebers, welches bestimmten Voraussetzungen und Rechtsfolgen unterliegt und die Frage der Rückerstattung der Vergütung bei Einlegen des selbigen aufkommen lässt. Der Rechteerwerb an unbekannten Nutzungsarten ist möglich und zeigt, dass dadurch unser kulturelles Leben belebt wird und gleichzeitig auf Seiten der Verwerter profitable Einnahmen hervor gebracht werden können. Doch fürchtet man durch das Widerrufsrecht um das, was man besitzt: Die Rechte an unbekannten Nutzungsarten für die man den Urheber vergütet hat. Die vorliegende Arbeit erläutert ausgehend von den strukturellen Veränderungen die das Urheberrecht erfahren hat, die Anforderungen an einen Vertragsschluss über Rechte an neuen Nutzungsarten. Es schließen sich Ausführungen über die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Widerrufsrechts an. Die Frage der Rückerstattung der Vergütung, ist hierbei eng mit der Rechtsnatur des Widerrufs und seiner Wirkung verknüpft. Insbesondere werden Probleme einer etwaigen Rückerstattung im Falle eines Widerrufs erörtert. Mögliche Lösungsansätze struktureller Art werden des Weiteren zur Diskussion gestellt. Schlussendlich bildet eine Erweiterung des § 31a UrhG ein mögliches Korrektiv.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- A Einleitung
- B Der neue § 31a UrhG im Zuge der Umsetzung des „Zweiten Korbs“
- I. Zweck, Rechtsfolge und Anwendungsbereich, § 31 IV UrhG a.F.
- II. § 31a UrhG und sein Normzweck
- III. Vertragliche Einräumung der Rechte an unbekannten Nutzungsarten, § 31a UrhG
- 1.) Gesetzliche Anforderungen an einen Vertragsschluss nach § 31a I UrhG
- a.) Gegenstand: unbekannte Nutzungsart – Abgrenzungsversuch
- b.) Anforderungen an die Bestimmtheit
- c.) Beschränkungen
- d.) Zweckübertragungslehre
- 2.) Das Schriftformerfordernis des § 31a UrhG
- a.) Schriftformerfordernis gem. § 31a I S. 2 UrhG
- b.) Keine Schriftform bei Open Source / Open Content Lizenzen
- C Das Widerrufsrecht des § 31a I S. 3 UrhG
- I. Schutzzweck des Widerrufs
- II. Die Rechtsnatur des Widerrufs
- III. Diskussion über die Einführung einer „Schamfrist“
- 1.) Der Gesetzeswortlaut des § 31a I S.4 UrhG
- 2.) Kritische Stellungnahme Verweyens
- 3.) Stellungnahme
- IV. Der unbegründete Widerruf
- 1.) zusätzliche Voraussetzung: „berechtigtes Interesse“
- 2.) Regulierung über allgemeine Rechtsgrundsätze
- 3.) Stellungnahme
- V. Die Ausübung des Widerrufs und seine Voraussetzungen
- 1.) Widerrufsberechtigter
- 2.) Gegenstand und Umfang des Widerrufs
- 3.) Adressat des Widerrufs
- a.) bei Weiterübertragung gem. § 34 UrhG
- b.) bei Weitereinräumung gem. § 35 UrhG
- VI Ausschluss bzw. Beschränkung des Widerrufsrechts
- 1.) Die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung, § 31a I S.4 UrhG
- 2.) Einigung über Vergütung, § 31a II S. 1 UrhG
- 3.) Tod des Urheber, § 31a II S. 2 UrhG
- 4.) Beschränktes Widerrufsrecht, § 31a III UrhG
- D Der Widerruf gem. § 31a UrhG und seine Rechtsfolgen
- I Rückfall der Rechte als Folge des bedingten Rechtserwerbs
- 1.) Ansicht Schulze
- 2.) Ansicht Kotthoff
- 3.) Stellungnahme
- II Der Bestand des übrigen Vertrags
- III Auswirkungen des Widerrufs: Pflicht zur Rückerstattung der gezahlten Vergütung?
- 1.) Auslegung des § 31a I S. 3 UrhG
- a.) Der Wortlaut der Regelung des § 31a I S. 3 UrhG
- b.) Die Historik der Regelung des § 31a I S. 3 UrhG
- c.) Die Systematik der Regelung des § 31a I S. 3 UrhG
- d.) Teleologische Auslegung des § 31a I S.3 UrhG
- aa.) Wertung des § 40 UrhG
- bb.) Wertung des Art. 14 GG
- cc.) Zwischenergebnis der teleologischen Auslegung
- e.) Das Ergebnis der Auslegung
- IV Lösungsansätze zu einer Rückabwicklung Vergütung
- 1. Rückabwicklung nach den Regeln des allgemeinen Privatrechts
- a.) Allgemeines
- b.) § 812 ff. BGB versus §§ 346 ff. BGB
- 2. Möglichkeiten vertraglicher Gestaltung und ihre Grenzen
- 3. Stellungnahme
- V Sonstige Ansprüche auf Rückzahlung
- E Schlussbetrachtung
- I. Zusammenfassung
- II. Übertragung der Vorschriften von Rechten an unbekannten Nutzungsarten in Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika auf den deutschen Rechtsraum
- III Ausblick - Lösungsvorschlag: Korrektur des Gesetzgebers
- Einführung und Bedeutung des neuen § 31a UrhG
- Analyse der Voraussetzungen für die Einräumung von Nutzungsrechten an unbekannten Nutzungsarten
- Untersuchung des Widerrufsrechts des Urhebers nach § 31a I S. 3 UrhG, einschließlich seiner Voraussetzungen und Rechtsfolgen
- Diskussion der Pflicht zur Rückerstattung der Vergütung im Falle eines Widerrufs
- Bewertung der Rechtslage und Entwicklung von Lösungsvorschlägen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit den Voraussetzungen und Rechtsfolgen eines Widerrufs der Einräumung von Nutzungsrechten gemäß § 31a Abs. 1 S. 3 UrhG. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Urheber, der von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, die Vergütung anteilig zurück erstatten muss.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Studienarbeit ein und erläutert die Fragestellung. Anschließend wird der neue § 31a UrhG im Kontext der Umsetzung des „Zweiten Korbs“ des Urheberrechts dargestellt. Hierbei werden der Zweck, die Rechtsfolge und der Anwendungsbereich des § 31a UrhG sowie die Anforderungen an einen Vertragsschluss über unbekannte Nutzungsarten beleuchtet. Kapitel C befasst sich mit dem Widerrufsrecht des § 31a I S. 3 UrhG. Der Schutzzweck des Widerrufs, seine Rechtsnatur sowie die Diskussion über die Einführung einer „Schamfrist“ stehen im Fokus. Kapitel D widmet sich den Rechtsfolgen des Widerrufs. Insbesondere die Frage nach der Pflicht zur Rückerstattung der Vergütung wird umfassend behandelt. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, betrachtet die Übertragung der Vorschriften auf andere Rechtsräume und bietet einen Ausblick auf mögliche Lösungsansätze.
Schlüsselwörter (Keywords)
Urheberrecht, § 31a UrhG, Widerrufsrecht, Nutzungsrechte, unbekannte Nutzungsarten, Vergütung, Rückabwicklung, Rechtsfolgen, Teleologische Auslegung, Vertragsgestaltung, Rechtsraum.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt § 31a UrhG im Urheberrecht?
Dieser Paragraph regelt die vertragliche Einräumung von Nutzungsrechten für noch unbekannte Nutzungsarten und sieht unter bestimmten Bedingungen ein Widerrufsrecht für den Urheber vor.
Wann kann ein Urheber die Einräumung von Nutzungsrechten widerrufen?
Gemäß § 31a I S. 3 UrhG ist ein Widerruf möglich, wenn eine neue Nutzungsart bekannt wird, für die Rechte eingeräumt wurden, sofern der Urheber ein berechtigtes Interesse daran hat.
Muss die Vergütung bei einem Widerruf zurückgezahlt werden?
Dies ist eine zentrale Rechtsfrage. Die Arbeit untersucht, ob und inwieweit eine Rückerstattung der bereits gezahlten Vergütung nach den Regeln des allgemeinen Privatrechts (z.B. Bereicherungsrecht) erfolgen muss.
Gibt es ein Schriftformerfordernis für diese Verträge?
Ja, die Einräumung von Rechten an unbekannten Nutzungsarten bedarf gemäß § 31a I S. 2 UrhG der Schriftform, wobei es Ausnahmen für Open-Source-Lizenzen geben kann.
Was passiert mit dem restlichen Vertrag nach einem Widerruf?
In der Regel bleibt der übrige Vertrag über die bereits bekannten Nutzungsarten wirksam, sofern nicht anzunehmen ist, dass er ohne den widerrufenen Teil nicht geschlossen worden wäre.
- Citation du texte
- stud. iur. Sascha Klein (Auteur), 2009, Voraussetzungen und Rechtsfolgen eines Widerrufs der Einräumung von Nutzungsrechten gem. § 31a Abs. 1 S. 3 UrhG , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167958