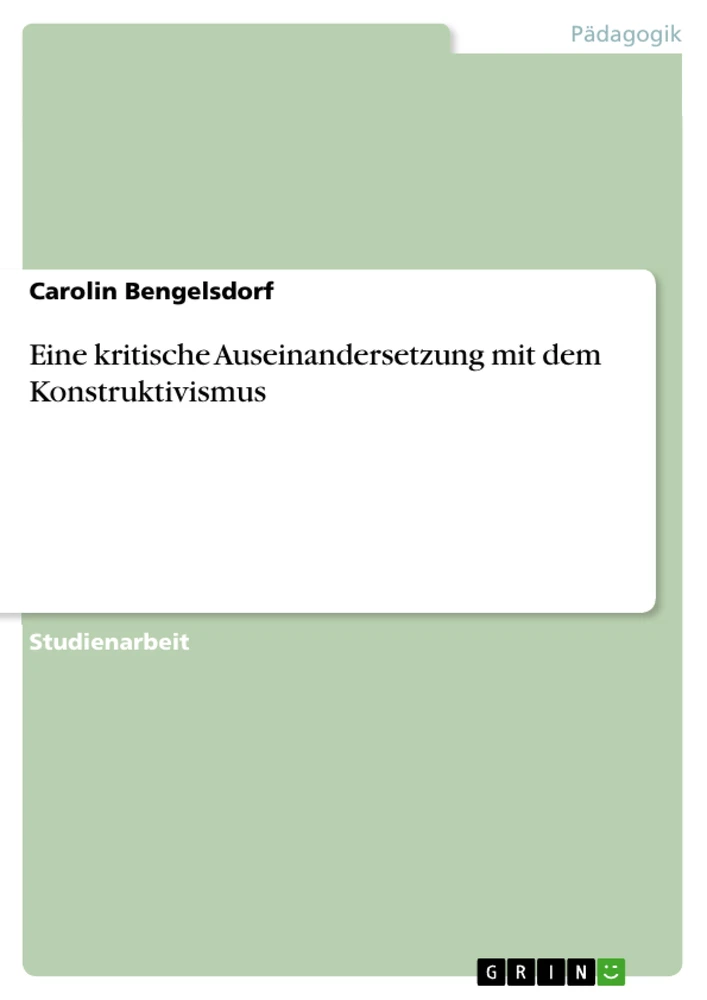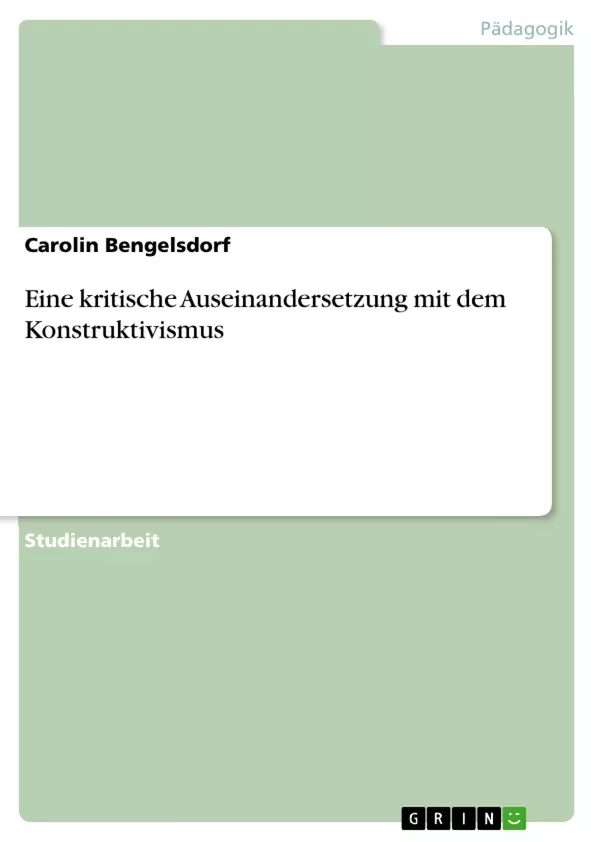Im Rahmen des Studiums einer Geisteswissenschaft, wie beispielsweise der Bildungs- und Erziehungswissenschaft, kommt man nicht umher, sich mit metatheoretischen Problemstellungen und Herangehensweisen auseinanderzusetzten. Auch in dem Bereich der Geisteswissenschaften - wie in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen
Disziplinen - macht ein ‚Zauberwort‘ von sich reden: „Konstruktivismus“.1 Der Begriff
des Konstruktivismus hat sich in den vergangenen Jahren als die allgemein übliche
Bezeichnung für eine Reihe von sozial- und humanwissenschaftlichen Theoriebildungen
durchgesetzt. Mit einem näheren Blick enthüllen sich diese Theoriebildungen als recht
verschiedenartig, sie erstrecken sich über ein weit gefächertes Spektrum
unterschiedlichster Standpunkte. Dieses Spektrum reicht von verhältnismäßig moderaten
bis hin zu äußerst radikalen und kontroversen Positionen.2 Jedoch stoßen der
Konstruktivismus und insbesondere der Radikale Konstruktivismus in
wissenschaftstheoretischen Abhandlungen auch auf (starke) Kritik, da sich bei näherer
Betrachtungsweise doch zum Teil beachtliche Probleme und Schwächen des
Konstruktivismuskonzeptes darstellen. Unger (2005) schreibt sogar: „Der
Konstruktivismus treibt seltsame Blüten.“9 Aus diesem Grund beschäftige ich mich in der vorliegenden
Hausarbeit mit den kritischen Aspekten des Konstruktivismus. Daher stellt sich für mich
die Frage, inwieweit der Konstruktivismus in seinen Argumenten Schwächen und
Probleme aufzeigt und wie stark diese an dem Grundkonzept des Konstruktivismus zerren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in den Konstruktivismus
- Theoretische Wurzeln
- Allgemeine Merkmale des Konstruktivismus
- Die Bezeichnung des Radikalen Konstruktivismus
- Die Kritik an den Konstruktivismus
- Die erkenntnistheoretischen Kernaussagen und ihre realistische Voraussetzungen
- Rechtfertigungsprobleme der radikal-konstruktivistischen Erkenntnistheorie
- Probleme des Radikalen Konstruktivismus als empirische Theorie
- Fazit zur Kritik am Konstruktivismus
- Die Kritik an der radikal-konstruktivistischen Pädagogik
- konstruktivistische Pädagogik
- Kritik an der radikal-konstruktivistischen Pädagogik
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich kritisch mit dem Konstruktivismus und seinen Implikationen für die Erziehungswissenschaft. Die zentrale Fragestellung untersucht, ob und inwiefern der Konstruktivismus in seinen Argumenten Schwächen und Probleme aufzeigt, die das Grundkonzept des Konstruktivismus in Frage stellen könnten.
- Theoretische Grundlagen und Kernaussagen des Konstruktivismus
- Kritik an der erkenntnistheoretischen Basis des Konstruktivismus
- Probleme des Konstruktivismus als empirische Theorie
- Diskussion der konstruktivistischen Pädagogik und deren Kritikpunkte
- Zusammenfassende Bewertung des Konstruktivismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Konstruktivismus ein und skizziert dessen Bedeutung für die Erziehungswissenschaft. Das zweite Kapitel bietet eine Einführung in die grundlegenden Merkmale und theoretischen Wurzeln des Konstruktivismus. Das dritte Kapitel analysiert kritisch die erkenntnistheoretischen Kernaussagen des Konstruktivismus und beleuchtet die damit verbundenen Probleme und Einschränkungen. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Kritik an der radikal-konstruktivistischen Pädagogik, die sich auf die Anwendung des Konstruktivismus im pädagogischen Kontext bezieht. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Punkte zusammen und präsentiert eine persönliche Bewertung der aufgeworfenen Fragen.
Schlüsselwörter
Konstruktivismus, Erkenntnistheorie, Radikaler Konstruktivismus, Kritik, Pädagogik, Wissenschaftstheorie, Erziehungswissenschaft, Wirklichkeit, Lernen, Konstruktion, Realismus.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird der Konstruktivismus in dieser Arbeit kritisch betrachtet?
Die Arbeit untersucht Schwächen und Probleme des Konzepts, da insbesondere der Radikale Konstruktivismus auf beachtliche wissenschaftstheoretische Kritik stößt.
Was sind die theoretischen Wurzeln des Konstruktivismus?
Das Dokument beleuchtet die erkenntnistheoretischen Grundlagen und allgemeinen Merkmale, die den verschiedenen Strömungen des Konstruktivismus zugrunde liegen.
Welche Probleme ergeben sich für die Pädagogik?
Die Arbeit analysiert die radikal-konstruktivistische Pädagogik und hinterfragt deren praktische Anwendbarkeit und theoretische Rechtfertigung im Erziehungskontext.
Gibt es einen Unterschied zwischen moderatem und radikalem Konstruktivismus?
Ja, das Spektrum reicht von moderaten Ansätzen bis hin zu kontroversen, radikalen Positionen, die die Existenz einer objektiven Realität stark hinterfragen.
Was ist das Fazit zur Kritik am Konstruktivismus?
Die Arbeit bewertet, wie stark die aufgezeigten Argumentationsschwächen am Grundkonzept des Konstruktivismus zerren und ob dieses als empirische Theorie haltbar ist.
- Quote paper
- Carolin Bengelsdorf (Author), 2010, Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konstruktivismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168005