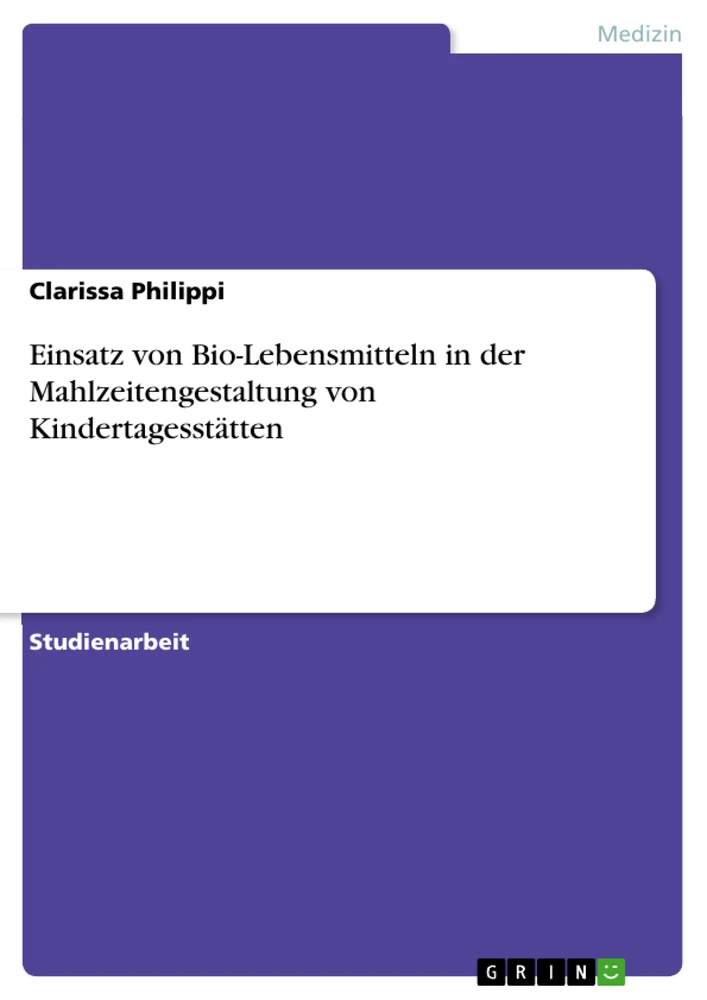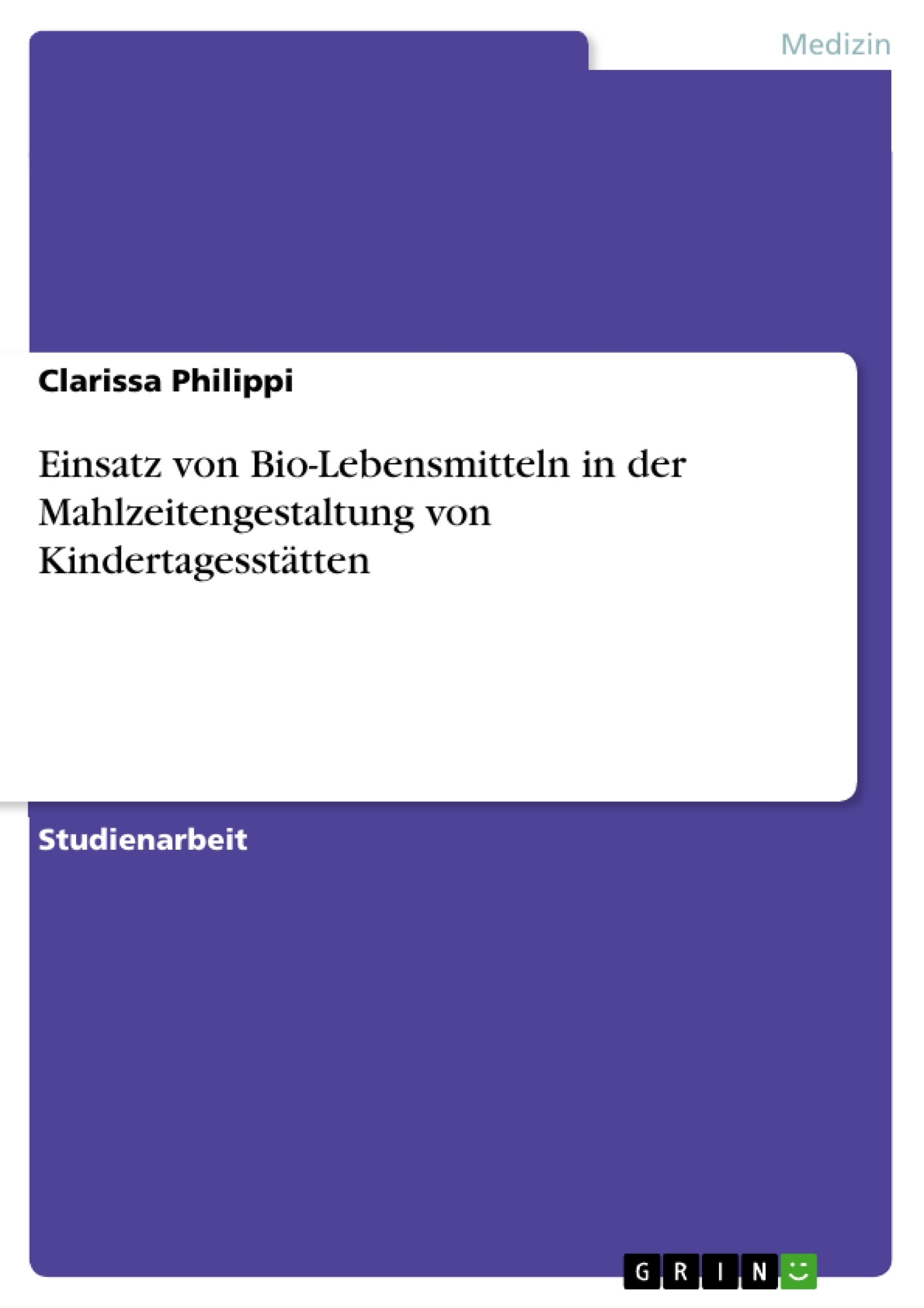Da immer mehr Mütter halb- oder ganztags arbeiten gehen, soll in Zukunft jedem Kind ein Platz in einer Kindertagesstätte (Kita) zustehen. Viele dieser Kinder werden in der Kita mit einer warmen Mittagsmahlzeit und Zwischenmahlzeiten versorgt. Daher spielt die Kita eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Ernährungsgewohnheiten und kann dies als Chance nutzen, Grundbausteine für eine gesunde und nachhaltige Ernährungsweise zu legen.
Da Kinder sich in einer körperlichen und geistigen Wachstumsphase befinden, ist eine optimale Versorgung mit Nährstoffen wichtig und es sollten ihnen vollwertige Lebensmittel zur Verfügung stehen. Doch auch das Wissen über Lebensmittel, zum Beispiel (z.B.) das Kennenlernen von Produktionsketten verschiedener Lebensmittel und was es bedeutet nachhaltige Lebensmittel zu konsumieren, sollte mehr gefördert werden. Viele Eltern wünschen sich zwar eine gesunde Ernährung für ihre Kinder, doch oft scheitert die Umsetzung einer Speiseplanumstellung auf Bio-Produkte an den befürchteten Mehrkosten (vgl. BLE und aid 2006, S. 5).
Das Thema Bio-Lebensmittel wirft viele Fragen auf:
- Machen Bio-Lebensmittel in Kitas Sinn?
- Welche Vor- und Nachteile haben Bio-Lebensmittel?
- Wie kann man sie im Speiseplan integrieren oder wie können Mehrkosten vermindert werden?
In der folgenden Hausarbeit sollen diese Fragen beantwortet werden. Im zweiten Kapitel wird die Kita in die Außer-Haus-Verpflegung eingeordnet. Anschließend (Kapitel 3) wird der biologische Landbau beschrieben, sowie seine Richtlinien und Ziele erläutert. Ferner werden Möglichkeiten zum Einsatz der Bio-Lebensmittel vorgestellt. Anschließend werden in Kapitel 4 wirtschaftliche Aspekte in Bezug auf die Mehrlosten in der Kita analysiert. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Fazit gegeben.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, Unterschiede zwischen ökologischem und konventionellem Landbau zu verdeutlichen und Möglichkeiten aufzuzeigen, trotz leichter Mehrkosten, Bio-Lebensmittel in der Versorgung von Kindertagesstätten zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kindertagesstätte als Form der Gemeinschaftsverpflegung
- Biologische Lebensmittel in der Kindertagesstätte
- Produktion von biologischen Lebensmitteln
- EG-Öko-Verordnung
- Richtlinien der Bio-Anbauverbände
- Vor- und Nachteile von biologischen Lebensmitteln
- Einsatzmöglichkeiten von Bio-Lebensmitteln in der Kindertagesstätte
- Wirtschaftliche Betrachtung des Einsatzes von biologischen Lebensmitteln in der Kindertagesstätte
- Preisbetrachtung biologischer Lebensmittel
- Kostenträger des Mehraufwands
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Einsatz von Bio-Lebensmitteln in Kindertagesstätten (Kitas). Sie untersucht die Unterschiede zwischen ökologischem und konventionellem Landbau und beleuchtet die Möglichkeiten, trotz potentieller Mehrkosten, Bio-Produkte in der Kita-Verpflegung zu integrieren.
- Die Bedeutung von Kitas in der Entwicklung von Ernährungsgewohnheiten
- Die Produktion und Richtlinien von Bio-Lebensmitteln
- Vor- und Nachteile von Bio-Lebensmitteln in der Kita-Verpflegung
- Wirtschaftliche Aspekte des Einsatzes von Bio-Lebensmitteln in Kitas
- Möglichkeiten zur Integration von Bio-Produkten in den Kita-Speiseplan
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung stellt die Relevanz von gesunder Ernährung in Kitas heraus und beleuchtet den Wunsch nach Bio-Produkten sowie die damit verbundenen Herausforderungen, wie z.B. die Befürchtung von Mehrkosten.
Kapitel 2: Kindertagesstätte als Form der Gemeinschaftsverpflegung: Dieses Kapitel ordnet Kitas in das Konzept der Gemeinschaftsverpflegung (GV) ein und betont ihre Rolle bei der Entwicklung von Essgewohnheiten.
Kapitel 3: Biologische Lebensmittel in der Kindertagesstätte: Hier werden die Produktion von Bio-Lebensmitteln, die EG-Öko-Verordnung, die Richtlinien von Bio-Anbauverbänden sowie Vor- und Nachteile des Bio-Anbaus im Detail erläutert. Außerdem werden Einsatzmöglichkeiten von Bio-Lebensmitteln in der Kita vorgestellt.
Kapitel 4: Wirtschaftliche Betrachtung des Einsatzes von biologischen Lebensmitteln in der Kindertagesstätte: Dieses Kapitel analysiert die Preisentwicklung von Bio-Lebensmitteln und betrachtet die Kostenträger, die mit dem Einsatz von Bio-Produkten in Kitas verbunden sind.
Schlüsselwörter
Biologische Lebensmittel, Kindertagesstätte, Gemeinschaftsverpflegung, Ökologischer Landbau, EG-Öko-Verordnung, Bio-Anbauverbände, Preisentwicklung, Mehrkosten, Kita-Speiseplan, nachhaltige Ernährung
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Einsatz von Bio-Lebensmitteln in Kitas sinnvoll?
Kitas prägen maßgeblich die Ernährungsgewohnheiten von Kindern. Bio-Lebensmittel bieten eine schadstoffarme, nährstoffreiche Versorgung und vermitteln Werte für eine nachhaltige Lebensweise.
Welche Richtlinien gelten für biologische Lebensmittel?
Bio-Produkte unterliegen der EG-Öko-Verordnung und oft noch strengeren Richtlinien privater Bio-Anbauverbände, die hohe Standards für Produktion und Nachhaltigkeit setzen.
Wie lassen sich die Mehrkosten für Bio-Produkte in der Kita reduzieren?
Durch eine geschickte Speiseplanumstellung, den verstärkten Einsatz saisonaler und regionaler Produkte sowie die Analyse wirtschaftlicher Kostenträger können Mehrkosten minimiert werden.
Was sind die Vorteile von ökologischem gegenüber konventionellem Landbau?
Der ökologische Landbau schont natürliche Ressourcen, verzichtet auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und fördert die Biodiversität sowie das Tierwohl.
Welche Rolle spielen Kitas bei der Entwicklung von Essgewohnheiten?
Da immer mehr Kinder in Kitas vollverpflegt werden, fungieren diese Einrichtungen als wichtige Lernorte für den Geschmackssinn und das Wissen über Lebensmittelproduktionsketten.
Können Bio-Lebensmittel schrittweise integriert werden?
Ja, die Hausarbeit zeigt verschiedene Einsatzmöglichkeiten auf, wie beispielsweise die Umstellung einzelner Komponenten oder Mahlzeiten auf Bio-Qualität, um den finanziellen Aufwand zu steuern.
- Quote paper
- Clarissa Philippi (Author), 2011, Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der Mahlzeitengestaltung von Kindertagesstätten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168263