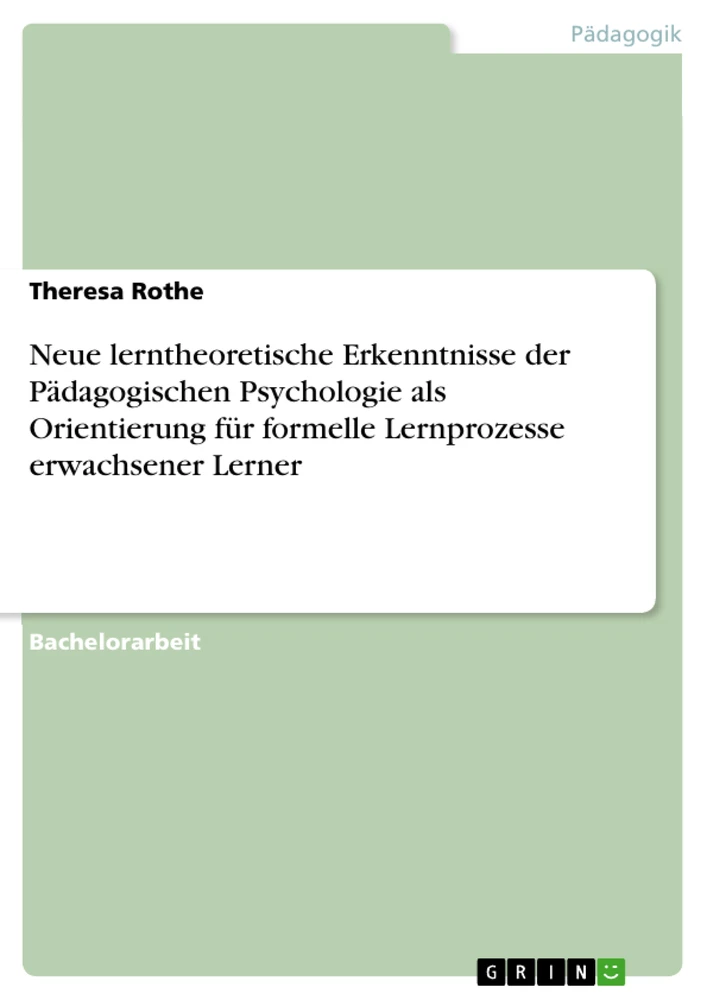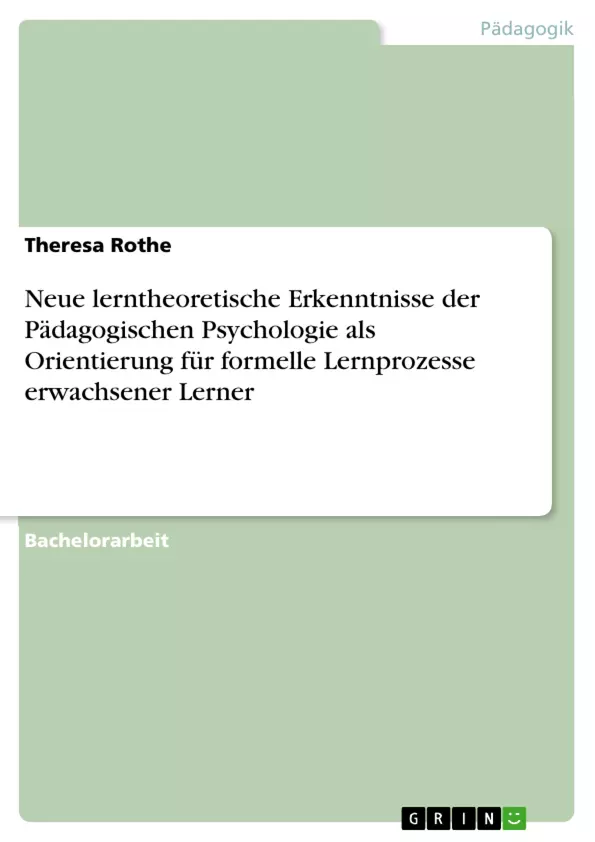Diese Arbeit gibt einen Überblick darüber, welche Erkenntnisse der Lernforschung und Lerntheorien für die Praxis von Veranstaltungen mit erwachsenen Lernenden nützliche Orientierungen liefern können. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der derzeitigen Struktur und Organisation der Erwachsenenbildung. Den abgeleiteten Handlungsorientierungen kann kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit für das Gelingen von Veranstaltungen in der Erwachsenenbildung zugesprochen werden. Dazu sind die äußeren und inneren Strukturen und Bedingungen zu heterogen.
Handlungsorientierungen werden daher tendenziell als reflexive Kategorien für die Gestaltung von Lernprozessen benannt und stellen somit ein Angebot für Erwachsenenbildner dar, ihre Veranstaltungen an die Erkenntnisse angelehnt zu gestalten und durchzuführen.
Den Kern dieser Arbeit stellt die Verbindung von Erkenntnissen der klassischen Lerntheorien mit neurobiologischen Grundlagen des Lehren und Lernens dar.
Inhaltsverzeichnis
-
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise und Methode
- Abgrenzung von Begriffen
- Pädagogische Psychologie
- Erwachsenenbildung
- LERNTHEORETISCHE ERKENNTNISSE DER PÄDAGOGISCHEN PSYCHOLOGIE ALS ORIENTIERUNGSBASIS
- Was ist Lernen?
- Befunde der Lernforschung – ausgewählte Erkenntnisse relevanter Lerntheorien
- Behaviorismus
- Kognitivismus
- Konstruktivismus
- Neurophysiologische Befunde des Lernens
- Zwischenfazit
- ORGANISATION, Felder und Merkmale von ERWACHSENENBILDUNG
- Geschichte und Organisation der Erwachsenenbildung
- Felder der Erwachsenenbildung
- Merkmale von Erwachsenenbildung: Die Bedingungen des Lernens Erwachsener auf neurophysiologischer Grundlage
- Zwischenfazit
- ORIENTIERUNG: ABLEITUNG VON EMPFEHLUNGEN AUS DEN LERNTHEORIEN FÜR DIE PRAXIS
- Ableitungen von Empfehlungen aus den behavioristischen, kognitivistischen und konstruktivistischen lerntheoretischen Erkenntnissen
- Ableitungen von Empfehlungen aus den neurophysiologischen Erkenntnissen des Lernens
- ZUSAMMENFASSUNG / FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erkenntnisse der Lernforschung und Lerntheorien, um Handlungsorientierungen für die Gestaltung von Bildungsveranstaltungen für Erwachsene abzuleiten. Dabei werden die aktuellen Strukturen und Organisationsformen der Erwachsenenbildung berücksichtigt. Die Arbeit beleuchtet die klassischen Lerntheorien (Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus) sowie neurophysiologische Grundlagen des Lernens und zeigt deren Relevanz für die Praxis der Erwachsenenbildung auf.
- Relevanz der Lernforschung für die Praxis der Erwachsenenbildung
- Klassische Lerntheorien und ihre Implikationen für die Gestaltung von Lernprozessen
- Neurobiologische Grundlagen des Lernens und deren Bedeutung für die Erwachsenenbildung
- Entwicklung von Handlungsorientierungen für die Praxis der Erwachsenenbildung
- Bedeutung der Erwachsenenbildung in einer sich wandelnden Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
-
Grundlegung der Arbeit
Dieses Kapitel stellt die Problemstellung der Arbeit dar, die in der steigenden Nachfrage nach Bildungsveranstaltungen für Erwachsene begründet liegt. Die gesellschaftlichen Veränderungen und die damit einhergehende Unsicherheit der Lebensumstände werden als Gründe für die Bedeutung der Erwachsenenbildung beleuchtet. Darüber hinaus wird die Zielsetzung der Arbeit erläutert und die Methode der Arbeit beschrieben. Abschließend werden die Begriffe „Pädagogische Psychologie“ und „Erwachsenenbildung“ abgegrenzt.
-
LERNTHEORETISCHE ERKENNTNISSE DER PÄDAGOGISCHEN PSYCHOLOGIE ALS ORIENTIERUNGSBASIS
Dieses Kapitel definiert den Begriff des Lernens und präsentiert ausgewählte Erkenntnisse relevanter Lerntheorien, darunter der Behaviorismus, der Kognitivismus und der Konstruktivismus. Es werden zudem neurophysiologische Befunde des Lernens beleuchtet, die die Bedeutung des Gehirns für den Lernprozess verdeutlichen. Das Kapitel schließt mit einem Zwischenfazit, das die Bedeutung der Lerntheorien für die Praxis der Erwachsenenbildung unterstreicht.
-
ORGANISATION, Felder und Merkmale von ERWACHSENENBILDUNG
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte und Organisation der Erwachsenenbildung. Es werden verschiedene Felder der Erwachsenenbildung vorgestellt und die Bedingungen des Lernens von Erwachsenen aus neurophysiologischer Sicht betrachtet. Das Kapitel endet mit einem Zwischenfazit, das die Bedeutung der Erwachsenenbildung in Bezug auf die Herausforderungen des modernen Lebens hervorhebt.
-
ORIENTIERUNG: ABLEITUNG VON EMPFEHLUNGEN AUS DEN LERNTHEORIEN FÜR DIE PRAXIS
Dieses Kapitel leitet aus den Erkenntnissen der Lerntheorien (Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus) sowie den neurophysiologischen Befunden des Lernens Handlungsempfehlungen für die Praxis der Erwachsenenbildung ab. Es wird gezeigt, wie die Erkenntnisse der Lernforschung für die Gestaltung von effektiven Lernveranstaltungen genutzt werden können.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Arbeit umfassen: Lerntheorie, Pädagogische Psychologie, Erwachsenenbildung, Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus, Neurophysiologie des Lernens, Handlungsorientierungen, Gestaltung von Lernprozessen, gesellschaftliche Entwicklungen, Bildung für Erwachsene.
Häufig gestellte Fragen
Welche Lerntheorien sind für die Erwachsenenbildung relevant?
Die Arbeit beleuchtet den Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus als Orientierungsbasis für formelle Lernprozesse.
Welchen Beitrag leistet die Neurobiologie zum Lernen?
Neurophysiologische Befunde erklären die biologischen Bedingungen des Lernens im Gehirn und bieten Handlungsempfehlungen für Lehrende.
Warum ist Erwachsenenbildung heute so wichtig?
Gesellschaftliche Veränderungen und unsichere Lebensumstände erfordern lebenslanges Lernen, um mit den neuen Herausforderungen Schritt zu halten.
Gibt es allgemeingültige Regeln für das Gelingen von Bildungsveranstaltungen?
Nein, die Arbeit benennt reflexive Kategorien und Handlungsempfehlungen, da die äußeren Bedingungen in der Erwachsenenbildung zu heterogen sind.
Was ist das Ziel der Pädagogischen Psychologie in diesem Kontext?
Sie liefert wissenschaftliche Erkenntnisse über Lernvorgänge, die als Orientierung für die Gestaltung effektiver Lernprozesse dienen.
- Quote paper
- Theresa Rothe (Author), 2010, Neue lerntheoretische Erkenntnisse der Pädagogischen Psychologie als Orientierung für formelle Lernprozesse erwachsener Lerner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168651