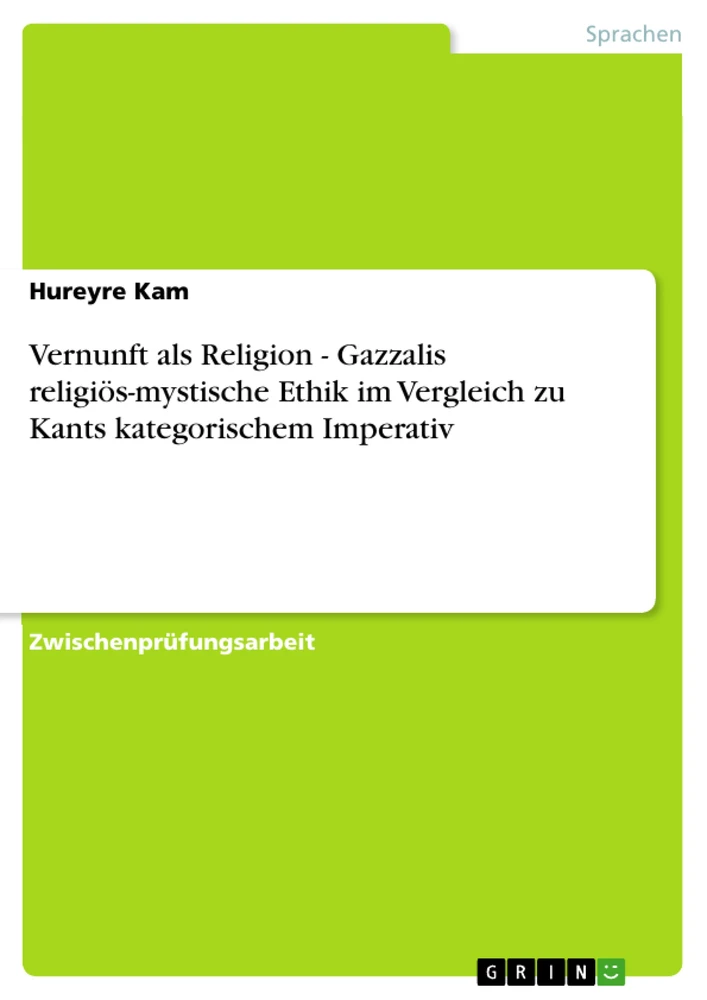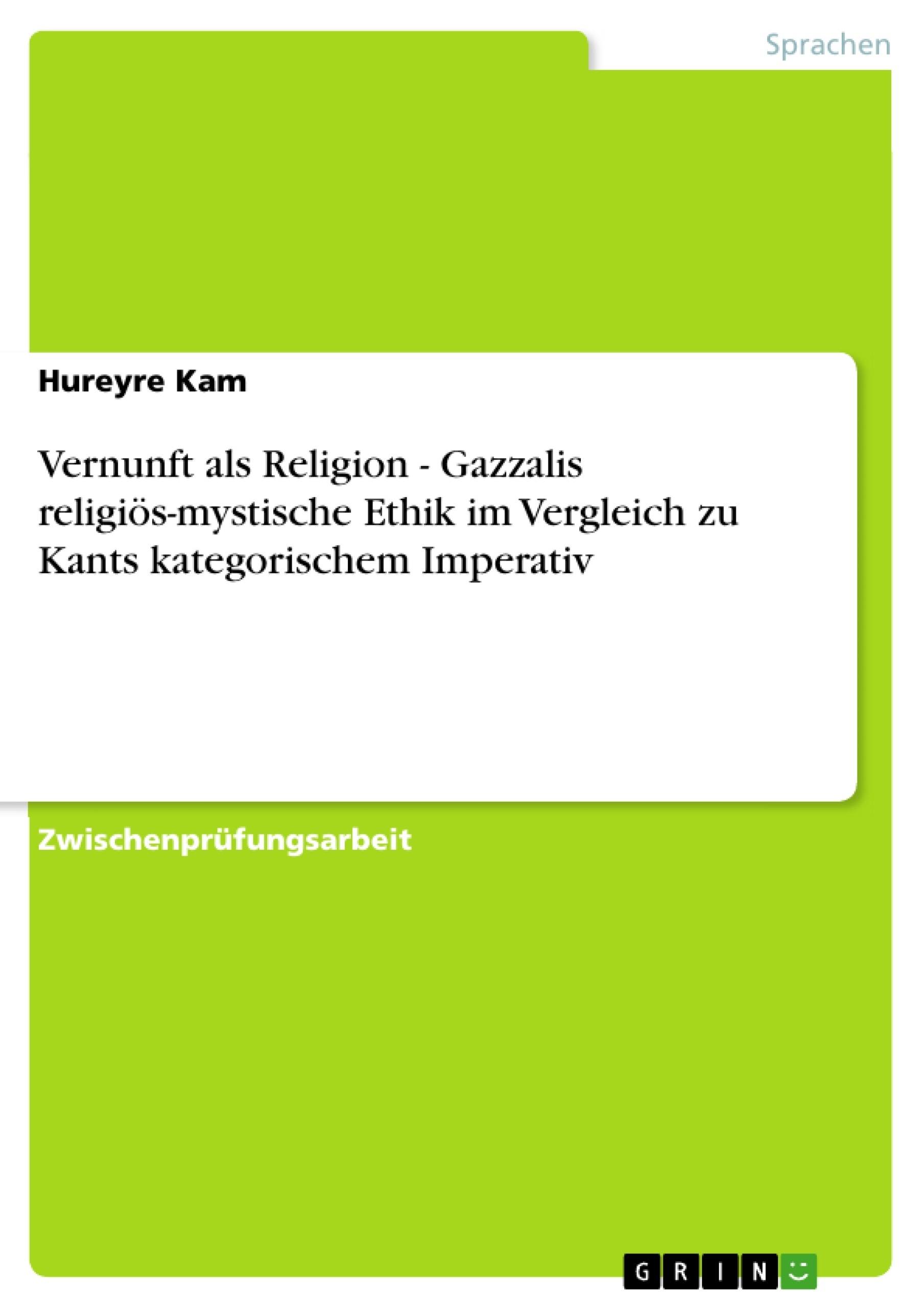Diese Arbeit wird sich mit den Ethiken befassen, die von Immanuel Kant einerseits und Ġazzālī andererseits formuliert wurden. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht die beiden Moralsysteme zuerst zu erläutern, in ihren jeweiligen Entwicklungskontext zu stellen, um sie hiernach auf Ähnlichkeiten und Unterschiede zu überprüfen. Es darf nicht vergessen werden, dass die beiden Denker in zwei völlig verschiedenen Zeitperioden und Kulturbereichen gelebt haben. Das macht den Vergleich zwar sehr schwierig und problematisch aber in gleicher Weise auch spannend und interessant.
Mein Hauptaugenmerk wird auf Ġazzālī und seinem System der Ethik liegen, welches dem Leser näher gebracht werden soll. Der kategorische Imperativ Kants soll als Kontrast dienen, um vielleicht das spezifische in Ġazzālīs Denken besser erkennen zu können. Es birgt zwar auch die Gefahr in sich, dass man einen primären Zweck verfehlt: nämlich den Zugang zum ursprünglichen Charakter Ġazzālīs und seines Denkens, da man es losgelöst von seinem nativen Umfeld mit einem Denksystem vergleicht, welches nur bedingt vergleichbare Paradigmen als Grundlage des Denkens und Fühlens hat. Dieses ist aber dennoch eine sehr hilfreiche und nützliche Methode, da es erst durch eine Kontrastierung möglich ist die Intensität des zu besprechenden Charakters nachvollziehen zu können. Es ist ja bekannt, dass, wenn man allzu lange auf ein und dieselbe Farbe blickt, sie auf Dauer ihre Intensität im Auge des Betrachters verliert.
Da es aber wichtig ist den Denker zu kennen, um sein Denken richtig nachvollziehen zu können, werde ich zuerst die Lebensläufe beider Philosophen skizzieren, um sie hiernach in ihren philosophiegeschichtlichen Kontext zu stellen.
Eine wichtige Gemeinsamkeit der beiden Denker liegt darin, dass sie die spekulative Metaphysik verwerfen und der Ethik eine größere Rolle beimessen. Da beide die althergebrachte dogmatische Metaphysik auf das äußerste angreifen und auf den Trümmern dieser Metaphysik ihre Ethik aufbauen, ist es angebracht im Vorfeld näher auf diese Kritik einzugehen. Bevor also Ġazzālīs Standpunkt erläutert werden kann, wird auf den Neuplatonismus und ihren muslimischen Vertretern eingegangen. Im Falle Kants wird erst seine „Kritik der reinen Vernunft“ zu besprechen sein, da es ohne sie nicht möglich ist seine „Kritik der praktischen Vernunft“ zu begreifen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine kurze Einführung
- Leben und Werk al-Ġazzālīs
- Das 12. Jahrhundert im vorderen Orient. Das Umfeld Ġazzālīs.
- Immanuel Kant. Eine kurze Biographie
- Kant und seine Zeit
- Leben und Werk al-Ġazzālīs
- Ġazzālīs Kritik der Metaphysik
- „‛Ilm al-yaqîn“ – Die Suche nach dem absoluten Wissen
- Ta®āfut al-Falāsifa – Die Widerlegung der Philosophen
- Darstellung der Emanationslehre und des Kausalitätsprinzips
- Widerlegung der Emanationslehre
- Kausalität in der Natur
- Kausalität in Moral
- Ġazzālīs Ethikkonzept
- Offenbarung als einzige Quelle universaler Ethiknormen
- Das Herz als die über allem menschlichen Vermögen waltende Kraft
- Die drei Grundzustände der menschlichen Seele
- Die vier Tugenden der Seele und die Glückseligkeit
- Vernunft als Religion
- Kants „Kritik der reinen Vernunft“
- Eine Revolution der Denkart
- Die Grenzen der Vernunft
- Der Mittelweg zwischen Skeptizismus und Dogmatismus
- Die Kritik der praktischen Vernunft
- Der kategorische Imperativ
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Ethiken von Immanuel Kant und Ġazzālī. Sie erläutert die beiden Moralsysteme, setzt sie in ihren jeweiligen Entwicklungskontext und untersucht Ähnlichkeiten und Unterschiede. Der Fokus liegt auf Ġazzālīs Ethik, wobei Kants kategorischer Imperativ als Kontrast dient, um die Besonderheiten in Ġazzālīs Denken aufzuzeigen.
- Vergleich der Ethiken von Kant und Ġazzālī
- Analyse von Ġazzālīs Kritik der Metaphysik
- Erörterung von Ġazzālīs Ethikkonzept
- Untersuchung der Grenzen der Vernunft bei Kant und Ġazzālī
- Die Rolle von Offenbarung und Vernunft in der Ethik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung des Vergleichs der Ethiken von Kant und Ġazzālī. Kapitel II bietet eine kurze Einführung in das Leben und Werk der beiden Denker und stellt sie in ihren historischen Kontext.
In Kapitel III wird Ġazzālīs Kritik der Metaphysik im Detail dargestellt. Insbesondere wird seine Widerlegung der Emanationslehre und des Kausalitätsprinzips erläutert. Ġazzālīs Argumente zeigen, dass für ihn die Offenbarung die einzige Quelle sicheren Wissens ist.
Kapitel IV beschäftigt sich mit Ġazzālīs Ethikkonzept. Es werden die Grundlagen seines Systems, die Rolle des Herzens und die drei Grundzustände der Seele erläutert. Ġazzālīs Ethik zielt darauf ab, die Seele zu läutern und die Vereinigung mit Gott zu erlangen. Die Vernunft spielt dabei eine besondere Rolle als innere Šari’a, die sich der Offenbarung unterordnet.
Kapitel V skizziert Kants „Kritik der reinen Vernunft“ und beschreibt seine Analyse der Grenzen der Vernunft. Kant zeigt auf, dass die menschliche Vernunft zwar die Fähigkeit besitzt, allgemeine Gesetze zu formulieren, jedoch nicht das Ding an sich erfassen kann.
Kapitel VI befasst sich mit Kants „Kritik der praktischen Vernunft“. Es wird der kategorische Imperativ als Grundlage seines Moralsystems vorgestellt. Kant postuliert, dass die Vernunft zur Bestimmung des Willens autonom sein kann und dass die Befolgung des Sittengesetzes die Grundlage für die Freiheit des Willens ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen: islamische Philosophie, Metaphysik, Ethik, Ġazzālī, Kant, Offenbarung, Vernunft, Herz, Seele, kategorischer Imperativ, Emanationslehre, Kausalität, Tugend, Glückseligkeit.
- Citar trabajo
- M.A Hureyre Kam (Autor), 2007, Vernunft als Religion - Gazzalis religiös-mystische Ethik im Vergleich zu Kants kategorischem Imperativ, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168857