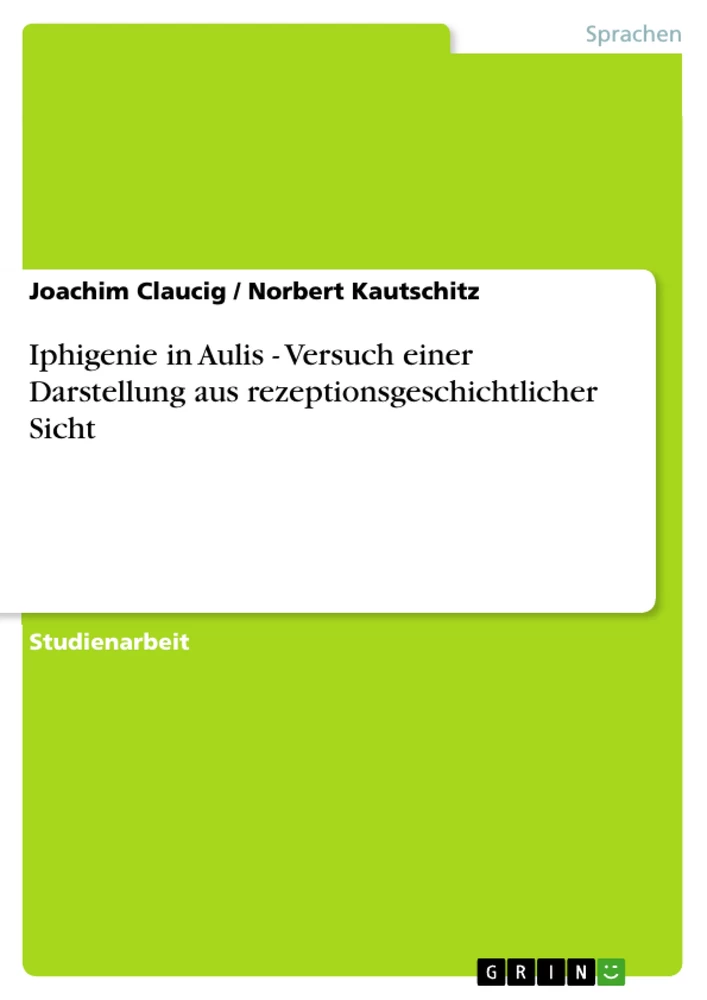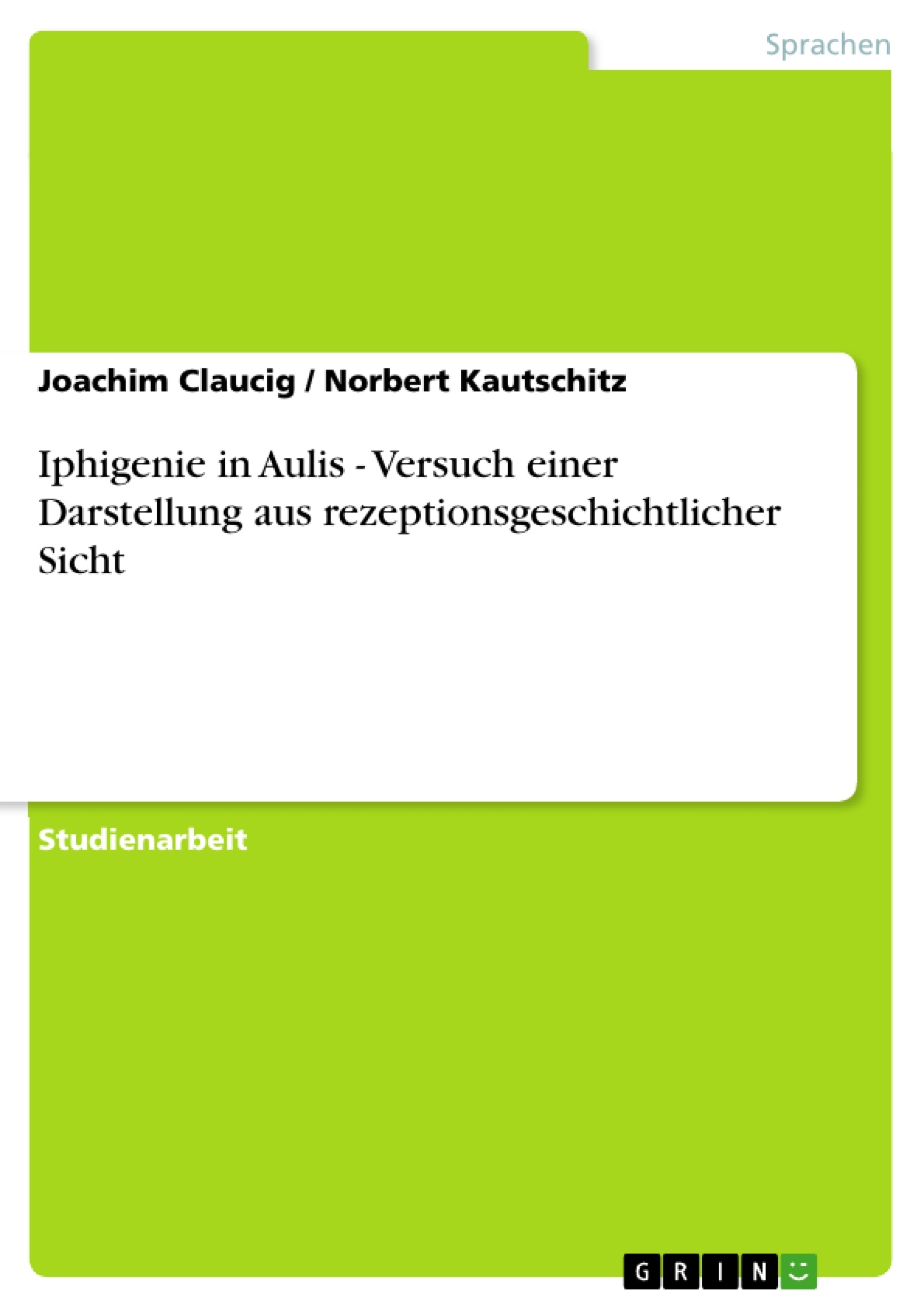Warum der ,,Versuch einer Darstellung aus rezeptionsgeschichtlicher Sicht"?
In der vorliegenden Arbeit wollen wir vor allem das Drama "Iphigénie en Aulide" von Jean Racine und seine "Librettoform" von Jean du Roullet für der Vertonung von Christoph Willibald Gluck unter die Lupe nehmen.
Wir wollen hierbei - wie es dem Untertitel dieser Arbeit zu entnehmen ist - versuchen, die Betrachtung des Dramas (und des Librettos) in eine Einführung über seine stoffliche Herkunft einzubetten, was auch mit dem Versuch in Verbindung steht, wesentliche Bemerkungen zur Rezeptionsgeschichte allgemein und zur speziellen Rezeptionsgeschichte des Stoffes der Iphigenie nicht auszulassen.
Als Ergebnis möchten wir mit dieser Zielsetzung dem Leser die Tatsache vor Augen führen und verständlich machen, dass ein Jahrhunderte alter Mythos auch heute noch aktuell sein kann und dies in der Regel auch ist, und, dass - so alt ein Mythos/ein Stoff auch sein mag - es immer wieder Menschen gab, gibt und geben wird, die sich mit alten Stoffen beschäftigen, um diese alten Stoffe auf ihre Weise in ihrer jeweiligen Epoche zu verwerten und für die jeweilige Zeit auszudeuten und zu adaptieren.
Um nun das Phänomen der Aktualität und der Aktualisierung von antiken Stoffen besser verstehen zu können, beginnen wir mit unserer Einführung in die Rezeptionsgeschichte, bevor wir uns der Iphigenie bei Racine und Gluck widmen.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- DIE REZEPTION EINES MYTHOS
- Allgemeines zu Motiven und Stoff
- Allgemeine Erläuterungen zu den Begriffen „Stoff“ und „Motiv“
- Überlegungen zu Leitmotiven und Neubehandlungen eines bestimmten Stoffes
- Der Mythos der Iphigenie in Aulis
- Mythos, Ritual und Menschenopfer - Initiation und Königsersetzung bei Iphigenie
- Kurze Inhaltsangabe der Iphigeniensage
- Über das Kernmotiv im Iphigenienstoff
- Antike Fassungen und Bearbeitungen des Stoffes
- Die Iphigenie des Euripides
- Der Iphigenienstoff als Werkvorlage
- Allgemeines zu Motiven und Stoff
- JEAN RACINE UND „IPHIGÉNIE“
- Autor und Werk
- Kurzer Lebenslauf
- Kurze Bemerkungen zu Racines Werk
- Racines \"Iphigénie en Aulide”.
- Formaler Aufbau des Dramas
- Der Inhalt von Racines Iphigenie
- Die Charaktere - Schrecken und Mitleid, Sehen und Erkennen
- Kommunikationsformen
- Über Racines Verwirklichung der Iphigenie und seine euripideische Vorlage
- Autor und Werk
- IPHIGENIE BEI GLUCK
- Bemerkungen zur Entwicklung von Drama und Libretto
- Über das geistige Umfeld des antiken griechischen Dramas und der Oper
- Renaissancehafte Wiederaufnahme, barocke Entfremdung, gluck´sche Reform
- Zur Entstehung und Uraufführung von Glucks Iphigenie
- Die textliche Vorlage im Libretto Bailli du Roullets
- Beschaffenheit und Wirkung des Mythos
- Gegenüberstellung von Racines und du Roullets „Iphigénie en Aulide“
- Glucks Vertonung des Librettos
- Musik und Sprache
- Analyse eines Ausschnitts der Oper in Bezug auf Musik und Sprache
- Bemerkungen zur Entwicklung von Drama und Libretto
- BEISPIELE DER BEHANDLUNG DES STOFFS NACH RACINE IM DEUTSCHSPRACHIGEN SPRECHTHEATER
- Friedrich Schiller, Iphigenie in Aulis, übersetzt aus dem Euripides
- Gerhart Hauptmann, Iphigenie in Aulis
- NACHWORT
- LITERATURVERZEICHNIS
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Lexika
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rezeptionsgeschichte des Mythos der Iphigenie in Aulis, insbesondere mit den Werken von Jean Racine und Christoph Willibald Gluck. Die Autoren untersuchen, wie dieser antike Mythos in verschiedenen Epochen behandelt und interpretiert wurde, und wie sich die jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Kontexte auf die Interpretation und Aktualisierung des Stoffes auswirken.
- Die Bedeutung von Motiven und Stoffen in der Literatur
- Die Rezeptionsgeschichte des Iphigenien-Mythos von der Antike bis zur Moderne
- Der Einfluss des antiken griechischen Dramas auf die Entwicklung der Oper
- Die Rolle der Musik und Sprache in Glucks Oper "Iphigenie en Aulide"
- Die Aktualität des Iphigenien-Mythos in verschiedenen kulturellen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich einer detaillierten Betrachtung des Iphigenien-Mythos und erläutert die Bedeutung der Begriffe „Stoff“ und „Motiv“ im Kontext der Literaturgeschichte. Es beleuchtet die verschiedenen Beweggründe von Dichtern, sich mit bereits vorhandenen Stoffen auseinanderzusetzen und wie diese adaptiert und neu interpretiert werden.
Kapitel 2 untersucht die Antike Fassungen und Bearbeitungen des Iphigenien-Stoffes, wobei der Fokus auf dem Werk des Euripides liegt. Es werden die literarischen Grundlagen des Stoffes und die Bedeutung des Mythos für die antike Kultur beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Drama „Iphigénie en Aulide“ von Jean Racine. Es wird die Biografie Racines, seine Werke und die Besonderheiten seines Iphigenie-Dramas analysiert.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit Glucks Oper „Iphigenie en Aulide“ und analysiert die Rolle der Musik und Sprache in der Gestaltung des Stoffes. Es wird die Entstehung und Uraufführung der Oper sowie der Einfluss des Librettos von Bailli du Roullet untersucht.
Kapitel 5 präsentiert Beispiele für die Behandlung des Stoffes nach Racine im deutschsprachigen Sprechtheater, insbesondere die Adaptionen von Friedrich Schiller und Gerhart Hauptmann.
Schlüsselwörter
Iphigenie, Aulis, Mythos, Stoff, Motiv, Rezeptionsgeschichte, Euripides, Jean Racine, Christoph Willibald Gluck, Libretto, Oper, Musik, Sprache, Sprechtheater, Friedrich Schiller, Gerhart Hauptmann, Aktualität, Kultur, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Mythos der Iphigenie in Aulis?
Der Mythos handelt von der Opferung der Iphigenie durch ihren Vater Agamemnon, um günstige Winde für die Fahrt der Griechen nach Troja zu erflehen.
Wie unterscheidet sich Racines Iphigenie von der antiken Vorlage?
Jean Racine adaptierte Euripides' Stoff für das französische Barocktheater, wobei er die Charaktere psychologisierte und neue Figuren einführte, um dem Zeitgeschmack zu entsprechen.
Welche Bedeutung hat Glucks Oper 'Iphigénie en Aulide'?
Glucks Oper markiert eine Reform, bei der Musik und Sprache enger verknüpft wurden, um die dramatische Wahrheit über rein virtuosen Gesang zu stellen.
Was ist das Kernmotiv im Iphigenienstoff?
Das zentrale Motiv ist das Menschenopfer sowie der Konflikt zwischen göttlichem Gebot, staatlicher Pflicht und familiärer Liebe.
Welche deutschen Autoren bearbeiteten den Iphigenie-Stoff?
Bekannte Bearbeitungen stammen unter anderem von Friedrich Schiller (Übersetzung aus Euripides) und Gerhart Hauptmann.
- Citation du texte
- Mag. art. Joachim Claucig (Auteur), Norbert Kautschitz (Auteur), 2001, Iphigenie in Aulis - Versuch einer Darstellung aus rezeptionsgeschichtlicher Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1693