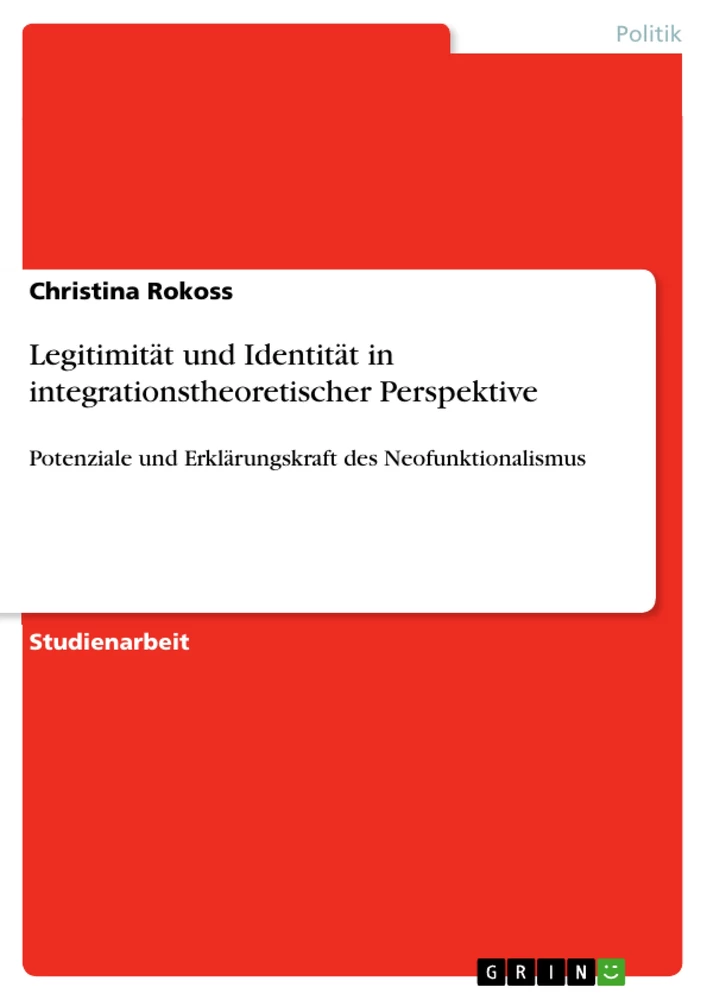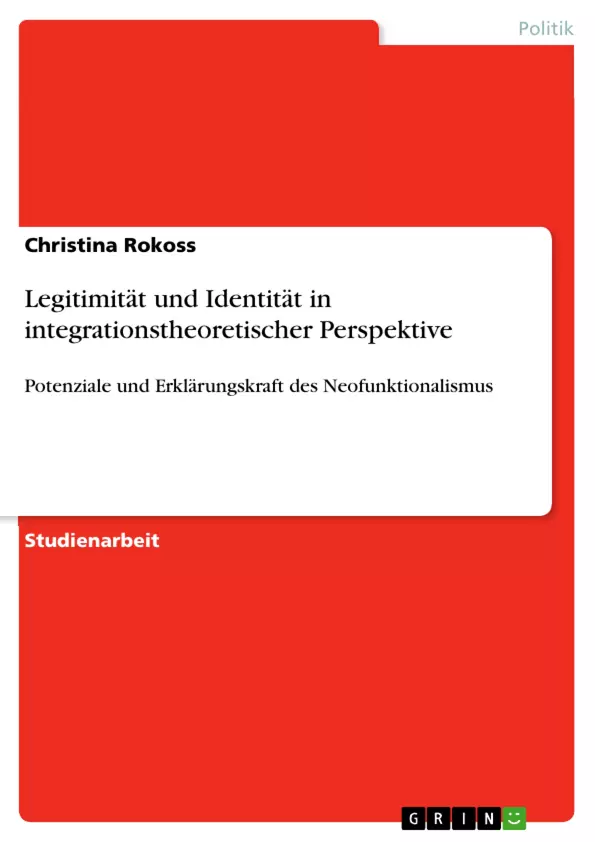Die europäische Integration ist in der wissenschaftlichen Forschung ein viel diskutiertes Thema. Besonders auch die Frage, ob die immer tiefer gehende Integration zu einem Demokratiedefizit in der EU geführt hat, wird in einem Großteil der Literatur zur Europäischen Union aufgegriffen und ist stark umstritten. Während einige Wissenschaftler der EU sehr wohl ein Defizit attes-tieren, sind andere der Ansicht, es läge kein Defizit vor . Den Kern der Dis-kussion bildet die Frage, ob die Herrschaft der EU überhaupt legitim ist, da es schließlich kein „europäisches Volk“ und damit keine europäische Identi-tät gibt, durch die sie legitimiert wäre. Dieser Frage soll auch im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen werden. Dabei geht es darum, herauszufinden, ob die Integrationstheorie des Neofunktionalismus die Entwicklung der Europäischen Union und besonders die fehlende Legitimität und Identität er-klären kann. Ist er überholt, weil er keine Erklärungen liefert, oder ist er re-levant, weil er erklären kann, wie Legitimität und Identität herausgebildet werden könnten?
Um diese Frage beantworten zu können, soll zunächst einmal ein kurzer Überblick über die integrationstheoretische Debatte geliefert werden (Kapitel 1), bevor die Integrationstheorie Neofunktionalismus näher vorgestellt wird (Kapitel 2). Dabei werden auch die beiden anderen großen Integrati-onstheorien Intergouvernementalismus (Kapitel 2.1.1) und Föderalismus (Kapitel 2.1.2) kurz dargestellt, um einen Vergleich zu haben. Ferner wer-den einige Wissenschaftler vorgestellt, die den Neofunktionalismus bereits als gescheitert erklärten (Kapitel 2.2). Im dritten Kapitel soll dann ausführlich auf die Frage nach einem Demokratiedefizit in der EU eingegangen werden (Kapitel 3.1), sowie erläutert werden, wie sich vielleicht doch eine europäische Identität herausbilden ließe (Kapitel 3.2). Anschließend soll die Frage geklärt werden, inwieweit der Neofunktionalismus Potenzial hat, die in der EU identifizierten Defizite zu erklären, bzw. Lösungsansätze zu liefern (Ka-pitel 4). In einem abschließenden Fazit werden dann noch einmal die wich-tigsten Punkte der Arbeit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die integrationstheoretische Debatte im Überblick
- Die Annahmen des Neofunktionalismus
- Die beiden anderen großen Integrationstheorien
- Intergouvernementalismus
- Föderalismus
- Neofunktionalismus – eine bereits mehrfach gescheiterte Theorie
- Legitimität und Identität als Kernthemen der europäischen Integration
- Die Diskussion um das Demokratiedefizit der EU
- Das fehlende „Wir“-Gefühl der Europäer
- Der Neofunktionalismus – relevant oder überholt?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Integrationstheorie des Neofunktionalismus die Entwicklung der Europäischen Union und insbesondere die fehlende Legitimität und Identität erklären kann. Es wird untersucht, ob der Neofunktionalismus in der Erklärung der EU-Entwicklung relevant ist oder ob er als überholt betrachtet werden muss.
- Analyse der integrationstheoretischen Debatte
- Vorstellung des Neofunktionalismus und seiner Annahmen
- Diskussion des Demokratiedefizits in der EU
- Untersuchung der Möglichkeiten zur Herausbildung einer europäischen Identität
- Bewertung des Potenzials des Neofunktionalismus zur Erklärung von Defiziten und zur Entwicklung von Lösungsansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die Frage nach der Legitimität und Identität der Europäischen Union im Kontext des Neofunktionalismus. Sie stellt die Kontroverse um ein mögliches Demokratiedefizit in der EU dar und untersucht, ob der Neofunktionalismus die Herausbildung von Legitimität und Identität erklären kann.
Kapitel 1: Die integrationstheoretische Debatte im Überblick: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die verschiedenen Integrationstheorien und ihre Ansätze zur Erklärung von Integrationsprozessen. Es werden die supranationalistischen und intergouvernementalistischen Theorien vorgestellt und ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die EU-Entwicklung beleuchtet.
Kapitel 2: Die Annahmen des Neofunktionalismus: Dieses Kapitel stellt die Integrationstheorie des Neofunktionalismus vor, die von Ernst B. Haas entwickelt wurde. Es werden die zentralen Annahmen des Neofunktionalismus erläutert, wie z.B. die Idee eines dynamischen Integrationsprozesses und der Spillover-Effekt. Außerdem werden die beiden anderen großen Integrationstheorien, Intergouvernementalismus und Föderalismus, kurz dargestellt, um einen Vergleich zu ermöglichen.
Kapitel 3: Legitimität und Identität als Kernthemen der europäischen Integration: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage nach einem Demokratiedefizit in der EU und analysiert die Herausforderungen der Legitimitätsbildung in einem supranationalen System. Es wird auch untersucht, wie sich eine europäische Identität entwickeln könnte.
Kapitel 4: Der Neofunktionalismus – relevant oder überholt?: Dieses Kapitel untersucht, inwieweit der Neofunktionalismus Potenzial hat, die in der EU identifizierten Defizite zu erklären und Lösungsansätze zu liefern. Es wird bewertet, ob der Neofunktionalismus als relevante Theorie für die Analyse der EU-Entwicklung betrachtet werden kann.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Neofunktionalismus, Legitimität, Identität, Demokratiedefizit, Spillover-Effekt, Intergouvernementalismus, Föderalismus, Europäische Union, EU.
- Citation du texte
- Christina Rokoss (Auteur), 2009, Legitimität und Identität in integrationstheoretischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169498