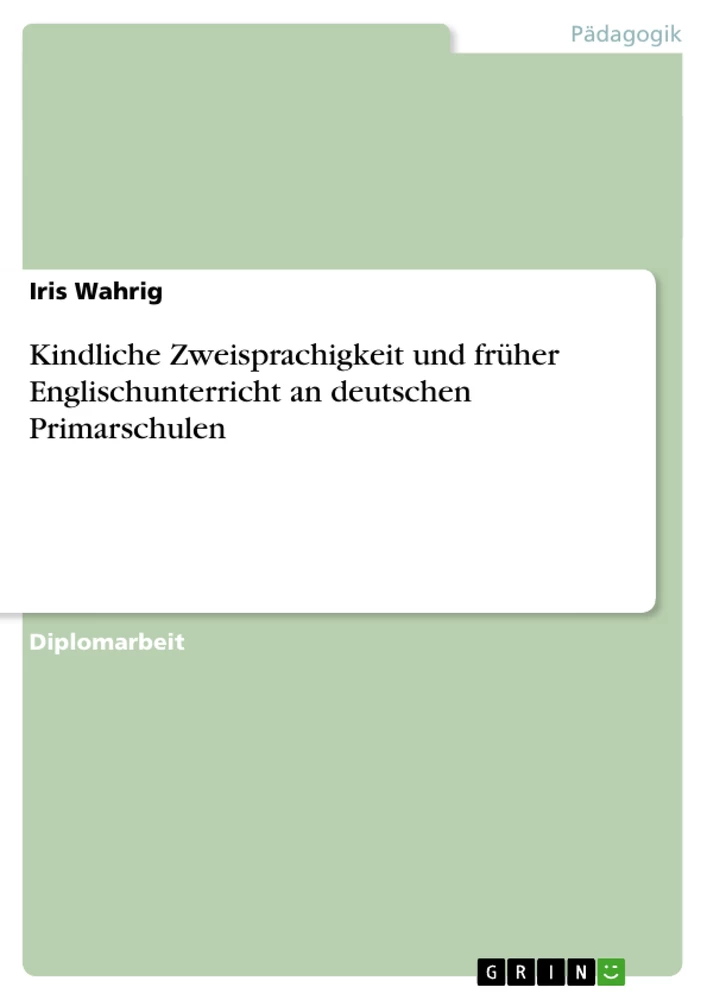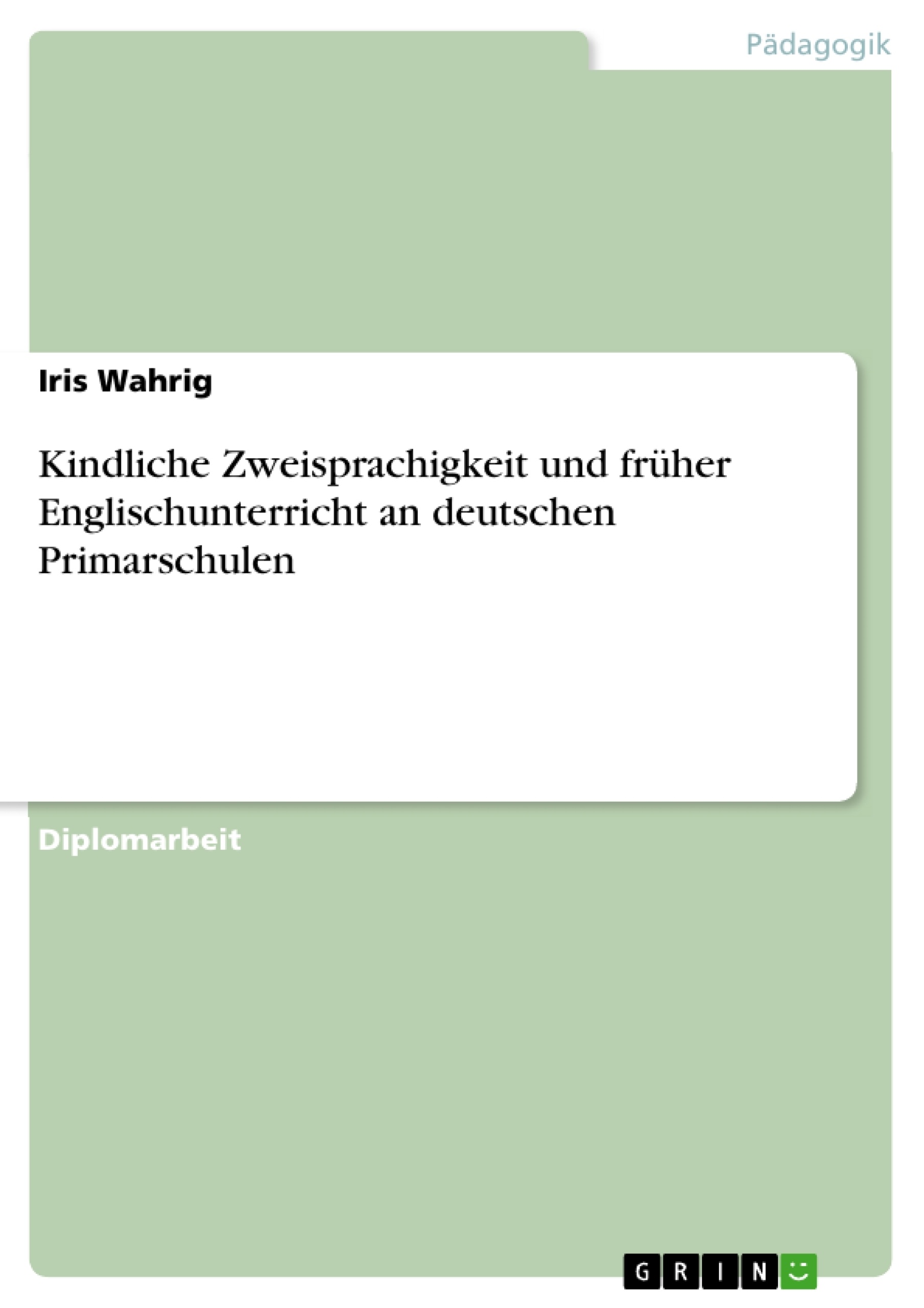Sprache galt schon immer als das Tor zur Welt. In unserer heutigen globalisierten Gesellschaft gilt dieser Satz mehr denn je. Grenzüberschreitende Lebens- und Arbeitsverhältnisse verlangen ein hohes Maß an fremdsprachlicher Kompetenz. Angesichts dieser sich verändernden Welt, steht auch das Schulwesen vor immer neuen Herausforderungen. Immer früher sollen Kinder fremde Sprachen erlernen. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf die bessere Lernfähigkeit der Schüler im Grundschulalter gelegt. Die Tatsache, dass im Jahre 2004/2005 der flächendeckende Englischunterricht auf der Primarstufe eingeführt wurde, trägt dieser Entwicklung Rechnung. Inwiefern der frühe Fremdsprachenunterricht der Grundschulen als Perspektive für die Zukunft gesehen werden kann, ist allerdings umstritten.
Die für die Bearbeitung des Themas zentrale Frage lautet daher, ob der Erwerb einer zweiten Sprache eine Chance bietet oder ob die Bilingualität eine Gefahr für die kindliche (Sprach-)Entwicklung darstellt. Eine wesentliche Rolle innerhalb der Forschungsdiskussion spielt dabei die Debatte über das optimale Alter für den Erwerb einer Fremdsprache. Dabei wird insbesondere in der Gesellschaft die Meinung vertreten, dass der frühere Erwerb zu besseren Ergebnissen führe. Gegensätzliche Stimmen sehen darin jedoch die Gefahr einer Überforderung des Kindes und vertreten die Ansicht, dass es notwendig sei erst eine Sprache – die eigene Muttersprache – vollständig zu erwerben. Das gleichzeitige Erlernen beider Sprachen würde Sprachmischungen hervorrufen, die oftmals als Indiz für unzureichende Kompetenzen angeführt werden. Um beiden Seiten gerecht zu werden, müssen deshalb die Anforderungen an den Fremdsprachenunterricht an der Zielgruppe – der Grundschüler – ausgerichtet werden. Hier stehen vor allem die Lehrer im Mittelpunkt, deren Qualifikationen die Basis einer fremdsprachlichen Früherziehung bilden. Jedoch tragen auch die lernpsychologischen Voraussetzungen der Kinder zu einem erfolgreichen Unterricht bei.
Wie aktuell dieses Thema ist, zeigt sich insbesondere an der hohen Zahl der Veröffentlichungen in den letzten Jahren. Hervorzuheben sind vor allem Heiner Böttger, in Bezug auf die fachdidaktischen Prinzipien des Englischunterrichts an Grundschulen1 und Suzanne Romaine, deren Publikation „Bilingualism“2 als Standardwerk zur Zweisprachigkeit betrachtet werden kann. Für eine Einführung in die Thematik empfiehlt sich das Überblickswerk „Foundations of Bilingual Education and Bilingualism“...
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Bilingualität - Begriff und Definition
- 2.1 Was ist Bilingualität? - Der Versuch einer Definition.
- 2.1.1 Der psycholinguistische Ansatz.
- 2.1.2 Der soziolinguistische Ansatz.
- 2.2 Abgrenzung der verschiedenen Formen von Bilingualität
- 2.2.1 Simultaner versus sukzessiver Zweitspracherwerb
- 2.2.2 Natürlicher versus gesteuerter Zweitspracherwerb.
- 2.2.3 Additive versus subtraktive Zweisprachigkeit
- 2.3 Begriffliche Abgrenzungen
- 2.3.1 Muttersprache gleich Muttersprache?
- 2.3.2 Familiensprache und Umgebungssprache........
- 2.3.3 Starke und schwache Sprache.........
- 3. Der bilinguale Spracherwerb: Voraussetzungen und Merkmale....
- 3.1 Monolingualer und bilingualer Spracherwerb.
- 3.1.1 Der monolinguale Erstspracherwerb.
- 3.1.2 Der bilinguale Erstspracherwerb.
- 3.2 Natürliche Bilingualität und Methoden zweisprachiger Erziehung.
- 3.2.1 Die Methode, Eine Person - eine Sprache'.
- 3.2.2 Die Methode, Eine Sprache - eine Umgebung
- 3.3 Künstliche Bilingualität
- 3.4 Der Faktor des optimalen Alters.
- 3.5 Code-switching und Code-mixing....
- 4. Über den gesellschaftlichen Umgang mit Zweisprachigkeit...
- 4.1 Negative (Vor-)Urteile gegenüber Zweisprachigkeit
- 4.2 Positive (Vor-)Urteile gegenüber Zweisprachigkeit .......
- 4.3 Vor- und Nachteile der bilingualen Erziehung.
- 5. Die Einführung des frühen Fremdsprachenunterrichts an deutschen Primarschulen
- 5.1 Die fremdsprachliche Früherziehung im institutionellen Rahmen - ein historischer Überblick.....
- 5.2 Erste Entwürfe und Versuche der Länder für den frühen Englischunterricht...
- 6. Zweitspracherwerb in der Grundschule am Beispiel des frühen Englischunterrichts Chance oder Gefahr für die kindliche Entwicklung?
- 6.1 Der Zweitspracherwerb unter schulischen Bedingungen.....
- 6.1.1 Die Bedeutung der englischen Sprache als erste Fremdsprache..
- 6.1.2 Herausforderungen für die Lehrer.
- 6.1.3 Lernpsychologische Voraussetzungen der Schüler.
- 6.2 Die Ziele des frühen Fremdsprachenunterrichts an Grundschulen
- 6.2.1 Sprachliche Kompetenzen
- 6.2.2 Interkulturelle Aspekte........
- 6.2.3 Affektive und motivationale Ziele......
- 6.3 Kindgerechter Englischunterricht in der Grundschule – grundlegende didaktische -\nPrinzipien für den frühen Zweitspracherwerb.
- 6.3.1 Kindgerechte Unterrichtsinhalte
- 6.3.2 Authentizität.
- 6.3.3 Visualisierung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Diplomarbeit untersucht den Einfluss des frühen Englischunterrichts an deutschen Grundschulen auf die kindliche Entwicklung. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob der Erwerb einer zweiten Sprache eine Chance oder eine Gefahr für die kindliche (Sprach-)Entwicklung darstellt.
- Begriff und Definition von Bilingualität
- Voraussetzungen und Merkmale des bilingualen Spracherwerbs
- Gesellschaftlicher Umgang mit Zweisprachigkeit
- Einführung des frühen Fremdsprachenunterrichts an deutschen Primarschulen
- Zweitspracherwerb in der Grundschule am Beispiel des frühen Englischunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema der Diplomarbeit und stellt die zentrale Fragestellung dar. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der Bilingualität und definiert ihn aus psycholinguistischer und soziolinguistischer Perspektive. Zudem werden verschiedene Formen von Bilingualität abgegrenzt, wie zum Beispiel simultaner vs. sukzessiver Zweitspracherwerb, natürlicher vs. gesteuerter Zweitspracherwerb und additive vs. subtraktive Zweisprachigkeit. Kapitel 3 befasst sich mit den Voraussetzungen und Merkmalen des bilingualen Spracherwerbs, unterteilt in den monolingualen und den bilingualen Erstspracherwerb. Des Weiteren werden Methoden zweisprachiger Erziehung, wie die "Eine Person - eine Sprache" Methode, vorgestellt. Kapitel 4 untersucht den gesellschaftlichen Umgang mit Zweisprachigkeit, indem sowohl negative als auch positive Vorurteile beleuchtet werden. Auch die Vor- und Nachteile der bilingualen Erziehung werden in diesem Kapitel erörtert.
Kapitel 5 widmet sich der Einführung des frühen Fremdsprachenunterrichts an deutschen Primarschulen und beleuchtet den historischen Überblick sowie erste Versuche der Länder für den frühen Englischunterricht. Im sechsten Kapitel wird der Zweitspracherwerb in der Grundschule, insbesondere der frühe Englischunterricht, untersucht. Es werden die Herausforderungen für Lehrer, die lernpsychologischen Voraussetzungen der Schüler sowie die Ziele des frühen Fremdsprachenunterrichts erläutert. Abschließend werden kindgerechte Unterrichtsinhalte und grundlegende didaktische Prinzipien für den frühen Zweitspracherwerb vorgestellt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Zweisprachigkeit, Bilingualität, Spracherwerb, Fremdsprachenunterricht, frühe Fremdsprachen, Primarschule, Grundschule, Englischunterricht, Lernpsychologie, Didaktik, Interkulturelle Kompetenz, gesellschaftlicher Umgang, Vorurteile, Methoden.
Häufig gestellte Fragen
Ist früher Englischunterricht in der Grundschule sinnvoll?
Die Arbeit diskutiert, ob der frühe Fremdsprachenerwerb eine Chance zur besseren Lernfähigkeit bietet oder eine Gefahr der Überforderung darstellt.
Was ist der Unterschied zwischen simultanem und sukzessivem Spracherwerb?
Simultaner Erwerb bedeutet das gleichzeitige Erlernen zweier Sprachen von Geburt an; sukzessiver Erwerb ist das zeitversetzte Erlernen einer Zweitsprache nach der Muttersprache.
Führt früher Fremdsprachenunterricht zu Sprachmischungen?
Kritiker befürchten 'Code-mixing', doch die Forschung zeigt, dass Kinder bei kindgerechter Didaktik meist gut zwischen den Sprachen unterscheiden können.
Welche Anforderungen stellt früher Englischunterricht an Lehrer?
Lehrer benötigen spezifische fachdidaktische Qualifikationen, um den Unterricht authentisch, spielerisch und visualisiert an die Zielgruppe der Grundschüler anzupassen.
Welche Ziele verfolgt der Englischunterricht in der Primarstufe?
Neben sprachlichen Kompetenzen stehen interkulturelle Aspekte sowie affektive und motivationale Ziele (Freude am Sprachenlernen) im Vordergrund.
- Citation du texte
- Iris Wahrig (Auteur), 2009, Kindliche Zweisprachigkeit und früher Englischunterricht an deutschen Primarschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169986