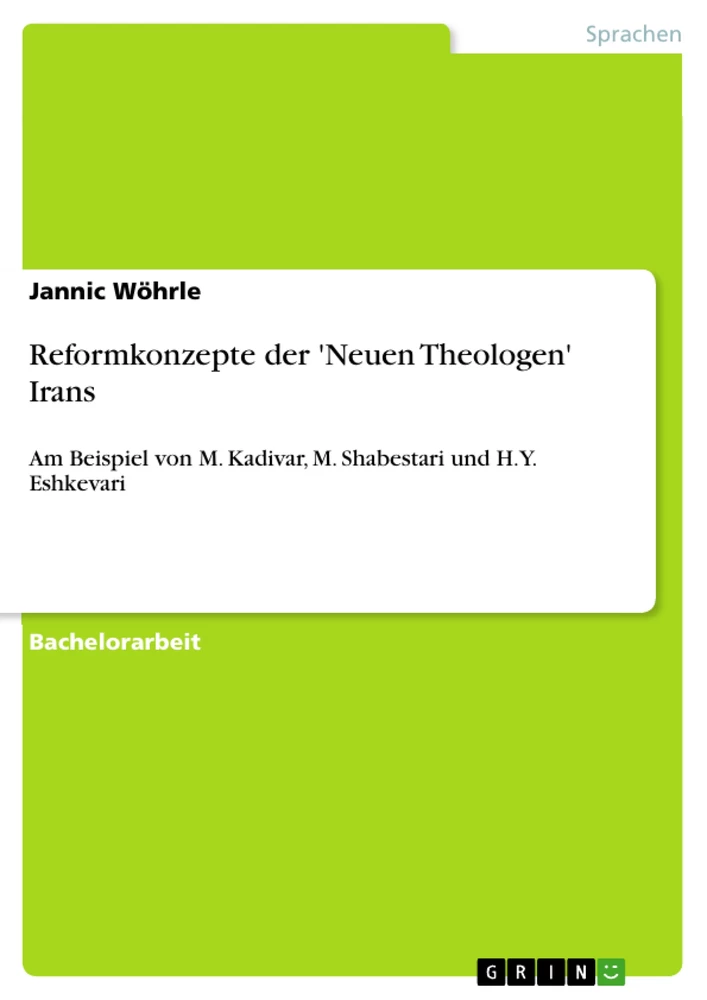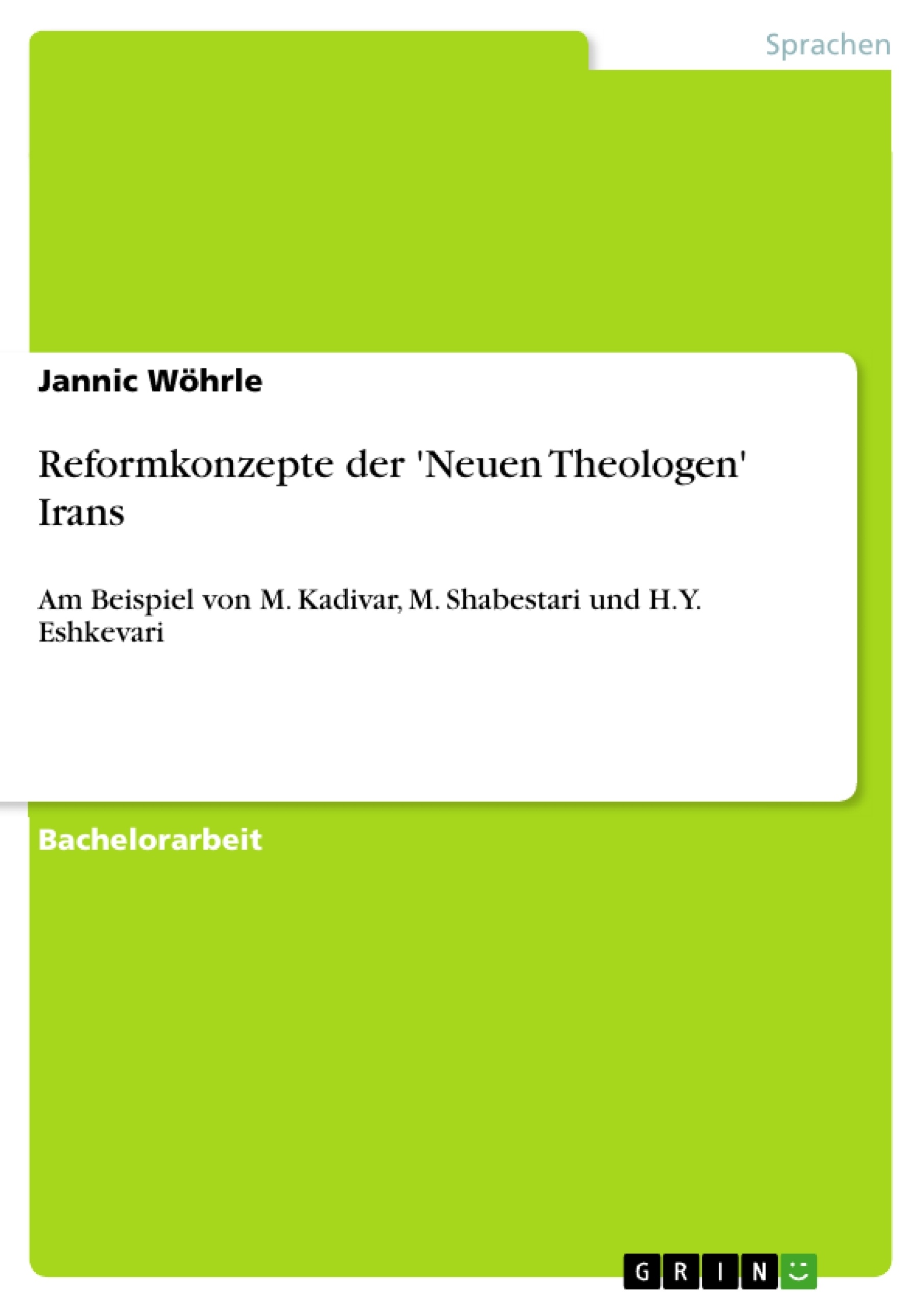Es scheint, als stünde die Islamischen Republik Iran dieser Tage am Scheideweg. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit – zur Jahreswende 2009/2010 – spitzte sich die Lage innerhalb des Landes im Zuge der Demonstrationen der so genannten ‚grünen Protestbewegung„ gegen das herrschende Regime, das mit dem Vorwurf der Wahlfälschung konfrontiert ist, weiter zu. Vieles deutet darauf hin, dass sich die breite Protestbewegung nicht allein gegen den Präsidenten, sondern gegen das System als solches richtet, das als unterdrückerisch und undemokratisch empfunden wird. Das Regime befindet sich in einer handfesten Legitimitätskrise.
In dieser Arbeit soll es nun darum gehen, die Reformkonzepte drei bedeutsamer ‚Neuen Theologen„ näher zu betrachten. Die Reihenfolge, in der diese Reformdenker im dritten und vierten Kapitel zur Sprache kommen, beinhaltet keine chronologische Bedeutung und auch keine Rangbewertung. Alle drei sind heute – aus Sicht dieser Arbeit – gleichermaßen von Bedeutung für den iranischen Reformdiskurs.
Es wird die Frage untersucht, welche Impulse und Anregungen diese Ansätze in Bezug auf eine Lösung der gesellschaftspolitischen Probleme und offenen Krise der Islamischen Republik Iran haben könnten.
Im Verlauf wird deutlich gemacht, vor welchem Hintergrund und unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen sich die postrevolutionäre Reformbewegung in Iran herausbildete und einen Diskurs in Gang setzte, der sich um neue Ansätze in Bezug auf ‚den Islam„ als vielschichtiges Glaubens- und Wertesystem in seinem Verhältnis zu politischen Institutionen und Regierungssystemen bemüht.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich vorwiegend mit der Frage, welche Leitprinzipien die hier vorgestellten Reformdenker im Einzelnen in Bezug auf eine Fortentwicklung islamischer Denksysteme, d.h. auch islamischer Normen und Bestimmungen vertreten und in welcher Hinsicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen.
Diese Analyse führt die Reformdenker und uns schließlich zum vierten Kapitel, das sich der Frage des Islam in seiner Beziehung und Anpassungsfähigkeit mit demokratischen Regierungsformen widmet.
Dabei soll auch auf die Frage eingegangen werden, welche Anregungen und Thesen der vorgestellten ‚Neuen Theologen„ als überzeugende Lösungsansätze für die gesellschaftspolitische Sackgasse gewertet werden können, in der Iran sich nach wie vor befindet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Entwicklung der Islamischen Republik Iran und ihr gesellschaftspolitisches Dilemma
- Allgemeine Vorbemerkungen zur Islamischen Republik
- Entwicklungsphasen seit der Revolution 1979
- Leitprinzipien der Reformkonzepte der, Neuen Theologen' am Beispiel von Šabestari, Kadivar und Eškevari
- Hermeneutischer Ansatz und Historisierung der Offenbarung
- Die Veränderbarkeit und Flexibilität der gesellschaftsrelevanten Vorschriften des Islam
- Der Ansatz des spirituellen und zielorientierten Islam
- Zur Frage der Vereinbarkeit von Islam und Demokratie
- Kritik an der velāyat-e faqih-Konzeption
- Entwürfe einer religiösen-demokratischen Regierungsform
- Fazit und Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit den Reformkonzepten der iranischen Reformdenker Mohammed Moğtahed Šabestari, Mohsen Kadivar und Ḥasan Yusefi Eškevari. Das Ziel ist es, die wichtigsten Leitprinzipien und Reformvorschläge dieser Denker zu analysieren und ihre Relevanz für die aktuelle gesellschaftspolitische Situation im Iran zu beleuchten.
- Hermeneutische Interpretation des Islam und die Bedeutung von Historisierung der Offenbarung
- Die Flexibilität und Veränderbarkeit islamischer Vorschriften im Kontext der modernen Gesellschaft
- Die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie und Kritik an der velāyat-e faqih-Konzeption
- Entwürfe einer religiösen-demokratischen Regierungsform im Iran
- Die Bedeutung der Reformdenker für den iranischen Reformdiskurs
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die drei Reformdenker Šabestari, Kadivar und Eškevari vor.
Das zweite Kapitel skizziert die Entwicklung der Islamischen Republik Iran und beleuchtet die gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen, denen das Land seit der Revolution 1979 gegenübersteht.
Das dritte Kapitel analysiert die Reformkonzepte der drei Denker und untersucht ihre Ansätze zur Interpretation des Islam, zur Relevanz von islamischen Vorschriften in der Moderne und zur Entwicklung eines spirituellen und zielorientierten Islam.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Frage der Vereinbarkeit von Islam und Demokratie im Iran. Die Reformdenker kritisieren die velāyat-e faqih-Konzeption und entwickeln Entwürfe für eine religiös-demokratische Regierungsform.
Schlüsselwörter (Keywords)
Islamische Republik Iran, Reformdenken, Neue Theologen, Šabestari, Kadivar, Eškevari, Hermeneutik, Historisierung der Offenbarung, Islamisches Recht, Demokratie, velāyat-e faqih, Reformdiskurs.
- Citation du texte
- Jannic Wöhrle (Auteur), 2010, Reformkonzepte der 'Neuen Theologen' Irans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170088