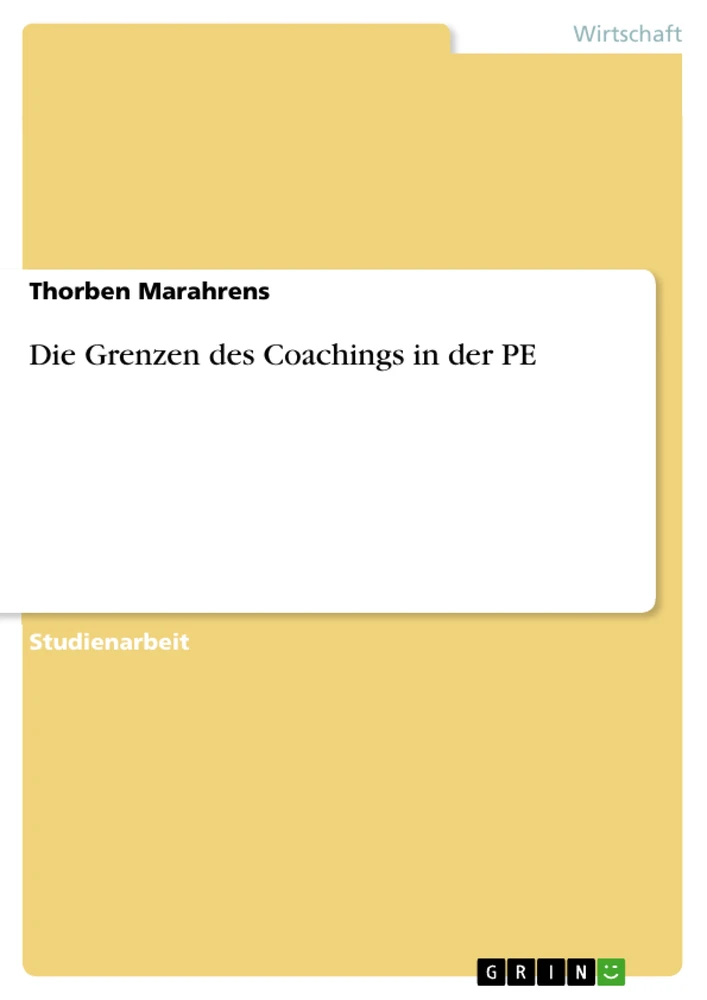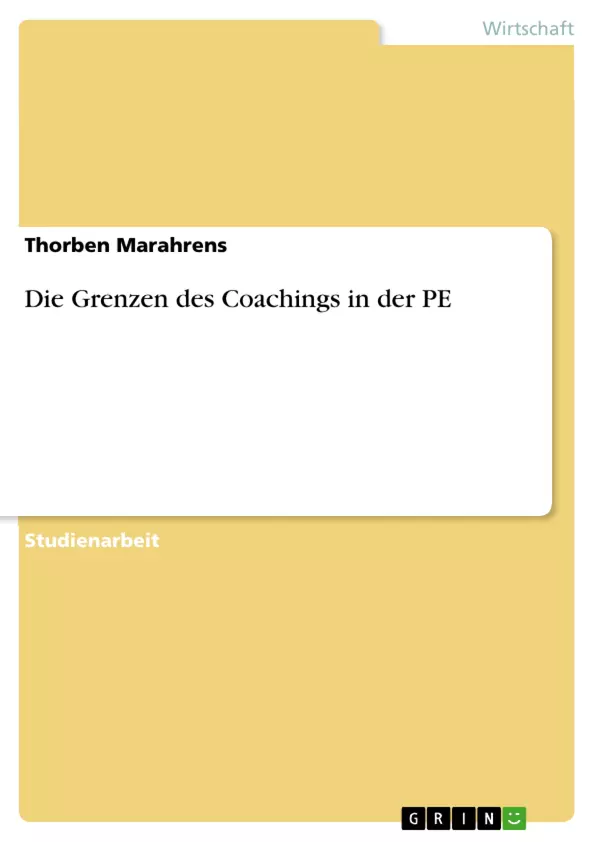Unzählig viele Autoren preisen die Kraft des Coachings an.
Coaching als Instrument zur Steigerung der sozialen Kompetenz von Führungskräften (z.B. Jetter/ Skrotzki, 2005), die Chancen des Online- und Tele- Coaching (z.B. Rauen, 2003), die Steigerung der Fähigkeit der Selbstreflexion (z.B. Linke, 2003), generell, Coaching als Förderinstrument, um Mitarbeiterpotentiale zu wecken und entwickeln (z.B. Haberleitner et al, 2007), Coaching als Instrument der Produktivitätsoptimierung (z.B. Haberleitner et al, 2007), Coaching für weibliche Führungskräfte mit Fokus auf rollenspezifische Unterstützung (z.B. Siegl, 2003) und Coaching gar als Mittel demographischen Entwicklungen entgegenzuwirken (z.B. Mecke, 2007). Kurz: Coaching hat Vorteile für Mitarbeiter, Führungskräfte, Unternehmen und die Akteure der privaten Umfelder.
Verallgemeinernd lässt sich formulieren, dass Coaching positiv auf die berufliche Rolle als Schnittfeld zwischen der Persönlichkeit und der Organisation wirkt (Rauen, 2003: 3).
Ist Coaching demnach ein Allheilmittel? Ganz sicher nicht. Auch das Konzept des Coachings unterliegt Widrigkeiten. Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Grenzen des Coachings skizziert und diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Coaching in der bisherigen Personalentwicklung
- Dieser Arbeit zu Grunde liegendes Verständnis von Coaching
- Grenzen des Coachings
- Zuvor vereinbarte Grenzen/ definierte Tabus
- Kompatibilität der Persönlichkeiten
- Gewöhnung an das Coaching
- Durchsetzen von Organisationszielen
- Verantwortungsübernahme
- Abgrenzung zu angrenzenden Arbeitsformen
- Abgrenzung von Psychotherapie und Coaching
- Abgrenzung von Supervision und Coaching
- Abgrenzung von Mentoring und Coaching
- Abgrenzung von Beratung und Coaching
- Abgrenzung von Training und Coaching
- Kosten des Coachings und Messbarkeit des Erfolges
- Weitere diskussionswürdige Aspekte bezüglich der Grenzen des Coachings
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Grenzen des Coachings im Bereich der Personalentwicklung. Sie soll die Grenzen des Coachings aufzeigen und diskutieren, um ein realistisches Bild der Möglichkeiten und Grenzen dieses Instrumentes zu vermitteln.
- Definition und Abgrenzung des Coaching-Konzeptes
- Verschiedene Arten von Grenzen im Coaching-Prozess
- Die Bedeutung der Kompatibilität von Coach und Coachee
- Die Abgrenzung von Coaching zu ähnlichen Beratungsformen
- Die Rolle des psychologischen Vertrages und der Tabuzonen im Coaching
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Grenzen des Coachings“ in der Personalentwicklung dar und verweist auf die umfangreiche Literatur, die die Vorteile des Coachings betont. Die Arbeit möchte einen Kontrapunkt setzen und die Grenzen des Coachings beleuchten.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel wird der Einsatz von Coaching in der Personalentwicklung historisch beleuchtet. Es zeigt sich, wie Coaching von der Beratung von Top-Managern zu einem festen Bestandteil der Personalentwicklung geworden ist.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel definiert das Coaching-Konzept und erläutert die zentralen Merkmale, die es von anderen Beratungsformen abgrenzen.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Grenzen des Coachings. Dazu zählen vorab vereinbarte Tabuzonen, die Kompatibilität der beteiligten Personen, die Gefahr der Gewöhnung an das Coaching, die Schwierigkeit, Organisationsziele durchzusetzen, die Übernahme von Verantwortung durch den Coachee sowie die Abgrenzung zu anderen Beratungsformen wie Psychotherapie, Supervision, Mentoring, Beratung und Training. Außerdem wird der Kostenfaktor und die Messbarkeit des Coaching-Erfolges angesprochen.
Schlüsselwörter
Coaching, Personalentwicklung, Grenzen, Kompatibilität, Tabuzonen, Abgrenzung, Psychotherapie, Supervision, Mentoring, Beratung, Training, Kosten, Messbarkeit, Selbstreflexion, Verantwortungsübernahme, Organisationsziele, psychologischer Vertrag.
Häufig gestellte Fragen
Ist Coaching ein „Allheilmittel“ in der Personalentwicklung?
Nein, die Arbeit stellt klar, dass Coaching zwar viele Vorteile bietet, aber auch an deutliche Grenzen stößt, die oft ignoriert werden.
Was sind die wichtigsten Grenzen des Coachings?
Dazu gehören die mangelnde Kompatibilität der Persönlichkeiten, Tabuzonen, die Gefahr der Gewöhnung und die Kosten-Nutzen-Messbarkeit.
Wie grenzt sich Coaching von Psychotherapie ab?
Coaching richtet sich an „gesunde“ Personen zur beruflichen Optimierung, während Psychotherapie die Heilung psychischer Erkrankungen zum Ziel hat.
Welche Rolle spielt die „Kompatibilität“?
Der Erfolg hängt stark davon ab, ob Coach und Coachee auf menschlicher Ebene zusammenpassen und ein Vertrauensverhältnis aufbauen können.
Was ist der Unterschied zwischen Coaching und Mentoring?
Mentoring basiert oft auf der Weitergabe von Erfahrung durch eine erfahrenere Person, während Coaching eher Hilfe zur Selbsthilfe und Reflexion ist.
- Citation du texte
- Thorben Marahrens (Auteur), 2008, Die Grenzen des Coachings in der PE, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170805