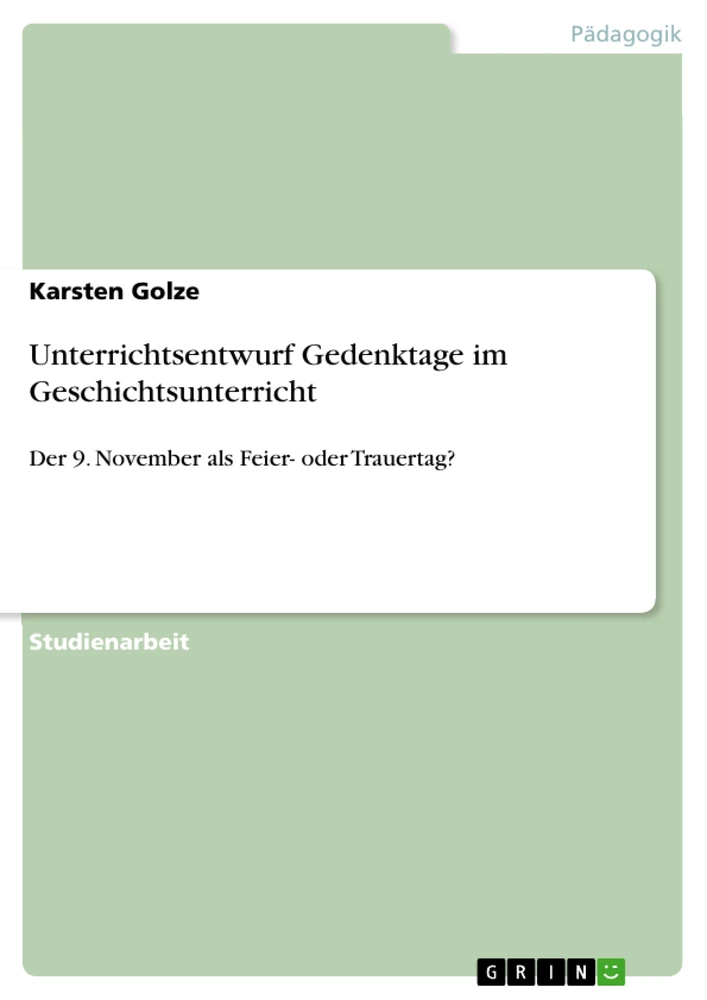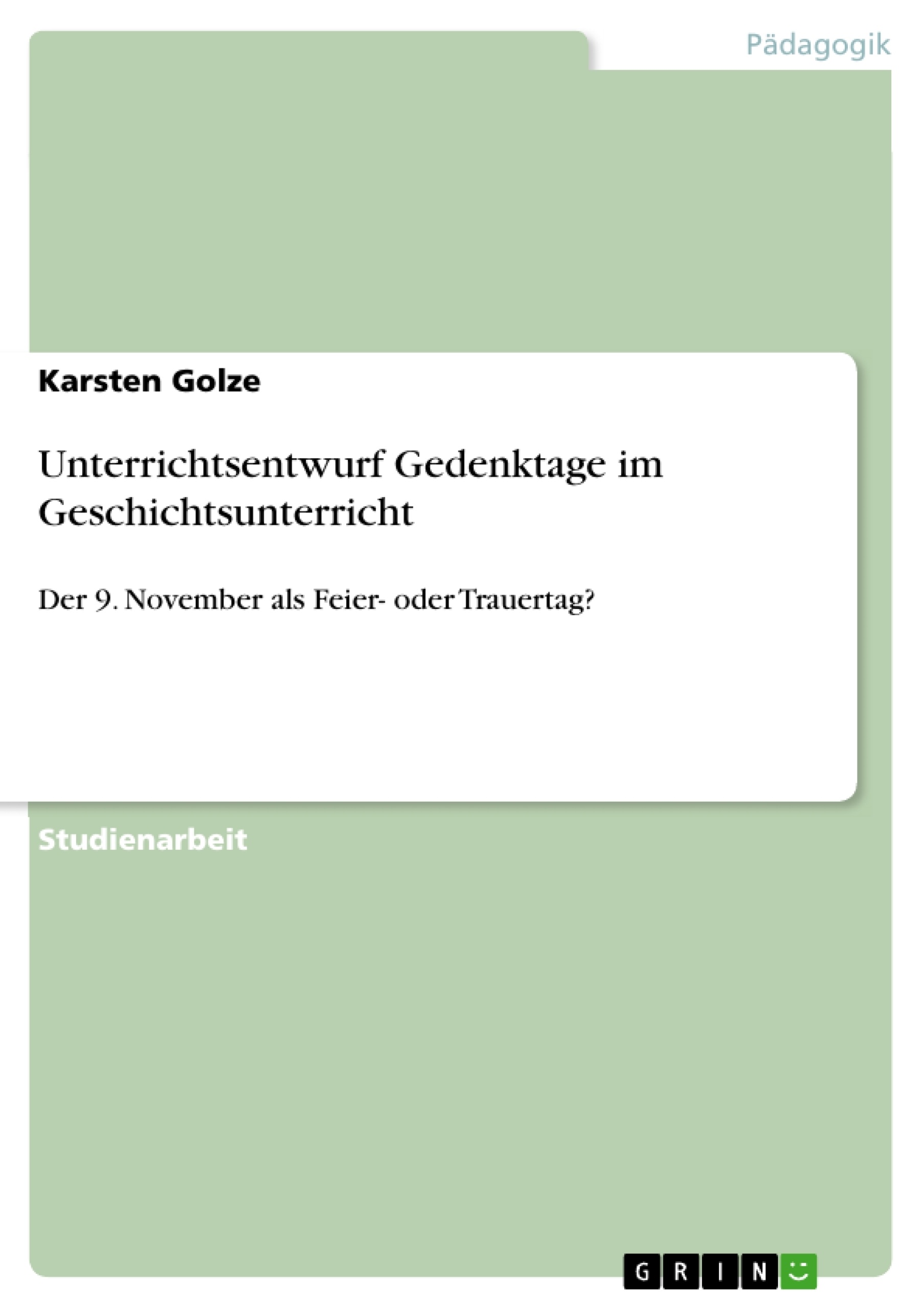Gedenktage und Erinnerungskultur sind Themen des geschichtsdidaktischen Oberbegriffs „Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur“. Um geschichtskulturelle Fragen zu klären, muss man sich zwangsweise mit der Außenseite des gesellschaftlichen Geschichtsbewusstseins beschäftigen. Gedenk- und Feiertage werden also nicht gefeiert, weil man sich persönlich dafür entschied sie zu feiern, sondern weil die Gesellschaft und der gemeinsame Erinnerungsbetrieb uns dazu bringt diese Tage als besondere Tage in unser Alltagsleben zu integrieren.
Dieses gemeinsame Denken und Gedenken wird kulturelles Gedächtnis genannt. Es entsteht, da wir als einzelnes Individuum kaum in der Lage wären, komplexe historische Vorstellungen selbst zu entwickeln und sie im Gedächtnis zu behalten. Dazu benötigt es ein funktionierendes soziales System, das aus vier Komponenten besteht: Die Institutionen, wie Schulen, Museen oder Bibliotheken. Spezielle Professionen, also bestimme Berufsgruppen, die die Aufgabe haben Erinnerungskultur zu verbreiten. Medien, wie Fernsehen, Zeitung oder Computer, die als größtes Speichermedium der Erinnerung gelten und natürlich das Publikum, das dabei als Empfänger der Informationen fungiert.
Um nun Menschen das System der Geschichts- und Erinnerungskultur näher zu bringen, müssen schon junge Schüler mit diesen Themen konfrontiert werden. Geschichts- und Erinnerungskultur muss also Gegenstand im Geschichtsunterricht werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung - Intention und Aufbau der Hausarbeit
- Gedenktage und Erinnerungskultur
- II. Gedenktage im Geschichtsunterricht am Beispiel des 9. November
- A. Sachanalyse - Was geschah am 9. November?
- 1. 1918 – Die Ausrufung der Republik
- 2. 1923 - Der Hitlerputsch
- 3. 1938 - Die Reichspogromnacht
- 4. 1939 - Das Georg-Elser-Attentat
- 5. 1989 - Der Fall der Berliner Mauer
- B. Fachdidaktische Analyse - Gedenktage in der Öffentlichkeit
- 1. Geschichte der Gedenkkultur
- 2. Funktionen der Gedenktage
- 3. Der 9. November in der öffentlichen Diskussion
- C. Fachdidaktische Ausarbeitung
- 1. Lehrplanbezug
- 2. Umsetzungsvorschlag für den Unterricht
- III. Schluss-Chancen und Probleme im Unterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Gedenktagen im Geschichtsunterricht, wobei der 9. November als Fallbeispiel dient. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Gedenktagen für die Erinnerungskultur und das Geschichtsbewusstsein aufzuzeigen und deren Relevanz für den Unterricht zu beleuchten.
- Die verschiedenen historischen Ereignisse, die am 9. November stattfanden
- Die Geschichte und Funktion von Gedenktagen
- Die öffentliche Diskussion über den 9. November als Gedenktag
- Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Einbindung von Gedenktagen in den Unterricht
- Die Bedeutung von Erinnerungskultur für das Geschichtsbewusstsein
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung - Intention und Aufbau der Hausarbeit
Die Einleitung stellt die Relevanz von Gedenktagen und Erinnerungskultur im Geschichtsunterricht heraus und erläutert den Aufbau der Arbeit.
II. Gedenktage im Geschichtsunterricht am Beispiel des 9. November
Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen historischen Ereignisse, die am 9. November stattfanden, und setzt diese in den Kontext der Erinnerungskultur. Es untersucht die Bedeutung von Gedenktagen für die Gesellschaft und ihre Rolle im Geschichtsbewusstsein.
III. Schluss-Chancen und Probleme im Unterricht
Dieses Kapitel diskutiert die Chancen und Herausforderungen bei der Einbindung von Gedenktagen in den Unterricht. Es beleuchtet die Bedeutung von Erinnerungskultur für die Bildung junger Menschen.
Schlüsselwörter
Gedenktage, Erinnerungskultur, Geschichtsbewusstsein, Geschichtsunterricht, 9. November, Weimarer Republik, Hitlerputsch, Reichspogromnacht, Fall der Berliner Mauer, öffentliche Diskussion, Lehrplanbezug, Unterrichtsversuch.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der 9. November ein besonderer Gedenktag?
Der 9. November ist ein „Schicksalstag“, an dem mehrere zentrale Ereignisse der deutschen Geschichte stattfanden: 1918 (Republik), 1923 (Hitlerputsch), 1938 (Reichspogromnacht) und 1989 (Mauerfall).
Was versteht man unter „kulturellem Gedächtnis“?
Es ist ein soziales System zur Bewahrung historischer Vorstellungen durch Institutionen (Schulen, Museen), Medien und Fachleute.
Wie können Gedenktage im Geschichtsunterricht genutzt werden?
Sie dienen als Ankerpunkte, um Schülern Geschichtsbewusstsein zu vermitteln und die Bedeutung von Erinnerungskultur für die heutige Gesellschaft aufzuzeigen.
Was sind die Funktionen von Gedenktagen?
Gedenktage dienen der kollektiven Identitätsstiftung, der Mahnung vor Unrecht und der Würdigung historischer Errungenschaften.
Welche Herausforderungen gibt es beim Thema Gedenktage in der Schule?
Herausforderungen liegen in der Komplexität der verschiedenen Ereignisse an einem Datum und der Notwendigkeit, eine persönliche Distanz zu wahren und gleichzeitig Empathie zu wecken.
- Citation du texte
- Karsten Golze (Auteur), 2007, Unterrichtsentwurf Gedenktage im Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170935