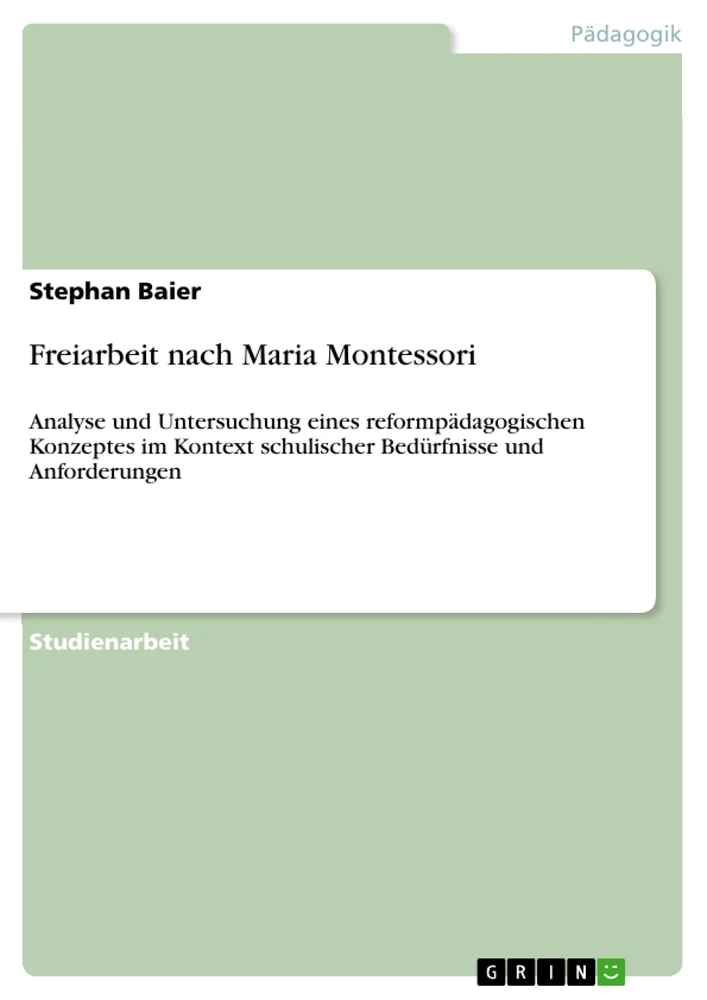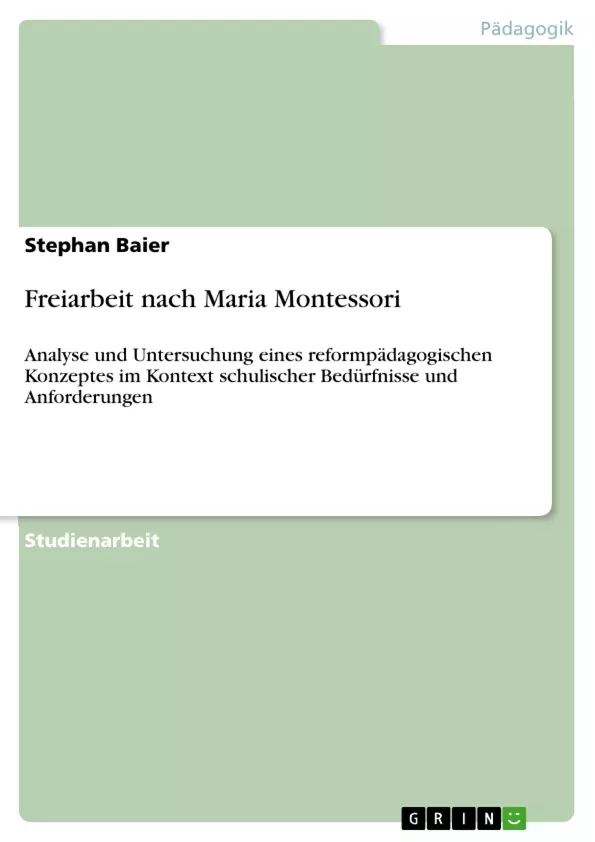Einleitung
„Non scholae, sed vitae discimus“ – Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.(1)
So ist es zumindest der Wunsch aller Eltern, Lehrer und zuletzt auch des Bildungssystems. Dass Wunsch und dessen Erfüllung jedoch manchmal weitgehend auseinander divergieren, lässt die Suche nach alternativen Handlungsmöglichkeiten erwachen und führte in der
Menschheitsgeschichte schon oft zu mehr oder weniger bahnbrechenden Entdeckungen und Fortschritten. Solche Handlungsalternativen werden besonders häufig in Diskussionen zur richtigen Erziehung von Kindern und Jugendlichen gefordert – leider aber zu selten gefördert.
Der Anspruch an unser Bildungswesen nimmt stetig zu, bedingt durch die hohen Anforderungen an Leistungs- und Bildungsstandards. So wächst auch der Druck auf die Schüler, die die Inhalte der Lehrpläne aufnehmen sollen und oft genau mit den einhergehenden Problemen
konfrontiert sind. Im Laufe der Geschichte entwickelten sich aus verschiedenen Blickrichtungen Ansätze zur Kompensation oder vielmehr zur Verbesserung des Bildungswesens. Einen dieser Ansätze findet man in der Reformpädagogik. Den Beginn dieser neuen Sichtweise auf
die Erziehung und Bildung von Jugendlichen zeichnet sich zum Ende des 19. Jahrhunderts ab.
Neben Selbstständigkeit, Erlebnispädagogik und Lernen durch Handeln ist dieser Ansatz durch das freie Lernen gekennzeichnet. Maria Montessori rückte dabei insbesondere das Kind in den Fokus weiterer Ideen – das Kind als „Baumeister seiner selbst“.(2) Durch freies Arbeiten lernt das Kind seine Umwelt wahrzunehmen und mit dieser umzugehen, Teil der Welt zu werden und problemorientiert Aufgaben zu lösen. Montessori entwickelt mit ihrer Kinderzentrierten
Pädagogik einen der entscheidenden Bildungsansätze der Moderne und nicht zuletzt auch Konzepte für heutige, führende Bildungsstrategien.(3)
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Person Maria Montessori
- Die Pädagogik nach Maria Montessori
- Freiarbeit und freie Arbeit - Grundlagen der Montessori-Pädagogik
- Die Grundprinzipien
- Bedingungen für freies Arbeiten
- Die Bedeutung der Montessori-Freiarbeit
- Prinzipien der freien Arbeit
- Probleme bei der freien Arbeit nach Montessori
- Wahl der Arbeit
- Wahl des Materials
- Wahl des Raumes
- Das Kind
- Der Erzieher / Lehrer
- Wie frei ist freie Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse und Untersuchung des reformpädagogischen Konzeptes der freien Arbeit nach Maria Montessori im Kontext schulischer Bedürfnisse und Anforderungen. Ziel ist es, die Grundlagen der Montessori-Pädagogik, insbesondere das Konzept der freien Arbeit, zu beleuchten und seine Vereinbarkeit mit aktuellen Lehrplänen und Anforderungen an das lernende Individuum zu untersuchen. Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, wie weit ein Kind frei lernen kann und welche Grenzen dabei Lehrer, Eltern und Schüler innerhalb des Bildungsprozesses erfahren.
- Die Grundprinzipien der Montessori-Pädagogik
- Die Bedeutung der freien Arbeit im Kontext schulischer Bedürfnisse
- Die Vereinbarkeit von Montessori-Freiarbeit mit aktuellen Lehrplänen
- Die Frage nach der Freiheit der Freiarbeit und ihre Grenzen
- Die Rolle des Erziehers und des Kindes im Bildungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und beschreibt die Relevanz der Montessori-Pädagogik im heutigen Bildungswesen. Sie führt in das Thema der freien Arbeit ein und beleuchtet den Anspruch an das Bildungssystem und die Herausforderungen für Schüler und Lehrer.
- Zur Person Maria Montessori: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Leben und Werk von Maria Montessori. Es beleuchtet ihre Bildung und ihre frühen Erfahrungen, die sie stark für die Entwicklung ihrer pädagogischen Ansätze prägten.
- Die Pädagogik nach Maria Montessori: Dieses Kapitel erläutert die Kernpunkte der Montessori-Pädagogik, die sich vor allem auf die Bedürfnisse des Kindes konzentrieren. Es beschreibt den Leitgedanken der kosmischen Erziehung, der dem Kind Freiheit gewährt, seine Umwelt zu erleben, wahrzunehmen und zu entdecken.
- Freiarbeit und freie Arbeit - Grundlagen der Montessori-Pädagogik: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen der Montessori-Freiarbeit. Es untersucht die Grundprinzipien, die Bedingungen für freies Arbeiten und die Bedeutung der Montessori-Freiarbeit für die kindliche Entwicklung.
- Prinzipien der freien Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Prinzipien der freien Arbeit nach Montessori. Es beleuchtet die unterschiedlichen Elemente der Montessori-Pädagogik und ihre Umsetzung im Unterricht.
- Probleme bei der freien Arbeit nach Montessori: Dieses Kapitel analysiert die potentiellen Probleme bei der Umsetzung der freien Arbeit. Es untersucht die Wahl der Arbeit, des Materials, des Raumes, die Rolle des Kindes und die Funktion des Erziehers.
- Wie frei ist freie Arbeit: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage nach der Freiheit der Freiarbeit. Es untersucht die Grenzen der Freiheit im Bildungsprozess und die Herausforderungen, die sich für Lehrer, Eltern und Schüler ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Reformpädagogik und setzt sich mit den Konzepten von Maria Montessori auseinander. Schlüsselbegriffe sind hierbei: freie Arbeit, Montessori-Pädagogik, kosmische Erziehung, Selbstständigkeit, kindzentrierte Pädagogik, Bildungswesen, Lehrpläne, Anforderungen, Freiheit, Grenzen, Erzieher, Kind, Bildungsprozess.
- Quote paper
- Stephan Baier (Author), 2010, Freiarbeit nach Maria Montessori, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171021