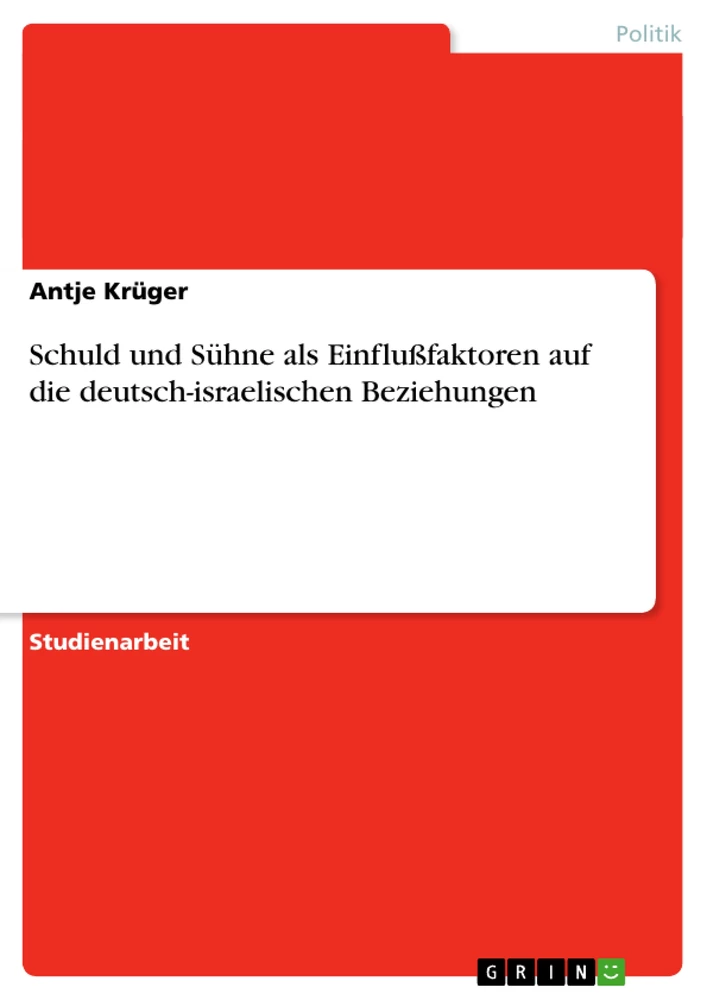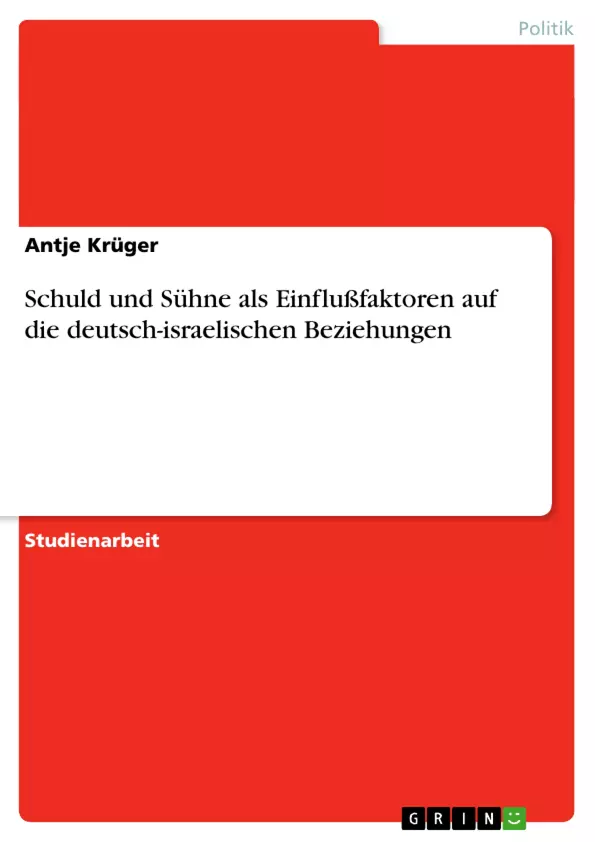1948 wurde der Staat Israel gegründet, drei Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, der nicht zuletzt Grund für die Bildung eines Staates der Juden war. Ein Jahr später, 1949, entstanden auf den Trümmern des besiegten und besetzten Deutschlands zwei Staaten, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik. Zwei Staaten, die sich dem Erbe eine millionenfachen Schuld zu stellen hatten. Wie mit einer solchen Schuld umgehen?
Bis heute ist diese Frage heftig umstritten. Wurde deutsche Schuld an den Verbrechen des Krieges nicht schon gesühnt? Müssen wir uns heute, Generationen später, immer noch mit dieser Frage beschäftigen? Muss, darf oder soll sie bestimmend sein für unsere Politik? Die deutschen Beziehungen zum Staat Israel sind ein Spiegelbild deutschen Gewissens. Vor allem aufgrund unzureichender Vergangenheitsbewältigung, mangelnder Sensibilität im Umgang mit der eigenen und der fremden Geschichte sowie des (fast alles) dominierenden Wunsches nach Wohlstand und "Normalität" sind die Beziehungen zu Israel auch heute noch sehr gespannt. Misstrauen seitens der Israelis wurde in mehr als 40 Jahren Nachkriegsgeschichte nicht abgebaut. Im Gegenteil, mehr als einmal verspielte Deutschland sich das mühselig aufgebaute Vertrauen. So zum Beispiel als 1962 die Beteiligung der Bundesrepublik an der Waffenproduktion Ägyptens, zu diesem Zeitpunkt noch Feind der Israelis, enthüllt wurde. Oder aber als im Golfkrieg Scud-Raketen aus deutscher Produktion in Israel einschlugen. Angesichts dieser Tatsachen ist es nicht verwunderlich, dass der Dialog zwischen beiden Staaten mehrmals zum Erliegen kam.
Anhand von vier Ereignissen aus der Geschichte deutsch-israelischer Beziehungen, 1. dem Wiedergutmachungsabkommen, 2. der Aufnahme diplomatischer Beziehungen, 3. der Normalisierungsdebatte und 4. dem Golfkrieg, wird die deutsche Außenpolitik dargestellt. Sie verdeutlichen die wechselvollen und schwierigen Beziehungen, auf die der Schatten der Geschichte noch immer tiefschwarz fällt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze Einführung in die Konflikt- und Interessensituation
- Schuld und Sühne: Moral in der Politik
- Internationale Interessenkonstellation
- Vier Beispiele deutscher Außenpolitik
- Das Wiedergutmachungsabkommen von 1952
- Die innenpolitische Situation
- Die außenpolitische Situation
- Die Aushandlung des Abkommens
- Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1965
- Die innenpolitische Situation
- Die außenpolitische Situation
- Der Weg bis zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen
- Die Normalisierungsdebatte
- Der Golfkrieg 1991
- Die außenpolitische Situation
- Die innenpolitische Situation
- Das Wiedergutmachungsabkommen von 1952
- Wie weiter?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die deutsch-israelischen Beziehungen im Kontext der deutschen Schuld am Holocaust und der daraus resultierenden Frage nach Sühne. Ziel ist es, die Entwicklung der deutschen Außenpolitik in Bezug auf Israel anhand von vier exemplarischen Beispielen zu analysieren.
- Die Last der deutschen Schuld und die Frage nach Sühne
- Der Spannungsfeld zwischen Moral und Politik
- Die Bedeutung des Wiedergutmachungsabkommens und der Aufnahme diplomatischer Beziehungen
- Die Normalisierungsdebatte und die Herausforderungen des deutsch-israelischen Verhältnisses
- Der Einfluss des Nah-Ost-Konflikts auf die deutsch-israelischen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext der deutsch-israelischen Beziehungen und die besondere Herausforderung der deutschen Schuld am Holocaust. Sie führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Forschungsfrage sowie die Methodik.
Kapitel 2 gibt eine kurze Einführung in die Konflikt- und Interessensituation zwischen Deutschland und Israel. Der Abschnitt 2.1 behandelt die moralische Dimension der deutsch-israelischen Beziehungen und analysiert die Spannung zwischen Schuld und Politik. Abschnitt 2.2 fokussiert auf die internationale Interessenkonstellation und die Rolle des Nah-Ost-Konflikts.
Kapitel 3 analysiert vier konkrete Beispiele aus der Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen. Dazu gehören das Wiedergutmachungsabkommen von 1952, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1965, die Normalisierungsdebatte und der Golfkrieg 1991. Die Darstellung der einzelnen Beispiele umfasst die innenpolitische und außenpolitische Situation sowie die wichtigsten Aspekte der jeweiligen Ereignisse.
Schlüsselwörter
Schuld, Sühne, deutsch-israelische Beziehungen, Wiedergutmachung, Normalisierung, Nah-Ost-Konflikt, Außenpolitik, Moral, Politik, Internationales Interessenfeld, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der Holocaust die deutsch-israelischen Beziehungen?
Die deutsche Schuld am Holocaust bildet das moralische Fundament dieser Beziehungen, woraus die Notwendigkeit von Wiedergutmachung und eine besondere Verantwortung Deutschlands resultieren.
Was war das Wiedergutmachungsabkommen von 1952?
Es war ein Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Staat Israel und der Jewish Claims Conference über materielle Entschädigungen für NS-Verbrechen, das innenpolitisch hoch umstritten war.
Wann nahmen Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen auf?
Die offiziellen diplomatischen Beziehungen wurden erst 1965 aufgenommen, nachdem zuvor jahrelang geheime Kontakte und politische Vorbehalte bestanden hatten.
Was versteht man unter der „Normalisierungsdebatte“?
Die Debatte dreht sich um die Frage, ob und wann die Beziehungen zwischen beiden Ländern als "normal" (wie zu anderen Staaten) angesehen werden können oder ob sie immer "besonders" bleiben müssen.
Welchen Einfluss hatte der Golfkrieg 1991 auf das Verhältnis?
Der Golfkrieg stellte die Beziehungen vor eine Zerreißprobe, da deutsche Technologie im Irak gegen Israel eingesetzt wurde, was zu massiven Spannungen und einer neuen Solidaritätsdebatte führte.
- Citation du texte
- Antje Krüger (Auteur), 1998, Schuld und Sühne als Einflußfaktoren auf die deutsch-israelischen Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17172