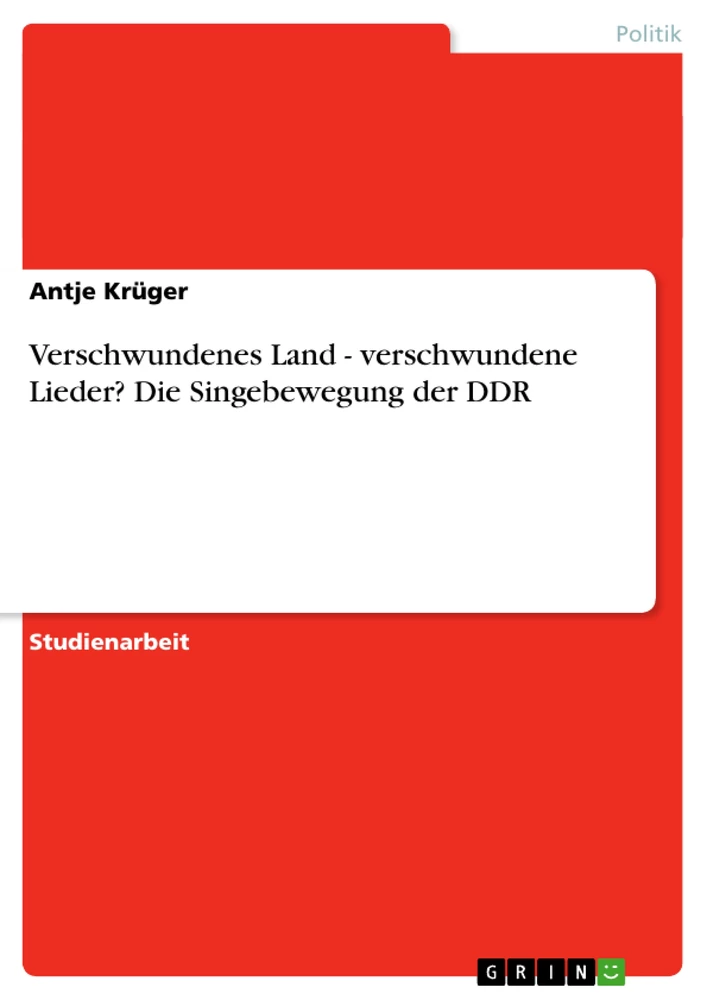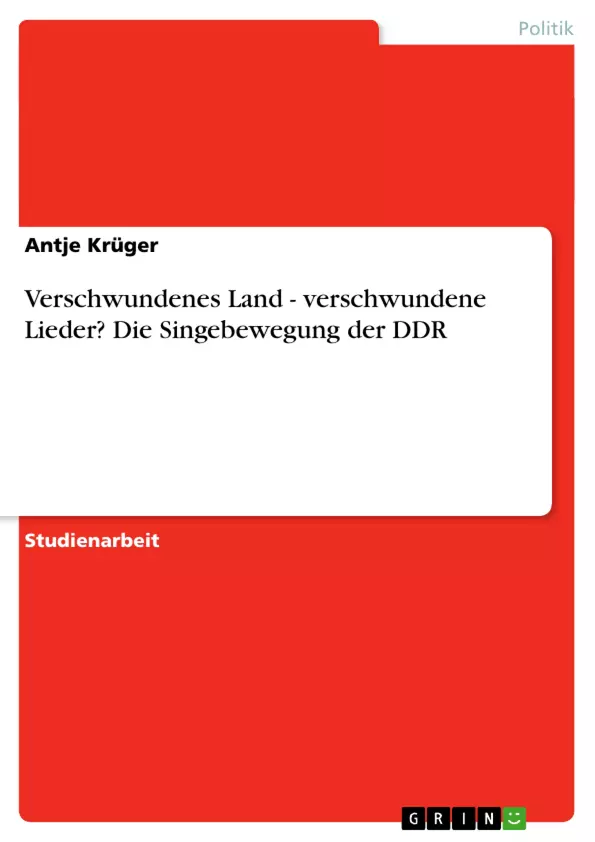„Wo die Lieder sterben, da sterb auch ich ...“. Mit der DDR sind auch ihre Lieder untergegangen, die lauten, plakativen genauso wie die leisen, nachdenklichen. Und wo die Lieder sterben, da stirbt ein Stück Mensch, stirbt Verbundenheit, Identität, sterben Ideen und Träume.
In der DDR wurde viel gesungen, oft als Pflicht, aber häufig auch aus freien Stücken. Das Lied, vor allem das politische Lied, nahm eine besondere Stellung innerhalb der Kulturpolitik ein. Ihm wurde eine Bedeutung zugemessen, die eine Melodie eigentlich nie haben kann. Aber gerade weil es ernst genommen wurde, konnte es groß werden, Werte mitprägen, animieren, abschrecken oder Gemeinschaft schaffen. Die Schizophrenie dieses Staates, der immer tiefer werdende Abgrund zwischen Anspruch und Wirklichkeit spiegelt sich gerade auch in den Liedern wider. Sie waren „Wegbegleiter“, ob man es wollte oder nicht. Sie gehörten zum öffentlichen Leben einfach dazu und wurden auch oft ins private mit übernommen. Es gab Lieder, die man hasste ob ihrer leiernden, lustlosen Wiederholung bei allen offiziellen Veranstaltungen. Und es gab Lieder, deren stille Weisheit, deren Liebe heute noch erstaunt. Mit der Singebewegung entstand in der DDR eine sehr eigene Bewegung, die in ihrer Anfangszeit verhältnismäßig viele Jugendliche mit sich reißen konnte und später Grundstein für sich weiterentwickelnde Musikrichtungen und -tendenzen war. Viele Liedermacher, Folkmusiker, Chansonsänger, Kabarettisten, aber auch Rockmusiker gingen aus ihr hervor. Sie war janusköpfig wie alles in der DDR, hatte eine offizielle, massiv gestützte Seite, die Mitläufer, Karrieristen und sogar Denunzianten anzog. Sie war aber auch immer eine Nische, ermöglichte verdeckte und offene Kritik bis hin am Führungsstil des Politbüros und bot Platz zum Nachdenken und sich Ausprobieren, zum Eingreifen (wenn auch nur bedingt) und zum Mitgestalten.
Der privaten Initiative einiger weniger ist es zu verdanken, dass viele Tonaufnahmen alter Lieder vor der Plattmachwut der Wendesieger und der Apathie der Verlierer nach 1989 gerettet werden konnten.1 Sie sind Zeugnis eines Stückchen Geschichte, hinter dem nicht einfach so die Tür zugeschlagen werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE GROSSE SCHIZOPHRENIE EINES KLEINEN LANDES
- DIE SINGEBEWEGUNG
- Hootenanny - Die Anfänge
- Die Singebewegung
- LIEDERMACHER; LIEDTHEATER; FOLKMUSIK UND ROCK
- Liedtheater
- Folkmusik
- Liedermacher
- Rockmusik
- FESTIVAL DES POLITISCHEN LIEDES
- KLEINES LIED GANZ GROSS
- SCHLUSSWORT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Singebewegung in der DDR, ihre Entwicklung und ihre Bedeutung im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Der Fokus liegt auf der positiven Seite der Bewegung, ihrer kreativen und kritischen Ausdrucksformen. Die Arbeit beleuchtet die Ambivalenz der Bewegung innerhalb des Systems und deren Bedeutung als kultureller Widerstand und Ausdruck individueller und kollektiver Identität.
- Die Schizophrenie der DDR und ihr Ausdruck in der Musik
- Die Entwicklung der Singebewegung von den Anfängen bis zu ihrer Auswirkung auf spätere Musikrichtungen
- Die Rolle des politischen Liedes in der DDR-Kulturpolitik
- Die Ambivalenz der Singebewegung: offizielle Unterstützung und verdeckte Kritik
- Die Bedeutung der Singebewegung für die kulturelle Identität der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
EINLEITUNG: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die These auf, dass die Lieder der DDR, sowohl die offiziellen als auch die inoffiziellen, ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Schizophrenie des Staates sind. Sie betont die Bedeutung der Singebewegung als wichtigen kulturellen und gesellschaftlichen Faktor, der trotz der politischen Einschränkungen Raum für kreativen Ausdruck und Kritik bot. Der Verlust dieser Lieder nach dem Ende der DDR wird als Verlust von Identität und kultureller Erinnerung bedauert, und die Notwendigkeit, dieses Erbe zu bewahren, wird hervorgehoben.
DIE GROSSE SCHIZOPHRENIE EINES KLEINEN LANDES: Dieses Kapitel beschreibt die grundlegende gesellschaftliche und politische Zerrissenheit der DDR. Es analysiert den Widerspruch zwischen dem sozialistischen Ideal und der Realität, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, und wie sich diese Widersprüche in allen Bereichen des Lebens, auch in der Musik, widerspiegelten. Die Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Reaktionen der Bevölkerung auf diese Situation: von engagiertem Widerstand bis zur passiven Anpassung. Die Analyse betont die Komplexität der Situation und die Schwierigkeit, sie mit einfachen Schemata zu erfassen.
Schlüsselwörter
Singebewegung, DDR, Liedermacher, politische Lieder, Folkmusik, Rockmusik, Kulturpolitik, Schizophrenie, Identität, Widerstand, Kritischer Ausdruck, Sozialismus, Realexistierender Sozialismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Singebewegung in der DDR
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Singebewegung in der DDR, ihre Entwicklung und Bedeutung im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Der Fokus liegt auf der positiven Seite der Bewegung, ihren kreativen und kritischen Ausdrucksformen und der Ambivalenz innerhalb des Systems.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Schizophrenie der DDR und ihren Ausdruck in der Musik, die Entwicklung der Singebewegung von den Anfängen bis zu ihren Auswirkungen auf spätere Musikrichtungen, die Rolle des politischen Liedes in der DDR-Kulturpolitik, die Ambivalenz der Singebewegung (offizielle Unterstützung und verdeckte Kritik) und die Bedeutung der Singebewegung für die kulturelle Identität der DDR.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Die große Schizophrenie eines kleinen Landes, Die Singebewegung (inkl. Unterkapitel Hootenanny und Die Singebewegung), Liedermacher; Liedtheater; Folkmusik und Rock (inkl. Unterkapitel Liedtheater, Folkmusik, Liedermacher und Rockmusik), Festival des politischen Liedes, Kleines Lied ganz groß und Schlusswort.
Wie wird die Singebewegung in der Arbeit charakterisiert?
Die Singebewegung wird als wichtiger kultureller und gesellschaftlicher Faktor beschrieben, der trotz politischer Einschränkungen Raum für kreativen Ausdruck und Kritik bot. Ihre Ambivalenz zwischen offizieller Unterstützung und verdeckter Kritik wird hervorgehoben. Der Verlust der Lieder nach dem Ende der DDR wird als Verlust von Identität und kultureller Erinnerung bedauert.
Welche Rolle spielt die "Schizophrenie" der DDR in der Arbeit?
Die "Schizophrenie" der DDR, also der Widerspruch zwischen sozialistischem Ideal und Realität, wird als zentraler Aspekt betrachtet, der sich in der Musik und der Singebewegung widerspiegelt. Die unterschiedlichen Reaktionen der Bevölkerung – von Widerstand bis Anpassung – werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Singebewegung, DDR, Liedermacher, politische Lieder, Folkmusik, Rockmusik, Kulturpolitik, Schizophrenie, Identität, Widerstand, Kritischer Ausdruck, Sozialismus, Realexistierender Sozialismus.
Was ist die zentrale These der Einleitung?
Die Lieder der DDR, sowohl die offiziellen als auch die inoffiziellen, spiegeln die gesellschaftliche Schizophrenie des Staates wider. Die Singebewegung bot trotz politischer Einschränkungen Raum für kreativen Ausdruck und Kritik und ihr Erhalt ist von Bedeutung.
Wie wird das Kapitel "Die große Schizophrenie eines kleinen Landes" beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt die gesellschaftliche und politische Zerrissenheit der DDR, den Widerspruch zwischen Ideal und Realität und wie sich dieser in allen Lebensbereichen, inklusive der Musik, widerspiegelte. Es analysiert die Reaktionen der Bevölkerung auf diese Situation.
- Citation du texte
- Antje Krüger (Auteur), 1999, Verschwundenes Land - verschwundene Lieder? Die Singebewegung der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17173