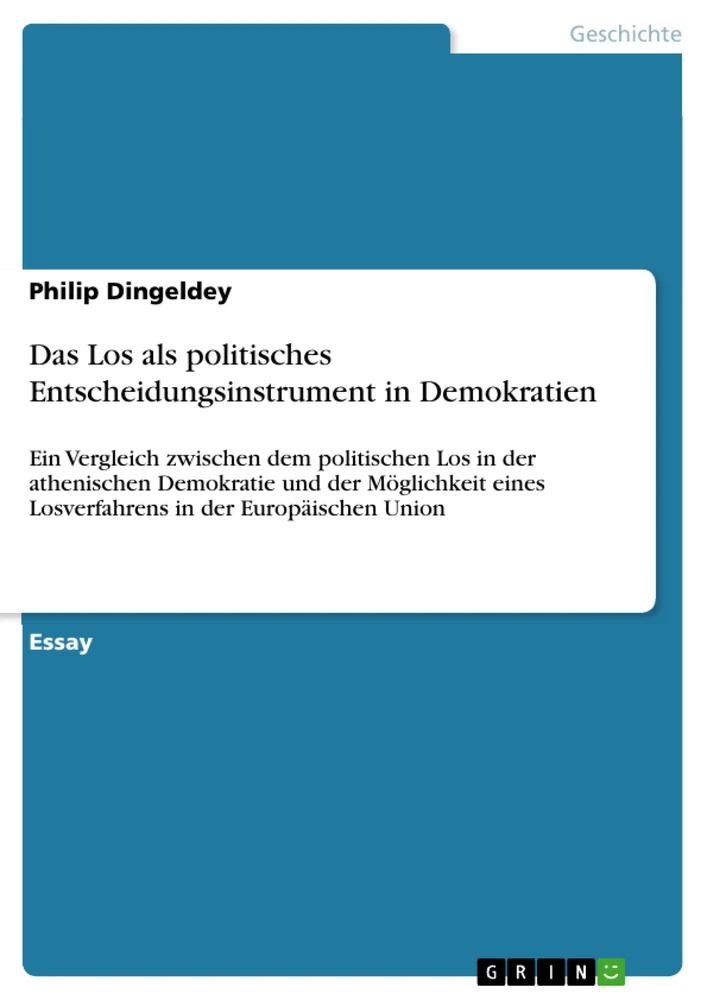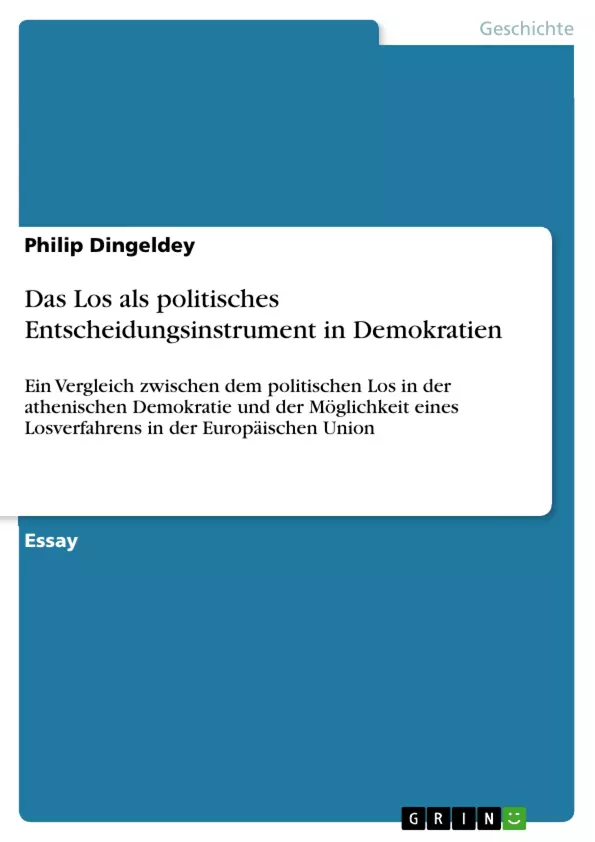Als einer der größten Unterschiede zwischen der gegenwärtigen, repräsentativen und der antiken, direkten Demokratie gilt das Losverfahren, das heute als undemokratisch verworfen wird, da so dem Wähler vom Zufall die Wahl genommen werden würde. Dennoch behauptet der Politologe Buchstein, dass das antike, demokratische Losverfahren Athens sich teils in die Gegenwart und besonders in die Europäische Union (EU) integrieren ließe ; erstens, wegen ihres sui generis-Charakters, da sie keine gewöhnliche Staatsform sei und sich so das Losver-fahren leichter eingliedern ließe, als in andere Repräsentativsysteme und zweitens, um dort dem Demokratiedefizit effektiv entgegenzuwirken .
So soll die Frage dieses Essays lauten, ob und wenn ja, inwiefern sich ein demokratisches Losverfahren, wie das der attischen Demokratie, auf die EU - um diese zu demokratisieren - übertragen ließe. Dass diverse publizistische Beiträge immer wieder auch Elemente der atti-schen Demokratie generell für die Gegenwart aufgreifen, zeigt, dass solche Fragestellungen nicht rein akademisch sind .
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Aufwerfen der Frage, ob das Losverfahren in heutigen Demokratien noch anwendbar ist
- Das Losverfahren in der attischen Demokratie
- Arten und Techniken des demokratischen, antiken Losens
- Das Los und die politischen Ämter
- Das Los und die Boule
- Das Los und die Beamtenschaft
- Das Los und die Dikasterien
- Das Los und die Nomothesie
- Kurzes Zwischenfazit
- Das Los im gesellschaftlichen Bewusstsein des antiken Athens
- Das Losverfahren als Verbesserungsvorschlag gegen das Demokratiedefizit der EU
- Das Demokratiedefizit in der EU
- Definition: Demokratiedefizit in der EU
- Problemanalyse des Demokratiedefizits in der EU
- Das Losverfahren zur Verbesserung des EU-Demokratiedefizits?
- Die Auslosung der die Kommissare stellenden Länder
- Auslosung der Ausschussmitglieder, -vorsitzenden und -berichterstatter im Europäischen Parlament
- Eine zweite Loskammer des Europäischen Parlaments
- Das Demokratiedefizit in der EU
- Fazit
- Fazit zum antiken demokratischen Los für die Gegenwart
- Fazit zum demokratischen Los für die EU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Anwendbarkeit des antiken attischen Losverfahrens in modernen Demokratien, insbesondere in der Europäischen Union. Die zentrale Frage ist, ob und wie das Losverfahren zur Bekämpfung des Demokratiedefizits in der EU beitragen könnte. Der Vergleich mit dem antiken System dient als Grundlage für die Bewertung der Machbarkeit und der potenziellen Auswirkungen einer solchen Reform.
- Das attische Losverfahren und seine Funktionsweise
- Das Demokratiedefizit der Europäischen Union
- Potenzielle Anwendung des Losverfahrens in der EU
- Vor- und Nachteile eines Losverfahrens in modernen Demokratien
- Vergleich zwischen antiker und moderner Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Aufwerfen der Frage, ob das Losverfahren in heutigen Demokratien noch anwendbar ist: Das Vorwort führt in die zentrale Fragestellung des Essays ein: die Übertragbarkeit des antiken attischen Losverfahrens auf die moderne, repräsentative Demokratie der EU. Es wird die These aufgestellt, dass das Losverfahren, entgegen der gängigen Auffassung, in der EU zur Bekämpfung des Demokratiedefizits beitragen könnte, aufgrund des sui generis Charakters der EU und der Notwendigkeit, dem Demokratiedefizit entgegenzuwirken. Der Essay skizziert den Aufbau, beginnend mit der Analyse des attischen Systems und fortfahrend mit einer Untersuchung des Demokratiedefizits in der EU und möglichen Lösungsansätzen durch das Losverfahren.
Das Losverfahren in der attischen Demokratie: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Losverfahren in der attischen Demokratie. Es werden die verschiedenen Arten und Techniken des Losens erklärt, von einfachen Bohnen bis hin zu komplexen Losmaschinen (Klêrôtêria). Die Rolle des Loses bei der Besetzung politischer Ämter (Boule, Beamtenschaft, Dikasterien, Nomothesie) wird analysiert, ebenso wie der gesellschaftliche Kontext und die Bedeutung des Losverfahrens für das Verständnis von Gleichheit in der attischen Demokratie. Die Kapitel unterstreichen die Verbindung zwischen dem Losverfahren, dem Rotationsprinzip und der umfassenden Beteiligung der Bürgerschaft an der politischen Entscheidungsfindung. Es wird herausgearbeitet, dass das Losverfahren nicht nur ein zufälliges Auswahlverfahren darstellte, sondern ein integraler Bestandteil des demokratischen Systems war, das die Gleichheit der Bürger betonte.
Das Losverfahren als Verbesserungsvorschlag gegen das Demokratiedefizit der EU: In diesem Kapitel wird das Demokratiedefizit der EU definiert und analysiert. Es werden konkrete Vorschläge zur Einführung des Losverfahrens zur Verbesserung der demokratischen Legitimität und Partizipation in der EU diskutiert. Dies umfasst die Auslosung der Kommissare stellenden Länder, die Auslosung von Ausschussmitgliedern im Europäischen Parlament und sogar die Idee einer zweiten Loskammer. Das Kapitel analysiert die potenziellen Vorteile und Herausforderungen der Umsetzung eines solchen Systems und reflektiert kritisch die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung des antiken Modells auf die heutige EU. Die Diskussion beinhaltet die Frage, inwieweit ein Losverfahren die Repräsentativität und die politische Beteiligung verbessern kann und ob es mit den bestehenden institutionellen Strukturen der EU vereinbar ist.
Schlüsselwörter
Attische Demokratie, Losverfahren, Klêrôtêria, Demokratiedefizit, Europäische Union, politische Partizipation, Repräsentation, Gleichheit, Kommissare, Europäisches Parlament, antike Staatsform, Moderne Demokratie.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Das Losverfahren in der attischen Demokratie und seine Anwendbarkeit auf die Europäische Union
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht die Anwendbarkeit des antiken attischen Losverfahrens in modernen Demokratien, insbesondere in der Europäischen Union. Die zentrale Frage ist, ob und wie das Losverfahren zur Bekämpfung des Demokratiedefizits in der EU beitragen könnte.
Welche Aspekte des attischen Losverfahrens werden behandelt?
Der Essay beschreibt detailliert das attische Losverfahren, einschließlich der Arten und Techniken des Losens, seiner Rolle bei der Besetzung politischer Ämter (Boule, Beamtenschaft, Dikasterien, Nomothesie) und seiner gesellschaftlichen Bedeutung im antiken Athen. Die Verbindung zwischen Losverfahren, Rotationsprinzip und der Beteiligung der Bürgerschaft wird hervorgehoben.
Wie wird das Demokratiedefizit der EU definiert und analysiert?
Der Essay definiert und analysiert das Demokratiedefizit der EU. Es werden konkrete Probleme und Herausforderungen der EU-Demokratie beleuchtet.
Welche konkreten Vorschläge zur Einführung des Losverfahrens in der EU werden gemacht?
Es werden konkrete Vorschläge zur Einführung des Losverfahrens zur Verbesserung der demokratischen Legitimität und Partizipation in der EU diskutiert. Dies beinhaltet die Auslosung der Kommissare stellenden Länder, die Auslosung von Ausschussmitgliedern im Europäischen Parlament und die Idee einer zweiten Loskammer.
Welche Vor- und Nachteile eines Losverfahrens in modernen Demokratien werden diskutiert?
Der Essay analysiert die potenziellen Vorteile und Herausforderungen der Umsetzung eines Losverfahrens in der EU, unter Berücksichtigung der Vereinbarkeit mit den bestehenden institutionellen Strukturen.
Wie wird der Vergleich zwischen antiker und moderner Demokratie gezogen?
Der Essay vergleicht das antike attische Losverfahren mit der modernen repräsentativen Demokratie der EU, um die Übertragbarkeit und die potenziellen Auswirkungen einer solchen Reform zu bewerten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Essay?
Schlüsselwörter sind: Attische Demokratie, Losverfahren, Klêrôtêria, Demokratiedefizit, Europäische Union, politische Partizipation, Repräsentation, Gleichheit, Kommissare, Europäisches Parlament, antike Staatsform, Moderne Demokratie.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay umfasst ein Vorwort, ein Kapitel über das Losverfahren in der attischen Demokratie, ein Kapitel über das Losverfahren als Verbesserungsvorschlag für das Demokratiedefizit der EU und ein Fazit. Jedes Kapitel wird detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Was ist die zentrale These des Essays?
Die zentrale These ist, dass das Losverfahren, entgegen der gängigen Auffassung, in der EU zur Bekämpfung des Demokratiedefizits beitragen könnte, aufgrund des sui generis Charakters der EU und der Notwendigkeit, dem Demokratiedefizit entgegenzuwirken.
Für wen ist dieser Essay relevant?
Dieser Essay ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die sich mit Fragen der politischen Partizipation, der Repräsentation und des Demokratiedefizits in der EU befassen.
- Quote paper
- Philip Dingeldey (Author), 2011, Das Los als politisches Entscheidungsinstrument in Demokratien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171867