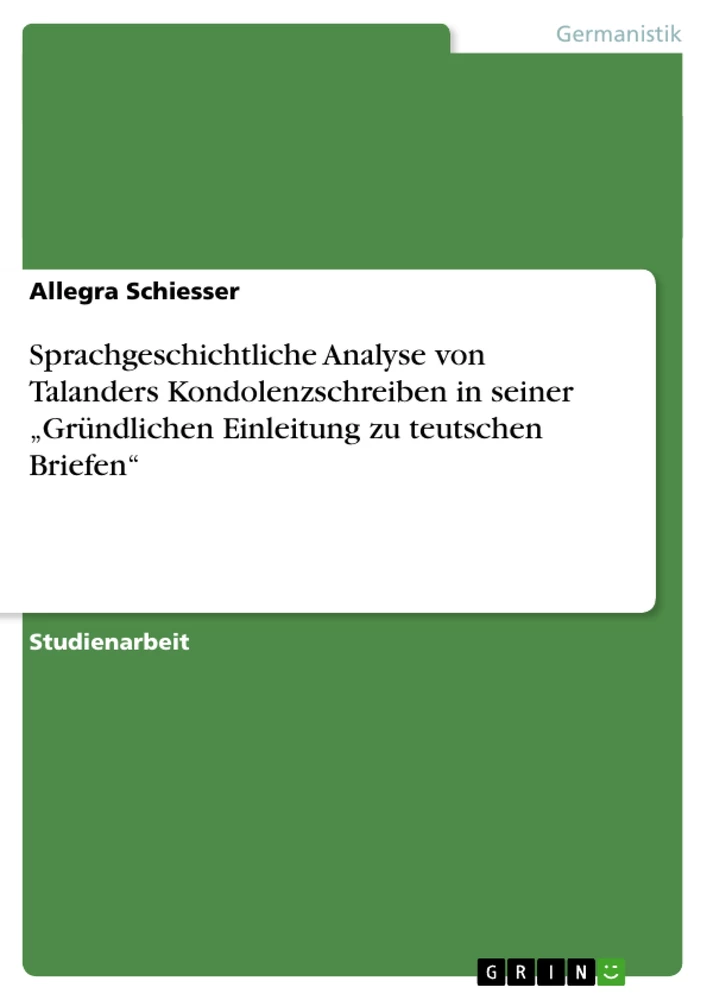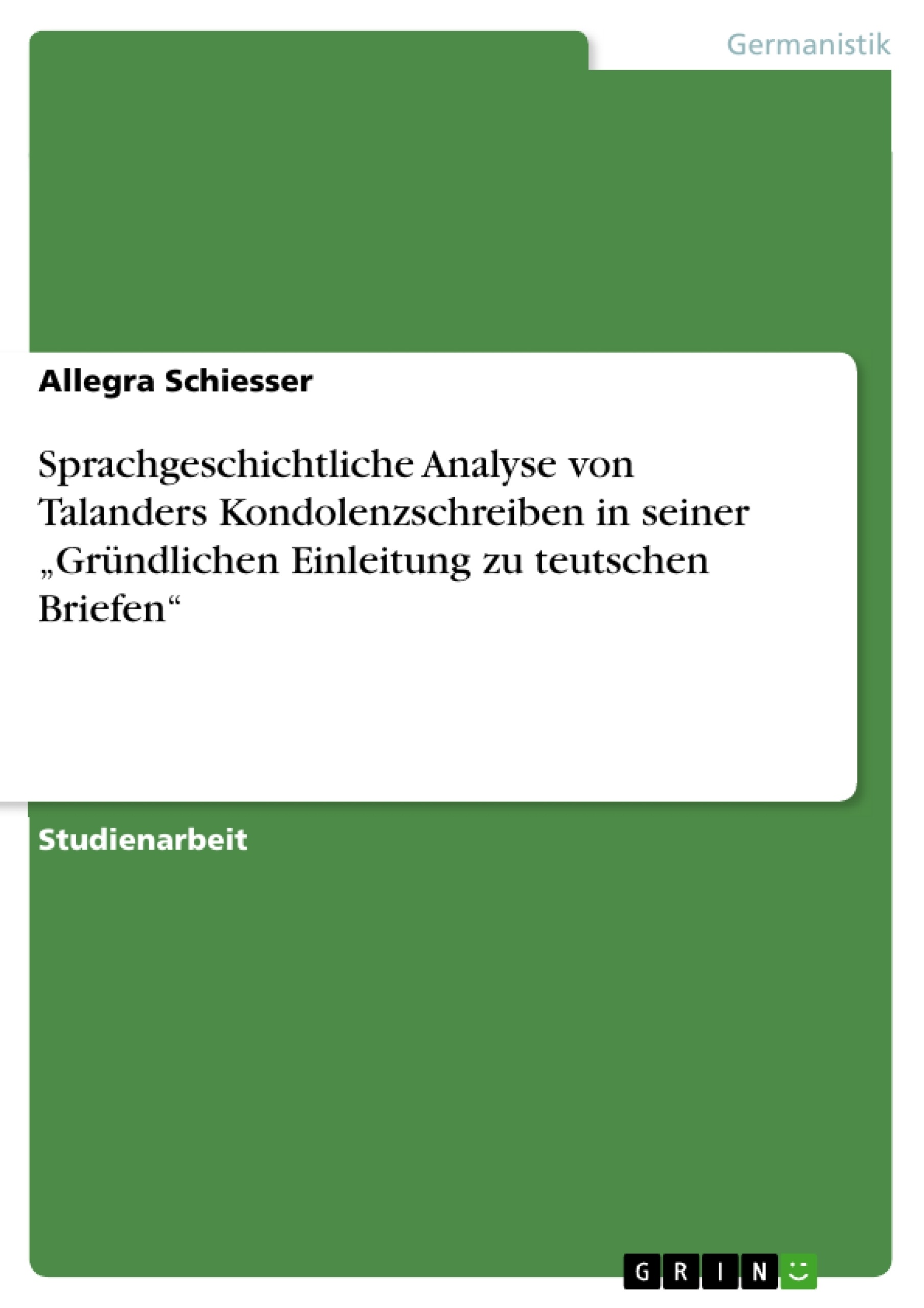Im zu untersuchenden Textauschnitt, einem Kapitel aus Talanders „Gründlicher Einleitung
zu teutschen Briefen“ (1706), wird in einer kurzen Einleitung zuerst Auskunft
darüber gegeben, was die Grundzüge von Kondolenzschreiben seien, danach werden
sechs Briefbeispiele angeführt.
Neben dem Titelblatt ist auf einem Stich ein Garten zu sehen, der absolutistisch genau
angeordnet ist, was darauf schliessen lässt, dass die Quelle historisch in den Barock einzuordnen
ist. Auf einem Banner im Stich steht „cuique“, was man mit „jedem“ oder „für
jeden“ übersetzen kann. Das deutet darauf hin, dass Talander seine Anleitung zum Briefeschreiben
nicht für den Adel, sondern vor allem auch für das Bürgertum konzipiert
hat. Diese Vermutung wird noch bestärkt durch die letzten drei Briefbeispiele, in denen
der Empfänger mit „Patron“ angesprochen wird.
Sprachgeschichtlich ist der Ausschnitt zum Deutsch der mittleren Neuzeit zu rechnen
(Vgl. Schmidt 2007, 127 ff.). Das damalige Deutsch unterscheidet sich in vielerlei
Hinsicht vom heutigen Deutsch, besonders in der Orthographie und dem Wortschatz,
aber auch in der Satzstruktur und der Morphematik. Das Ziel meiner Arbeit ist es, den
Text unter folgenden Aspekten zu untersuchen:
Ich werde kurz auf den Text als Quelle zu sprechen kommen und danach auf den
Textsortenbegriff eingehen, da der vorliegende Text einerseits sehr deutlich einer
Textsorte zugerechnet werden kann, andererseits eine zweite Textsorte enthält, was eine
spannende Konstellation ist. Unter soziopragmatischem Gesichtspunkt werde ich die
Anreden und Höflichkeitsformen in den Briefbeispielen untersuchen und Syntax,
Semantik sowie graphematische Aspekte der Quelle näher betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Textausschnitt als Quelle
- 3. Zur Quelle unter dem Aspekt der Textsorte
- 4. Anreden und Höflichkeitsformen
- 5. Syntax und Semantik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert einen Textausschnitt aus Talanders „Gründlicher Einleitung zu teutschen Briefen“ (1706), der sich mit Kondolenzschreiben befasst. Ziel ist die sprachgeschichtliche Untersuchung des Textes unter verschiedenen Aspekten.
- Analyse des Textausschnitts als Quelle für die mittlere Neuzeit
- Untersuchung der Textsorte (Anleitungstext und Briefbeispiele)
- Analyse von Anreden und Höflichkeitsformen im Hinblick auf soziale Kontexte
- Betrachtung syntaktischer und semantischer Besonderheiten
- Einordnung der sprachlichen Merkmale in den Kontext des Sprachwandels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Textausschnitt aus Talanders „Gründlicher Einleitung zu teutschen Briefen“ (1706), der eine Einführung in Kondolenzschreiben mit Beispielen bietet. Sie skizziert die sprachgeschichtliche Einordnung des Textes in die mittlere Neuzeit und benennt die Untersuchungsaspekte: den Text als Quelle, den Textsortenbegriff, soziopragmatische Aspekte der Anreden und Höflichkeitsformen sowie Syntax, Semantik und graphematische Merkmale. Der Hinweis auf den Stich mit dem „cuique“-Banner deutet auf eine Zielgruppe jenseits des Adels hin.
2. Zum Textausschnitt als Quelle: Dieses Kapitel betrachtet den Textausschnitt als historische Quelle, die sprachliche Zeugnisse der damaligen Zeit liefert. Es wird die Relevanz der Quellenintention diskutiert und der Textausschnitt als Anleitungstext mit Briefbeispielen eingeordnet. Die Analyse betont den dualen Charakter des Textes: als Performanzfragment (Sprache in Anleitungstexten) und als primäres Performanzarchiv (sprachreflexiv und sprachnormativ durch die Bewertung der Briefbeispiele). Die Analyse des Aussagewerts im Bezug zum Erkenntnisinteresse ist zentral.
3. Zur Quelle unter dem Aspekt der Textsorte: Dieses Kapitel analysiert den Text unter dem Gesichtspunkt der Textsorte und deren Relevanz für die Sprachwandelforschung. Es werden die Begriffe Textsorte, Textklasse und Texttyp erläutert und ihre Bedeutung für die Klassifizierung des Textes hervorgehoben. Der Textausschnitt wird zweifach klassifiziert: als Anleitungstext (Anleitung zum Schreiben von Briefen, speziell Kondolenzschreiben) und als Sammlung von Briefbeispielen (schriftliche Kommunikation – Brief – Kondolenzbrief). Die Bedeutung von Textsortenwandel im Kontext von Mikrowandel und Makrowandel wird ebenfalls angesprochen.
4. Anreden und Höflichkeitsformen: Dieses Kapitel untersucht die Anreden und Höflichkeitsformen in den Briefbeispielen. Der scheinbar inklusive Anspruch ("cuique") wird durch die höflichen Anreden relativiert, die auf eine bürgerliche Zielgruppe hindeuten. Die Analyse der Anreden (z.B. "Wohledler, insonders hochgeehrter Herr Better", "Mademoiselle", "hochedler-Best und hochgelahrter herr") offenbart soziale Unterschiede und Ungleichheiten in der Anrede von Männern und Frauen. Die Verwendung von indirektem Erzen und Siezen wird im Kontext des Sprachwandels diskutiert. Das häufige Weglassen des Personalpronomens "ich" wird als indirekte Höflichkeitsform oder Autorenbescheidenheit interpretiert.
5. Syntax und Semantik: Das Kapitel vergleicht die Syntax und Semantik des Textes mit der heutigen deutschen Sprache. Obwohl die Grundstruktur der Sätze ähnlich ist, werden Unterschiede im Wortschatz und der Bedeutung einzelner Wörter hervorgehoben. Eine detaillierte Analyse der konkreten syntaktischen und semantischen Unterschiede wird jedoch nicht im gegebenen Textauszug geliefert.
Schlüsselwörter
Kondolenzschreiben, Talander, mittlere Neuzeit, Sprachgeschichte, Textsorte, Anrede, Höflichkeitsformen, Syntax, Semantik, Sprachwandel, Soziolinguistik, Brief, Anleitungstext, Barock.
Häufig gestellte Fragen zu Talanders „Gründlicher Einleitung zu teutschen Briefen“ (1706)
Was ist der Gegenstand dieser sprachwissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert einen Textausschnitt aus Johann Georg Talanders „Gründlicher Einleitung zu teutschen Briefen“ (1706), der sich mit Kondolenzschreiben befasst. Der Fokus liegt auf der sprachgeschichtlichen Untersuchung des Textes unter verschiedenen Aspekten.
Welche Aspekte des Textauszugs werden untersucht?
Die Analyse umfasst folgende Punkte: den Textausschnitt als Quelle für die mittlere Neuzeit, die Textsorte (Anleitungstext und Briefbeispiele), die soziopragmatischen Aspekte der Anreden und Höflichkeitsformen, sowie syntaktische und semantische Besonderheiten und die Einordnung der sprachlichen Merkmale in den Kontext des Sprachwandels.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, der Textausschnitt als Quelle, der Textausschnitt unter dem Aspekt der Textsorte, Anreden und Höflichkeitsformen, sowie Syntax und Semantik. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung des jeweiligen Analyseabschnitts.
Was ist das zentrale Ergebnis der Analyse des Textauszugs als Quelle?
Der Textausschnitt wird als historische Quelle mit sprachlichen Zeugnissen der mittleren Neuzeit betrachtet. Seine Bedeutung liegt im dualen Charakter als Performanzfragment (Sprache in Anleitungstexten) und primäres Performanzarchiv (sprachreflexiv und sprachnormativ durch die Bewertung der Briefbeispiele). Die Quellenintention und der Aussagewert im Bezug zum Erkenntnisinteresse werden diskutiert.
Wie wird die Textsorte des Auszugs klassifiziert?
Der Textausschnitt wird zweifach klassifiziert: als Anleitungstext (Anleitung zum Schreiben von Briefen, speziell Kondolenzschreiben) und als Sammlung von Briefbeispielen (schriftliche Kommunikation – Brief – Kondolenzbrief). Die Bedeutung von Textsortenwandel im Kontext von Mikrowandel und Makrowandel wird ebenfalls thematisiert.
Welche Erkenntnisse liefert die Analyse der Anreden und Höflichkeitsformen?
Die Analyse der Anreden (z.B. "Wohledler, insonders hochgeehrter Herr Better", "Mademoiselle", "hochedler-Best und hochgelahrter herr") zeigt soziale Unterschiede und Ungleichheiten in der Anrede von Männern und Frauen auf. Der scheinbar inklusive Anspruch wird durch die höflichen Anreden relativiert, die auf eine bürgerliche Zielgruppe hindeuten. Die Verwendung von indirektem Erzen und Siezen und das häufige Weglassen des Personalpronomens "ich" werden im Kontext des Sprachwandels diskutiert.
Welche syntaktischen und semantischen Unterschiede zum heutigen Deutsch werden festgestellt?
Obwohl die Grundstruktur der Sätze ähnlich ist, werden Unterschiede im Wortschatz und der Bedeutung einzelner Wörter hervorgehoben. Eine detaillierte Analyse der konkreten syntaktischen und semantischen Unterschiede wird jedoch nicht im gegebenen Textauszug geliefert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Kondolenzschreiben, Talander, mittlere Neuzeit, Sprachgeschichte, Textsorte, Anrede, Höflichkeitsformen, Syntax, Semantik, Sprachwandel, Soziolinguistik, Brief, Anleitungstext, Barock.
- Quote paper
- Allegra Schiesser (Author), 2007, Sprachgeschichtliche Analyse von Talanders Kondolenzschreiben in seiner „Gründlichen Einleitung zu teutschen Briefen“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171885