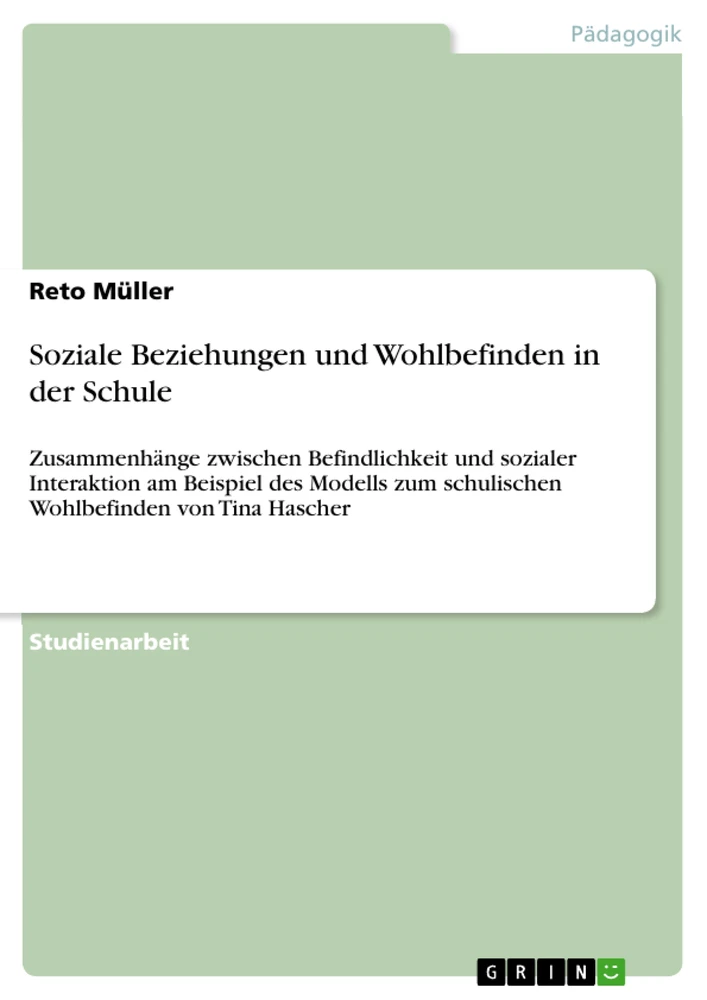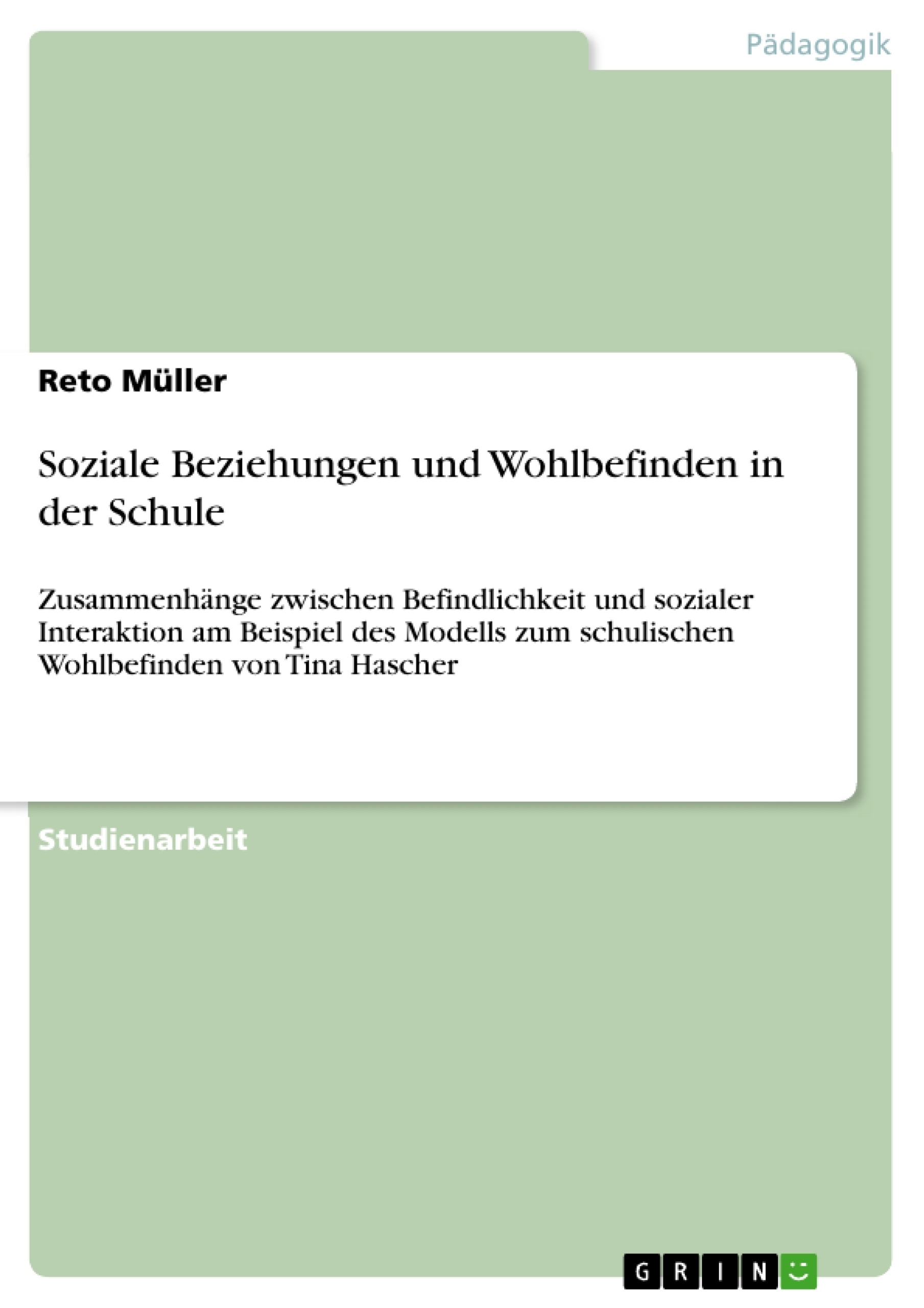Auf die Veröffentlichung der Ergebnisse der von der OECD durchgeführten ersten PISA-Studie im Jahre 2001 folgte der sogenannte PISA-Schock für Länder, deren Resultate schulischer Bildungsbemühungen im internationalen Leistungsvergleich kein gutes Bild abgaben. In bildungspolitischen und erziehungswissenschaftlichen Kreisen wurde bald eine Debatte lanciert, die unter anderen auch der Frage nachging, was denn „eine gute und gesunde Schule“ sei bzw. was eine solche auszeichne. Im Zuge der entfesselten Diskussion wurde hervorgehoben, dass positive Emotionen und Wohlbefinden Lernprozesse begünstigen und dass die Lehr-Lern-Atmosphäre im Unterricht ebenso die zwischenmenschlichen Beziehungen vermittelnde Faktoren für gelingende Lernprozesse darstellen. Diese Feststellung und die Bedeutung der Emotionen für die Einleitung und Speicherung von Lernprozessen werden mittlerweile durch Forschungsergebnisse der neurobiologischen Gehirnforschung gestützt (z.B. Bauer, 2008; Spitzer, 2007).
Ausgehend von den Forschungen zum schulischen Wohlbefinden von Tina Hascher (1996-1999) soll die vorliegende Literaturarbeit klären, was aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive unter „Wohlbefinden in der Schule“ verstanden wird, welche Funktionen schulischem Wohlbefinden zugeschrieben werden und welche Bedeutung den sozialen Interaktionen zukommt.
Speziell interessieren die Rolle der Lehrpersonen und die Handlungsempfehlungen, die sich aus wissenschaftlichen Erkenntnissen für sie ableiten lassen.
Die das Erkenntnisinteresse leitende Frage lautet: Welche Zusammenhänge werden im Modell des schulischen Wohlbefindens (von Tina Hascher) zwischen sozialen Beziehungen/Interaktionen und der Befindlichkeit von SchülerInnen der Sekundarstufe I beleuchtet und welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für die pädagogische Praxis ableiten?
Diese Untersuchung der Zusammenhänge zwischen sozialer Interaktion im Unterricht und der Befindlichkeit von SchülerInnen der Sekundarstufe I ist ein Beitrag zum vertieften Verständnis von schulischem Lernen. Die Auseinandersetzung soll, in Anlehnung an Fend und Sandmeier (2004), zeigen, dass Wohlbefinden in der Schule kein Ziel pädagogischen Handelns, sondern vielmehr als Folge eines gelungenen pädagogischen Prozesses zu verstehen ist; ein Erziehungs- und Bildungsprozess, der sich auf die bestmögliche Förderung jener Fähigkeiten ausrichtet, welche eine produktive Lebensführung ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ausgangslage (Problemstellung)
- 1.2 Fragestellung
- 1.3 Relevanz des Themas für die pädagogisch-psychologisch orientierte Schulqualitäts- und Bildungsforschung
- 1.4 Aufbau der Arbeit - Kapitelinhalte
- 2. Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern auf Sekundarstufe I
- 2.1 Einschätzung des Theoriebezugs der vorliegenden Arbeit
- 2.1.1 Theoretische Grundlagen
- 2.1.2 Wohlbefinden in der Schule – Gegenwärtiger Forschungsstand
- 2.2 Das Modell zum schulischen Wohlbefinden von Tina Hascher
- 2.2.1 Schulisches Wohlbefinden - Definition, Funktionen und Bedeutung
- 2.2.2 Zusammenhänge zwischen sozialen Beziehungen und Wohlbefinden in der Schule
- 2.2.3 Die Bedeutung der Lehrpersonen für das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I
- 2.1 Einschätzung des Theoriebezugs der vorliegenden Arbeit
- 3 Zusammenfassende Diskussion und Beantwortung der Fragestellung
- 3.1 Beantwortung der Fragestellung
- 3.2 Pädagogisch-didaktische Schlussfolgerungen
- 3.3 Resümee
- 4 Offene Frage und ein Desiderat für zukünftige Forschung
- 5 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Literaturarbeit setzt sich zum Ziel, den Einfluss sozialer Beziehungen auf das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I zu untersuchen, insbesondere im Kontext des Modells zum schulischen Wohlbefinden von Tina Hascher. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des schulischen Wohlbefindens, die Rolle der Lehrpersonen und die Zusammenhänge zwischen sozialer Interaktion und der emotionalen Befindlichkeit von Schülerinnen.
- Schulisches Wohlbefinden und seine Bedeutung für die schulische Entwicklung
- Die Bedeutung von sozialen Beziehungen für das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern
- Die Rolle der Lehrpersonen im Kontext von schulischem Wohlbefinden
- Handlungs- und Handlungsempfehlungen für die pädagogische Praxis
- Zusammenhänge zwischen sozialen Beziehungen, schulischem Wohlbefinden und der Befindlichkeit von Schülerinnen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des schulischen Wohlbefindens ein und stellt die Problemstellung sowie die Fragestellung der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas für die pädagogisch-psychologisch orientierte Schulqualitäts- und Bildungsforschung.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern auf Sekundarstufe I. Es werden die theoretischen Grundlagen des schulischen Wohlbefindens erörtert und der gegenwärtige Forschungsstand beleuchtet. Das Modell zum schulischen Wohlbefinden von Tina Hascher wird vorgestellt und die Bedeutung von sozialen Beziehungen sowie die Rolle der Lehrpersonen für das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I im Detail analysiert.
Das dritte Kapitel bietet eine zusammenfassende Diskussion und beantwortet die Fragestellung der Arbeit. Es werden pädagogisch-didaktische Schlussfolgerungen gezogen und ein Resümee der Arbeit präsentiert.
Schlüsselwörter
Schulqualität, Bildungsforschung, Wohlbefinden, soziale Beziehungen, Interaktionen, Befindlichkeit, Schülerinnen, Sekundarstufe I, Lehrpersonen, Tina Hascher, Modell zum schulischen Wohlbefinden, pädagogische Praxis, Handlungsempfehlungen, emotionale Befindlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "PISA-Schock"?
Der PISA-Schock bezeichnet die Reaktion auf die erste OECD-PISA-Studie im Jahr 2001, bei der viele Länder im internationalen Leistungsvergleich schlechter abschnitten als erwartet.
Welche Rolle spielt das Modell von Tina Hascher in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt Haschers Modell, um den Zusammenhang zwischen sozialen Beziehungen und dem Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I zu untersuchen.
Ist schulisches Wohlbefinden ein direktes Ziel pädagogischen Handelns?
Nein, laut der Arbeit ist Wohlbefinden eher als Folge eines gelungenen pädagogischen Prozesses zu verstehen, der die Fähigkeiten zur produktiven Lebensführung fördert.
Welche Bedeutung haben Lehrpersonen für das Wohlbefinden der Schüler?
Lehrpersonen sind zentrale Akteure, da die Qualität der sozialen Interaktion und die Lehr-Lern-Atmosphäre im Unterricht maßgeblich das Wohlbefinden beeinflussen.
Wie unterstützen neurowissenschaftliche Erkenntnisse diese Thematik?
Die Forschung zeigt, dass positive Emotionen für die Einleitung und Speicherung von Lernprozessen im Gehirn essenziell sind.
- Citation du texte
- Reto Müller (Auteur), 2011, Soziale Beziehungen und Wohlbefinden in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172613