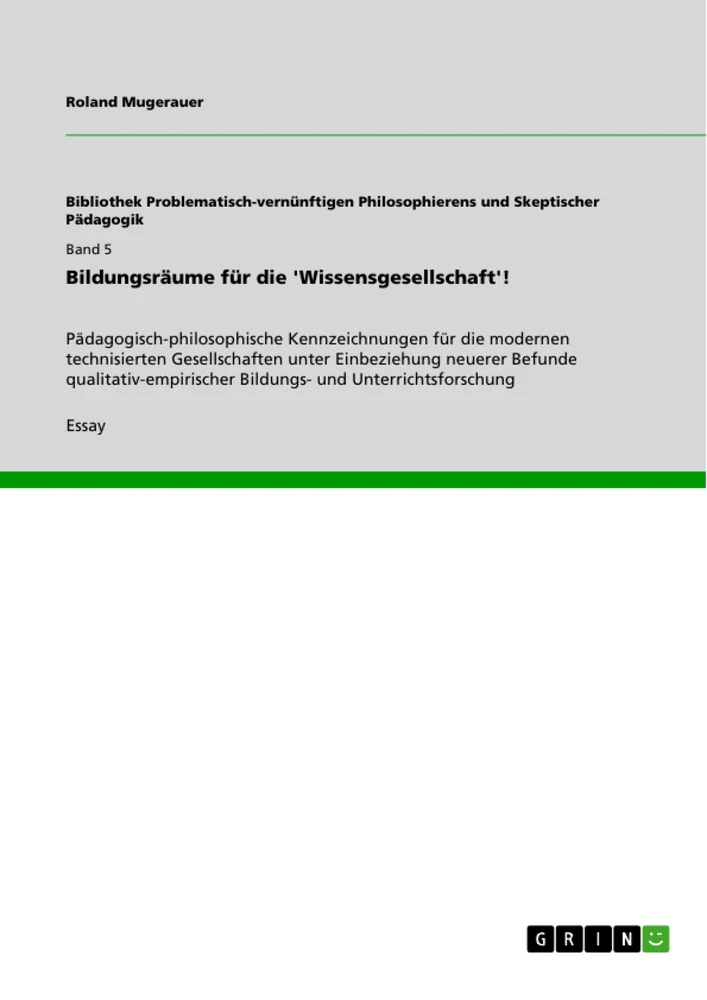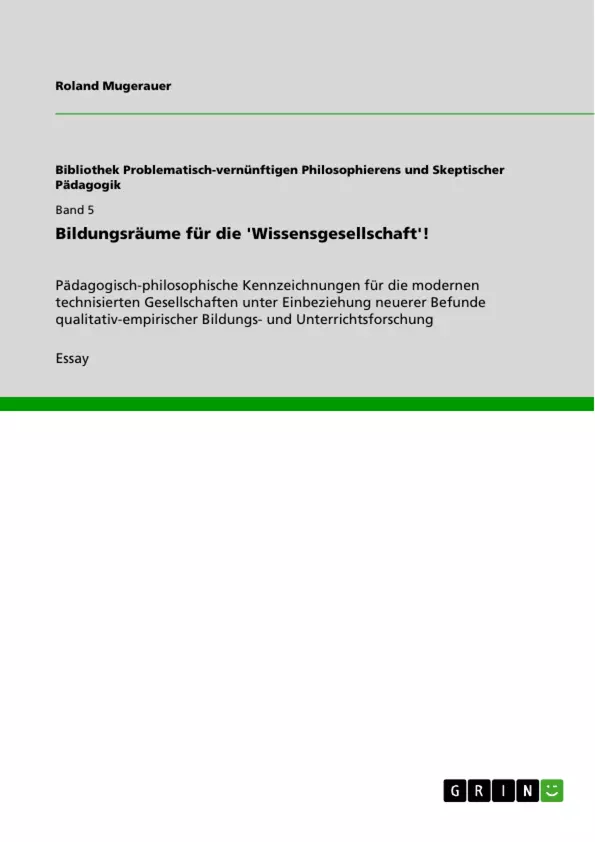(Abstract in English, but text in German) Which approaches to learning and formation of knowledge (“Bildungsräume”) and understanding exist in today’s technologically oriented „knowledge society“ and which approaches will be required to sustain this society? Guided by the analysis of three key terms on this topic ”knowledge,” “learning“ and “orientation“, I am investigating the pedagogical and philosophical aspects and extracting the type of knowledge and Bildung that will be needed. Furthermore, I outline additional pedagogical research themes. This investigation includes recent qualitative and empirical research, as well as neglected approaches of Plato’s philosophy.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wissen
- Die modernen Gesellschaften als 'Wissens- und Informationsgesellschaften' und die Pädagogik
- Die Wissensgesellschaft und die Relevanz der Frage nach dem Wissen
- Die Frage: Was bedeutet Wissen?
- Die Frage nach dem Wissen und seinen Bedingungen und ein erster kurzer Blick auf Platon
- Eine zweiteilige Annahme als Antwort auf die Frage nach dem Wissen
- Der erste Teil der Antwort auf die Frage nach dem Wissen (nebst dreier bildungsbedeutsamer Probleme, die sich daraus ergeben): Die Bindung des Wissens an die Person
- Der zweite Teil der Antwort auf die Frage nach dem Wissen: Das 'Herzstück' von Wissen als Sachkompetenz
- Lernen
- Charakteristika eines an persongebundenem Wissen ausgerichteten Lernprozesses
- Konsequenzen eines sachkompetenzorientierten Wissenserwerbs für das Verständnis des Lehr- Lernvorganges
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit den pädagogisch-philosophischen Kennzeichnungen für die modernen, technisierten Gesellschaften. Er untersucht, wie sich das Wissen in diesen Gesellschaften wandelt und welche Auswirkungen dies auf den Bildungsprozess hat. Der Text nimmt dabei die Erkenntnisse der qualitativ-empirischen Bildungs- und Unterrichtsforschung in den Blick.
- Wissensgesellschaft und ihre Auswirkungen auf Pädagogik
- Das Wesen von Wissen und seine Bedingungen
- Die Rolle von Sachkompetenz im Bildungsprozess
- Die Charakteristika eines an persongebundenem Wissen ausgerichteten Lernprozesses
- Die Relevanz qualitativ-empirischer Bildungs- und Unterrichtsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Textes ein und stellt die Bedeutung von Bildung in den modernen, technisierten Gesellschaften dar.
Wissen
Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach dem Wissen in der Wissensgesellschaft. Es untersucht die Beziehung zwischen Wissen und Person sowie die Rolle von Sachkompetenz.
Lernen
In diesem Kapitel werden die Charakteristika eines an persongebundenem Wissen ausgerichteten Lernprozesses erörtert. Es wird außerdem erläutert, welche Konsequenzen sich aus einem sachkompetenzorientierten Wissenserwerb für den Lehr-Lernvorgang ergeben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind: Wissensgesellschaft, Bildung, Pädagogik, Wissen, Sachkompetenz, Lernprozess, qualitativ-empirische Bildungs- und Unterrichtsforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet eine „Wissensgesellschaft“ aus pädagogischer Sicht?
Sie ist durch technisierte Strukturen geprägt, in denen sich das Verständnis von Wissen und dessen Erwerb grundlegend wandelt.
Warum ist die Bindung von Wissen an die Person so wichtig?
Wissen ist nicht bloße Information; es erfordert eine persönliche Aneignung und Einordnung, um bildungsrelevant zu sein.
Welche Rolle spielt Sachkompetenz im Bildungsprozess?
Sachkompetenz wird als „Herzstück“ des Wissens betrachtet, das die Grundlage für Urteilsfähigkeit und Orientierung bildet.
Welche Konsequenzen ergeben sich für den Lehr-Lernvorgang?
Lernprozesse müssen stärker an der individuellen Kompetenzentwicklung und der Fähigkeit zur Orientierung ausgerichtet sein.
Welchen Beitrag leistet die Philosophie Platons in dieser Untersuchung?
Platons Ansätze werden genutzt, um die Bedingungen von Wissen und die Bedeutung von Erkenntnis für die moderne Pädagogik zu hinterfragen.
- Quote paper
- PD Dr. phil. habil. Roland Mugerauer (Author), 2011, Bildungsräume für die 'Wissensgesellschaft'!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172899