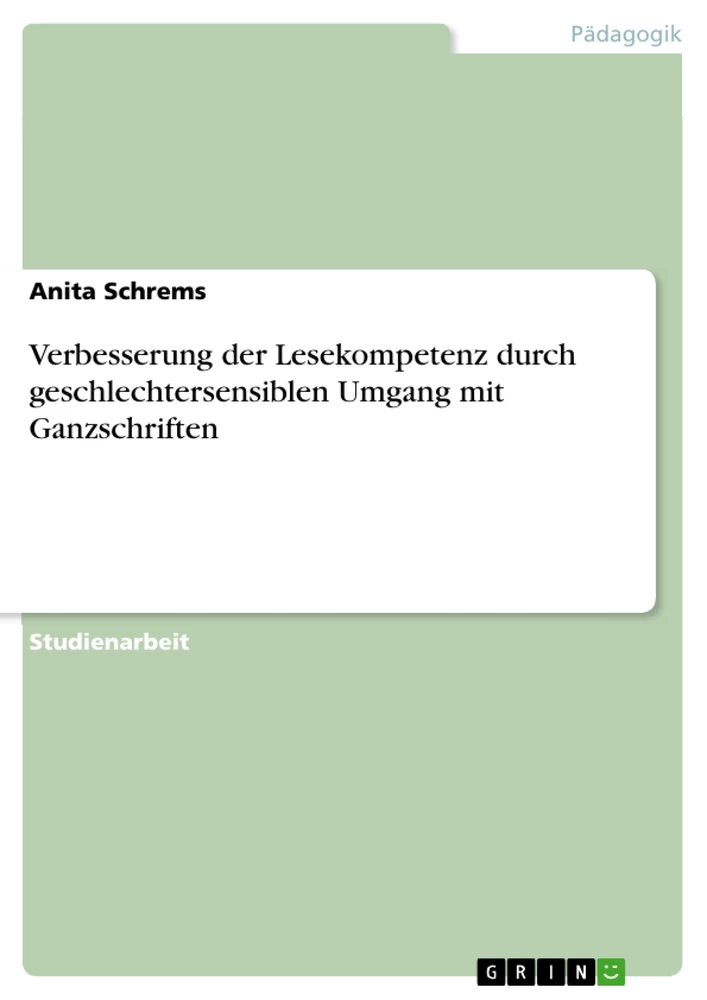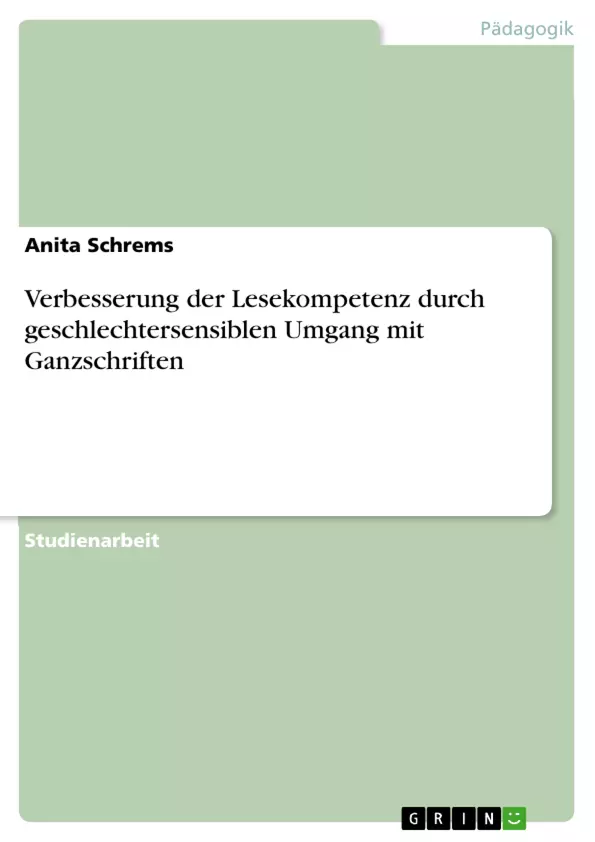Die aktuell veröffentlichten Ergebnisse von PISA 2009 lenken erneut die Aufmerksamkeit insbesondere auf die Leseschwäche der Jungen. Die Ergebnisse bestätigen, dass die Mädchen besser abschneiden und Jungen weniger gern und weniger gut lesen. Insgesamt liegen die deutschen Schüler und Schülerin-nen in ihren Leseleistungen nahe am OECD-Mittelwert. Jedoch wurden 18,5 % der 15-Jährigen als schwache Leser eingestuft. Eine besondere Schwäche der Schüler in allen Schulformen liegt im Reflektieren und Bewerten von Texten.1
Im Folgenden möchte ich zeigen, wie die Lesekompetenz der Grundschüler durch einen geschlechtersensiblen Umgang mit Ganzschriften im Unterricht verbessert werden kann. Hierfür ist es aber zunächst notwendig den Begriff Lesekompetenz zu klären und die geschlechterspezifischen Lesevoraussetzungen darzustellen. Schließlich ist zu beschreiben inwiefern gerade die Beschäftigung mit Ganzschriften zur Lesekompetenz beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung
- 1. Ergebnisse von PISA 2009 und IGLU 2006
- 2. Begründung und Darstellung der Fragestellung
- II) Verbesserung der Lesekompetenz durch geschlechtersensiblen Umgang mit Ganzschriften
- 1. Klärung des Begriffes „Lesekompetenz“
- 1.1 Definition nach PISA
- 1.2 Mehrebenenmodell nach Rosebrock
- 1.3 Lesekompetenzstufen
- 1.4 Lesemotivation bei Jungen und Mädchen
- 2. Geschlechtersensibler Umgang mit Ganzschriften
- 2.1 Begriffsklärung „Geschlechtersensibilität“
- 2.2 Besonderheiten und Lernziele beim Umgang mit Ganzschriften
- 2.3 Auswahl der Ganzschrift
- 2.4 Umgang mit der Ganzschrift
- 1. Klärung des Begriffes „Lesekompetenz“
- III) Bedeutung des Themas „Lesekompetenz“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Verbesserung der Lesekompetenz bei Grundschülern durch einen geschlechtersensiblen Umgang mit Ganzschriften. Die Studie analysiert die Ergebnisse von PISA 2009 und IGLU 2006, die Defizite in der Lesekompetenz, insbesondere bei Jungen, aufzeigen. Ziel ist es, verschiedene Ansätze zur Leseförderung zu beleuchten und den Fokus auf die Bedeutung von Ganzschriften im Unterricht zu legen. Dabei werden sowohl theoretische Grundlagen des Begriffs „Lesekompetenz“ sowie der geschlechterspezifischen Lesemotivation betrachtet als auch praktische Aspekte des Umgangs mit Ganzschriften im Unterricht erörtert.
- Analyse der Ergebnisse von PISA 2009 und IGLU 2006 bezüglich der Lesekompetenz in Deutschland
- Definition und Darstellung von „Lesekompetenz“ anhand des Mehrebenenmodells von Rosebrock
- Untersuchung der geschlechterspezifischen Lesemotivation und -voraussetzungen
- Bedeutung und Möglichkeiten des geschlechtersensiblen Umgangs mit Ganzschriften im Unterricht
- Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Lesekompetenz durch die Verwendung von Ganzschriften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Ergebnisse von PISA 2009 und IGLU 2006, die Defizite in der Lesekompetenz, insbesondere bei Jungen, aufzeigen. Die Fragestellung der Arbeit wird definiert und die Notwendigkeit eines geschlechtersensiblen Umgangs mit Ganzschriften im Unterricht herausgestellt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Klärung des Begriffs „Lesekompetenz“ anhand des Mehrebenenmodells von Rosebrock. Die verschiedenen Teilkompetenzen des Lesens werden vorgestellt und die Bedeutung der Lesemotivation sowie die Unterschiede in der Lesemotivation zwischen Jungen und Mädchen werden analysiert.
Im dritten Kapitel wird der Begriff „Geschlechtersensibilität“ geklärt und die Besonderheiten und Lernziele beim Umgang mit Ganzschriften im Unterricht erörtert. Die Auswahl der Ganzschrift sowie der Umgang mit ihr werden detailliert besprochen und praktische Tipps für den Unterricht gegeben.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themenbereichen Lesekompetenz, Geschlechterdifferenz, Ganzschriften, Leseförderung, PISA, IGLU, Grundschule, Deutschunterricht, Unterrichtsgestaltung, Motivation, Textverständnis, Kognition, Reflexion, Textanalyse, Sprachentwicklung, Schulbuch, Lesestrategien.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Jungen oft eine geringere Lesekompetenz als Mädchen?
Studien wie PISA 2009 zeigen, dass Jungen weniger gern lesen und Defizite beim Reflektieren von Texten haben. Dies liegt oft an geschlechtsspezifischen Interessen und fehlender Motivation durch unpassende Lektüren.
Was ist ein "geschlechtersensibler Umgang" mit Literatur?
Es bedeutet, bei der Auswahl und Bearbeitung von Texten die unterschiedlichen Lesevoraussetzungen und Interessen von Jungen und Mädchen zu berücksichtigen, um beide Gruppen gleichermaßen zu fördern.
Was versteht man unter "Ganzschriften" im Unterricht?
Ganzschriften sind vollständige literarische Werke (Bücher), im Gegensatz zu kurzen Textauszügen in Schulbüchern. Sie ermöglichen eine tiefere Auseinandersetzung mit Handlung und Charakteren.
Was ist das Mehrebenenmodell nach Rosebrock?
Es beschreibt Lesekompetenz auf verschiedenen Ebenen: von der Wort- und Satzidentifikation über die lokale und globale Kohärenzbildung bis hin zur sozialen Ebene des Lesens.
Wie können Ganzschriften die Lesemotivation steigern?
Durch die Auswahl spannender und relevanter Themen sowie handlungsorientierte Methoden können Schüler eine engere Bindung zum Text aufbauen, was besonders leseschwachen Schülern hilft.
Welche Lernziele werden beim Umgang mit Ganzschriften verfolgt?
Ziele sind die Verbesserung des Textverständnisses, die Förderung der Leseflüssigkeit sowie die Fähigkeit, literarische Texte kritisch zu bewerten und zu reflektieren.
- Arbeit zitieren
- Anita Schrems (Autor:in), 2010, Verbesserung der Lesekompetenz durch geschlechtersensiblen Umgang mit Ganzschriften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173300