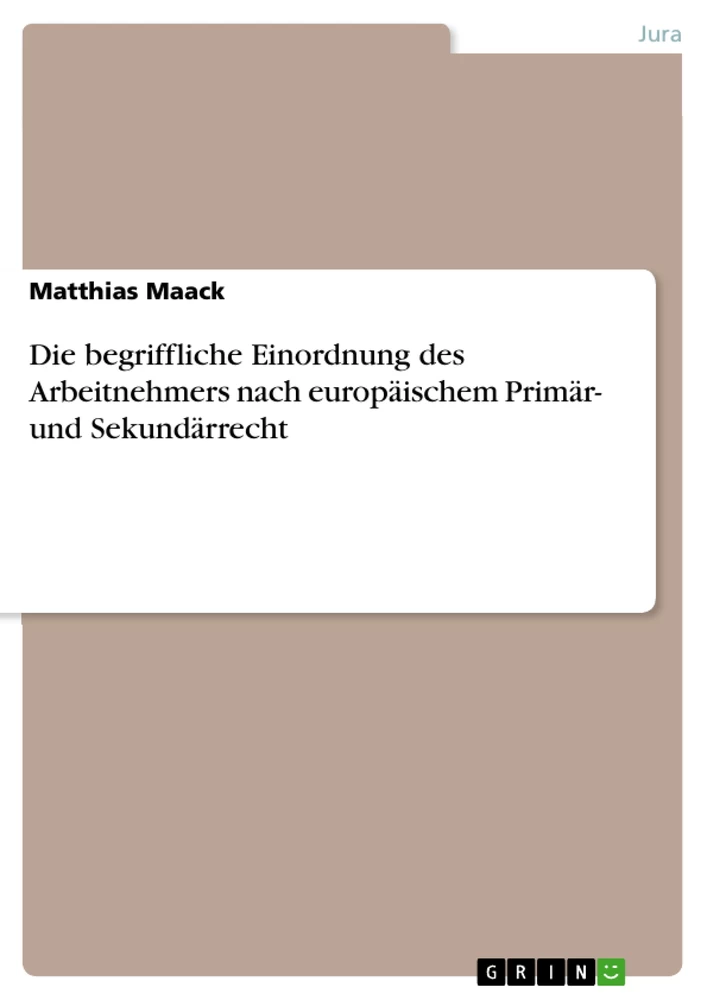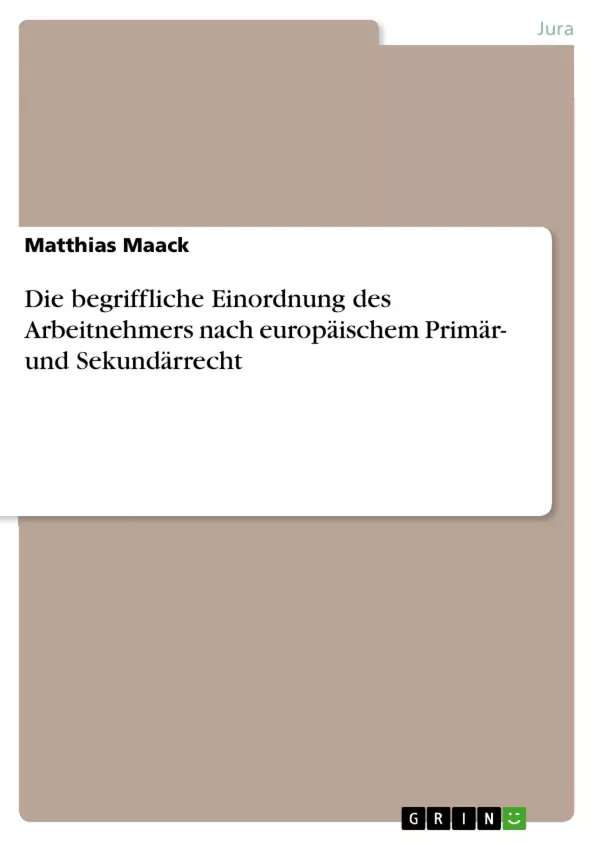[...] Im Nachfolgenden soll anhand des europäischen Primär- und Sekundärrechtes
geklärt werden, wer konkret unter den Schutzbereich der Grundfreiheit der
Freizügigkeit der Arbeitnehmer gem. Art. 39 bis 42 EGV fällt und somit den
Gegenpart zum Unternehmer im Rahmen der Niederlassungsfreiheit und den
freien Dienstleistungsverkehr darstellt.
Zum 01. Mai 2004 sind der Europäischen Union 10 neue Länder beigetreten. Eine zweite kleine Erweiterung erfolgte sodann zum 01. Januar 2007
durch den Beitritt zweier weiterer Länder zur Europäischen Union.
Diese Erweiterungen stellten für die Europäische Union eine der größten
Herausforderungen und Veränderungen ihrer Geschichte dar. Nie zuvor war die Gruppe der beigetretenen Staaten so groß und die Wirtschaftsstruktur und das
Wirtschaftspotential so unterschiedlich.3 Aufgrund der Heterogenität der Länder
dürfte vor allem die Personenfreizügigkeit, die seit den Verträgen von Rom aus
dem Jahre 1957 zu den vier Grundfreiheiten des gemeinsamen Marktes zählt,
besonders weitreichende Folgen haben. Zu betrachten ist hier, dass gerade die
Freizügigkeit der Arbeitnehmerschaft ein wichtiges Potential für das
unternehmerische Handeln der Firmen innerhalb der europäischen Union
darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
- III. Arbeitnehmer – gemeinschaftliche oder nationale Begrifflichkeit
- 1. Arbeitnehmer gemäß des Deutschen Rechtes
- 2. Arbeitnehmer gemäß des Gemeinschaftsrechtes
- 3. Klärung des Begriffes anhand gemeinschaftlichen Sekundärrechtes
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Dokument befasst sich mit der begrifflichen Einordnung des Arbeitnehmers im europäischen Primär- und Sekundärrecht. Es analysiert die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Rahmen der Europäischen Union und untersucht, wie der Begriff "Arbeitnehmer" in verschiedenen Rechtsordnungen definiert wird.
- Definition des Begriffs "Arbeitnehmer" im europäischen Recht
- Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer als Grundprinzip des Gemeinschaftsrechts
- Harmonisierung der Definition des Arbeitnehmers in den Mitgliedstaaten
- Die Rolle des Gemeinschaftsrechts bei der Auslegung des Begriffs "Arbeitnehmer"
- Die Folgen unterschiedlicher Interpretationen des Begriffs für die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer als eine der vier Grundfreiheiten des Gemeinschaftsrechts dar. Sie betont die Wichtigkeit einer einheitlichen Auslegung des Begriffs "Arbeitnehmer" für den reibungslosen Funktionsmechanismus des europäischen Binnenmarktes.
II. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Europäischen Gemeinschaftsrecht, insbesondere die Regelungen in Artikel 39-42 EGV. Es erläutert die Definition der Freizügigkeit und die Beschränkungen, die in diesem Zusammenhang möglich sind.
III. Arbeitnehmer – gemeinschaftliche oder nationale Begrifflichkeit
Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Frage, ob die Definition des Begriffs "Arbeitnehmer" den Mitgliedstaaten selbst überlassen werden kann oder ob eine gemeinschaftliche Definition erforderlich ist. Es argumentiert, dass eine einheitliche Interpretation des Begriffs im Interesse der Harmonisierung des europäischen Rechts und der effektiven Funktionsweise des Binnenmarktes steht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Begriff des "Arbeitnehmers" im Kontext des europäischen Primär- und Sekundärrechts. Die zentralen Themen sind die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die Harmonisierung des Begriffs "Arbeitnehmer" in den Mitgliedstaaten und die Auswirkungen unterschiedlicher Interpretationen auf die Funktionsfähigkeit des europäischen Binnenmarktes. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gemeinschaftsrecht, europäisches Primärrecht, Sekundärrecht, harmonisierte Rechtsanwendung, Binnenmarkt, Freizügigkeit, Beschäftigung, Entlohnung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Arbeitnehmer im EU-Recht definiert?
Die Arbeit untersucht die Definition anhand des europäischen Primär- und Sekundärrechts, insbesondere im Hinblick auf die Freizügigkeit gemäß Art. 39 bis 42 EGV.
Warum ist eine einheitliche Definition des Arbeitnehmerbegriffs wichtig?
Eine harmonisierte Auslegung ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes und die effektive Anwendung der Grundfreiheiten.
Was unterscheidet den nationalen vom gemeinschaftsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff?
Die Arbeit vergleicht die deutsche Rechtslage mit den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts und analysiert die Notwendigkeit einer supranationalen Klärung.
Welche Rolle spielten die EU-Erweiterungen 2004 und 2007?
Diese Erweiterungen stellten die Personenfreizügigkeit aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen vor neue Herausforderungen.
Was sind die Folgen unterschiedlicher Interpretationen des Begriffs?
Unterschiedliche nationale Definitionen können die Freizügigkeit behindern und Wettbewerbsverzerrungen im gemeinsamen Markt verursachen.
- Citar trabajo
- Dr. Matthias Maack (Autor), 2011, Die begriffliche Einordnung des Arbeitnehmers nach europäischem Primär- und Sekundärrecht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173841