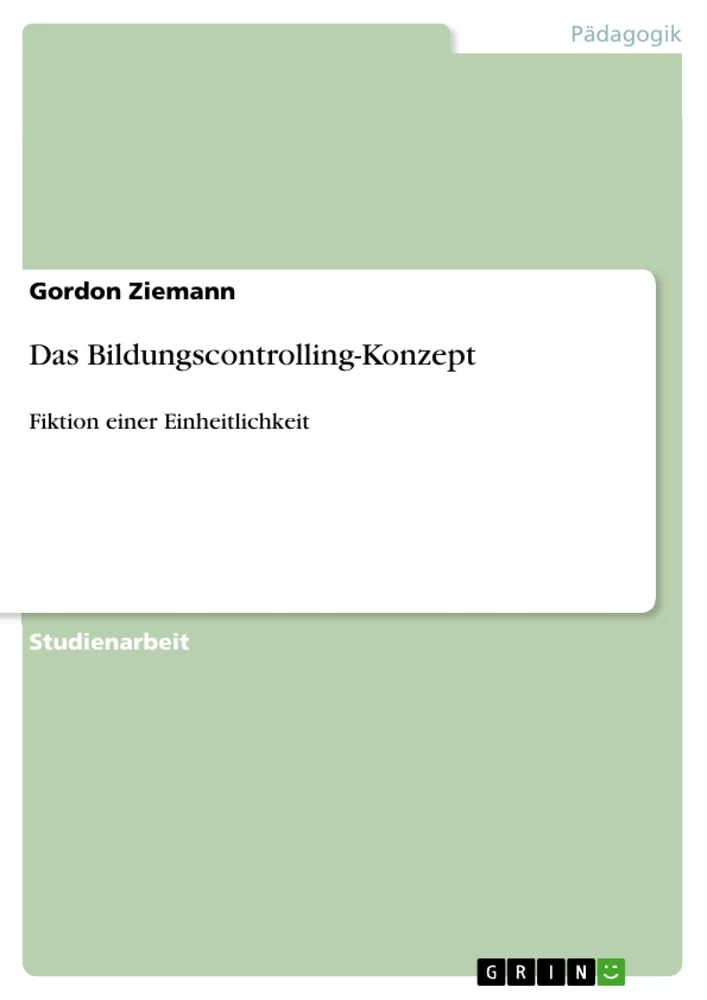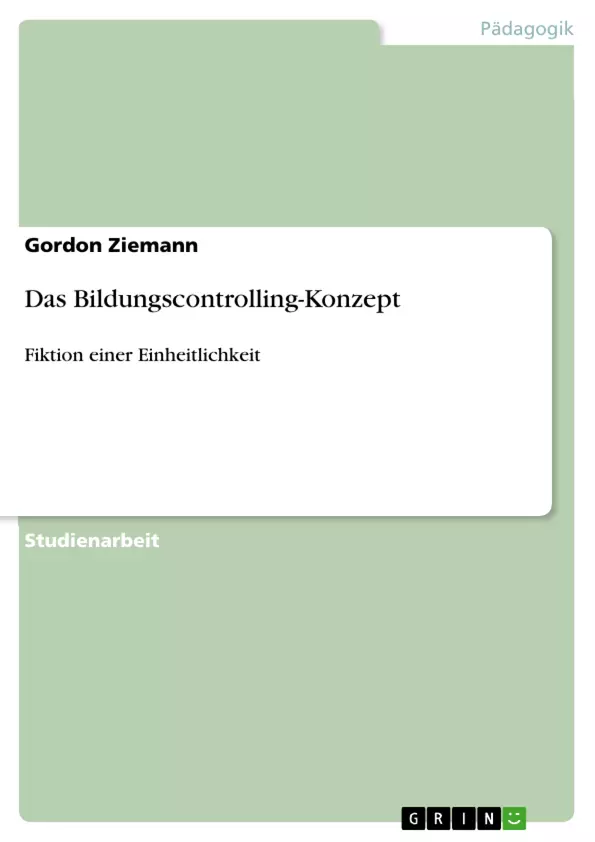„Sind die Teilnehmer am Seminarende zufrieden, ist das Ziel erreicht, und der Transfer gelingt von allein.“ (Grote 2010, S. 1)
Seit den achtziger Jahren wurde begonnen Mitarbeiter ernsthaft als „Human-Ressource“ zu sehen und entsprechend als Erfolgsfaktor für Unternehmen zu bewerten. Hierbei stehen nicht die körperliche Leistungsfähigkeit im Vordergrund der Betrachtung, sondern die kognitiven Fähigkeiten und der wirtschaftlich nutzbare Ausbau dieser Fähigkeiten. Fort- und Weiterbildung wurden also zu einer neuen entscheidenden Maßnahme, um sich auf dem hart umkämpften Markt zu etablieren. Dabei entwickelte sich ein tiefgreifender Dualismus zweier Disziplinen, die sich nur schwer zusammenbringen lassen. Die Ökonomie auf der einen Seite und die Bildungsarbeit auf der anderen Seite entwerfen unterschiedliche Ziele ihrer Arbeit und werden den-noch gleichermaßen für den Erfolg eines Unternehmens benötigt.
Die interdisziplinäre Aufgabe die sich hier entwickelt war kürzlich Themenschwerpunkt auf dem „8. deutschen Fachkongress für Bildungscontrolling“ und wird zunehmend als Notwendigkeit in Unternehmen erkannt und angewendet. Das Bildungscontrolling soll die Möglichkeit bieten, Bildungsarbeit zielführend und weitestgehend wirtschaftlich zu steuern. Die Problematik zeigt Sven Grote in der Darstellung der oben aufgeführten „Legende“. Grote zufolge wird zu viel Wert auf die Zufriedenheit gelegt und zu wenig auf den Lerntransfer, der mit solchen Seminaren erzielt wird. Wenn es also diese Unterschiede, zum Beispiel in der Messung von Lerntransfer und Zufriedenheit gibt, stellt sich für diese Arbeit insbesondere eine Frage. Warum gibt es kein einheitliches Konzept des Bildungscontrollings?
Um diese Frage im Rahmen dieser kurzen Arbeit ausreichend klären zu können, wird in erster Instanz der Terminus des Bildungscontrollings herausgearbeitet und gegen weitere geläufige Termini abgegrenzt. Anschließend soll versucht werden, anhand der Leitfäden von Schöni, Heeg & Jäger, die Auswahl eines individuellen Konzeptes und dessen Einführung zu erläutern und Unterschiede heraus zu stellen, die ein einheitliches Konzept wirkungslos machen könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Inhaltliche Grundlagen
- 2.1 Begriffsverständnis
- 2.2 Bildungs-Controlling
- 2.3 Handlungsfelder
- 3. Controlling-Konzept
- 3.1 Dimensionen des Bildungscontrollings
- 3.2 Wahl eines Konzeptes
- 3.3 Einführung eines Konzeptes
- 4. Zusammenfassung
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Bildungscontrolling-Konzept und beleuchtet die Problematik der fehlenden Einheitlichkeit in diesem Bereich. Sie analysiert die begrifflichen Grundlagen des Controllings im Bildungsbereich und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven der Pädagogik und der Ökonomie. Dabei wird das Bildungscontrolling als interdisziplinäre Aufgabe dargestellt, die die Steuerung von Bildungsprozessen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz anstrebt. Die Arbeit strebt eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage an, warum ein einheitliches Konzept des Bildungscontrollings bisher ausgeblieben ist.
- Die unterschiedlichen Perspektiven von Pädagogik und Ökonomie im Kontext des Bildungscontrollings.
- Die Problematik der Begriffsdefinition und -abgrenzung von „Controlling“ und „Bildungscontrolling“
- Die Analyse der Dimensionen des Bildungscontrollings und die Herausforderungen bei der Wahl und Einführung eines geeigneten Konzeptes.
- Die Faktoren, die ein einheitliches Bildungscontrolling-Konzept verhindern.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung
Die Einleitung beleuchtet die Entwicklung des Bildungscontrollings als Reaktion auf den zunehmenden Fokus auf „Human-Ressourcen“ in Unternehmen. Der Text betont die Herausforderungen, die aus dem Zusammenspiel von Ökonomie und Bildungsarbeit resultieren und die Schwierigkeit, ein einheitliches Konzept des Bildungscontrollings zu etablieren.
Kapitel 2: Inhaltliche Grundlagen
In diesem Kapitel werden die begrifflichen Grundlagen des Controllings im Bildungsbereich behandelt. Es wird der Versuch unternommen, die Dualität von Pädagogik und Ökonomie im Kontext des Bildungscontrollings zu verstehen. Der Text analysiert die Übersetzung des Begriffs „Controlling“ und zeigt auf, warum die gängige Übersetzung mit „Kontrolle“ zu Missverständnissen führt. Darüber hinaus werden verschiedene Begriffsverständnisse von „Controlling“ und „Controllership“ erläutert, um ein tieferes Verständnis für die Problematik der Einordnung des Bildungscontrollings zu schaffen.
Schlüsselwörter
Bildungscontrolling, Controlling, Pädagogik, Ökonomie, Human-Ressourcen, Interdisziplinarität, Konzept, Einheitlichkeit, Handlungsfelder, Zufriedenheit, Lerntransfer, Überwachung, Kontrolle, Steuerung, Transparenz.
Häufig gestellte Fragen zum Bildungscontrolling
Was ist das Ziel von Bildungscontrolling?
Bildungscontrolling soll Bildungsarbeit in Unternehmen zielführend und wirtschaftlich steuern, wobei der Fokus auf dem Lerntransfer statt nur auf der Teilnehmerzufriedenheit liegt.
Warum gibt es kein einheitliches Konzept des Bildungscontrollings?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede in individuellen Konzepten und deren Einführung, die durch die Dualität von Pädagogik und Ökonomie erschwert werden.
Was ist der Unterschied zwischen Controlling und Kontrolle?
Die Arbeit stellt klar, dass Controlling oft fälschlicherweise mit reiner „Kontrolle“ übersetzt wird, während es eigentlich um Steuerung, Transparenz und Zielerreichung geht.
Welche Handlungsfelder umfasst das Bildungscontrolling?
Es umfasst Dimensionen wie die Planung, Durchführung und insbesondere die Messung des Lerntransfers von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Was bedeutet „Human-Ressource“ in diesem Kontext?
Mitarbeiter werden als Erfolgsfaktor betrachtet, wobei deren kognitive Fähigkeiten durch gezielte Bildung wirtschaftlich nutzbar gemacht werden sollen.
- Citation du texte
- Gordon Ziemann (Auteur), 2011, Das Bildungscontrolling-Konzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174458