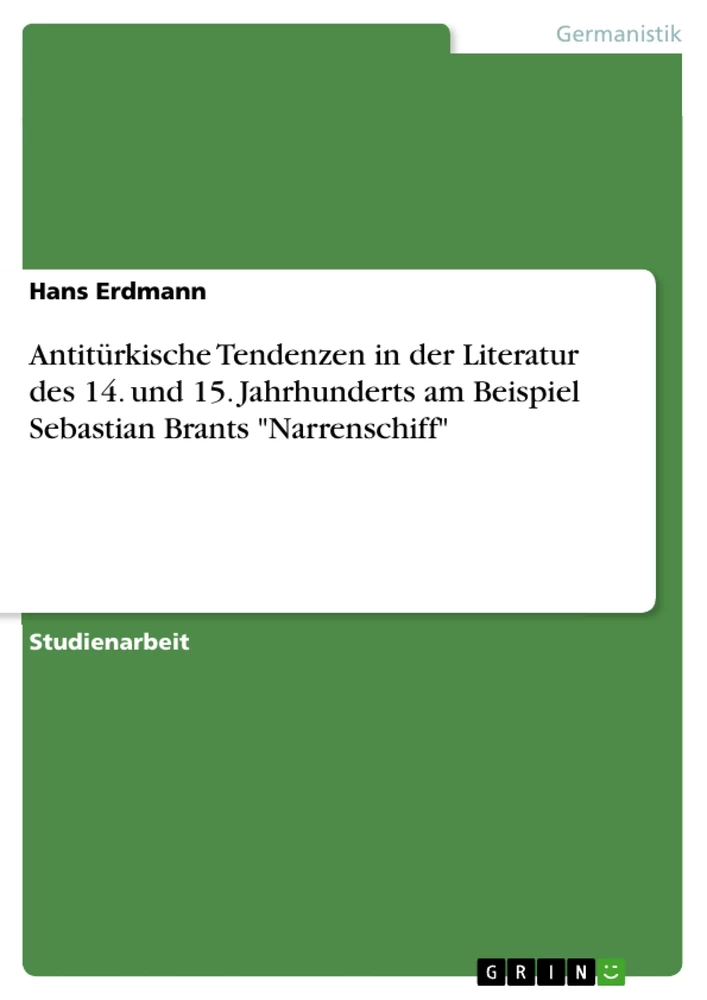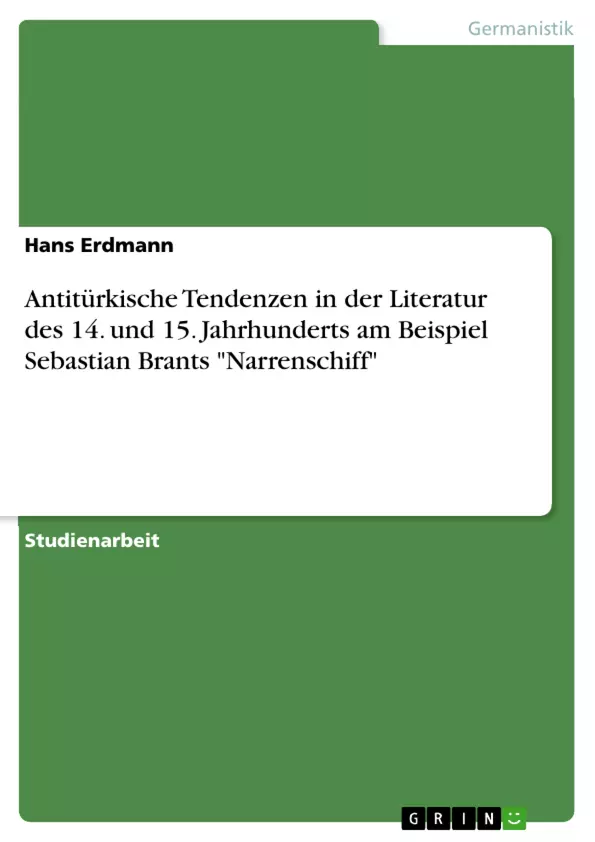1 Einleitung
Sebastian Brants Das Narrenschiff galt bis zu Goethes Werther als das erfolgreichste Buch in deutscher Sprache. 1494 von Johann Bergmann von Olpe in Basel gedruckt und drei Jahre später von Brants Schüler Jakob Locher ins Deutsche („Stultifera Navis“) übersetzt, wurde es bis 1507 bereits in fünf weiteren Auflagen nachgedruckt. Insbesondere das unterhaltsame Aufzeigen der gesamtgesellschaftlichen Laster durch den Narrenspiegel machte seine Moralsatire zum großen Erfolg. Brant wurde aber nicht nur nachgedruckt, sondern auch produktiv rezeptiert. So finden sich in der spätmittelalterlichen Literatur viele Werke, die sich inhaltlich, sprachlich und formal auf das Narrenschiff beziehen. Brant galt hernach als begnadeter Satiriker und Dichter. Weniger bekannt ist, dass Brant auch als Geschichtsschreiber tätig war. Erst in den letzten Jahren wurde das Interesse der Forschung auf dieses Thema gelenkt. Hier interessierten besonders seine Publikationen, die sich mit der nahen Türkenbedrohung auseinander setzten. Wie bewertete Brant die europäische Instabilität und welche Auswege bot er aus der Krise an? Aus der Beschäftigung mit den alten und neuen Glaubenskriegen entstand bei Brant letztlich ein antitürkisches Meinungsbild, dass es f.f. gilt, untersucht zu werden. Das Narrenschiff bietet dabei entsprechende Beispiele. Besonders in den Kapiteln 98 und 99 finden wir Hilfreiches. Bei der folgenden Untersuchung soll uns insbesondere interessieren, wie der literarische Zeitgeist sich entwickelt, wie sehr Brant sich diesem angeschlossen hat und welche Gründe er dessen ungeachtet für sein Meinungsbild selbstständig herangezogen hat. Dabei versuchen wir äquivalent die spätmittelalterliche Literatur, Brants Weltverständnis und seine Auffassung der Geschichte gleich zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Literarischer Zeitgeist
- 2.1 Steigendes Interesse der Öffentlichkeit an den „Türcken“ und literarische Verbreitung
- 2.2 Die Rolle der Kirche bei der Türkendarstellung
- 3 Antitürkische Tendenzen Brants am Beispiel des Narrenschiffs
- 3.1 Die Kapitel 98 und 99
- 3.2 Gründe für Brants Türkenhass
- 3.2.1 „vom abgang des glouben“
- 3.2.2 Kaiser Maximilian I.
- 4 Schlussfolgerung
- 5 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die antitürkischen Tendenzen in Sebastian Brants Narrenschiff im Kontext des literarischen Zeitgeists des 14. und 15. Jahrhunderts. Ziel ist es, Brants Meinungsbildung zu analysieren und seine antitürkische Haltung im Verhältnis zum allgemeinen Diskurs zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet sowohl die literarische Verbreitung antitürkischer Vorstellungen als auch die Rolle der Kirche und politische Einflüsse.
- Entwicklung des antitürkischen Diskurses im späten Mittelalter
- Analyse der antitürkischen Tendenzen in Brants Narrenschiff
- Einfluss des literarischen Zeitgeists auf Brants Werk
- Brants persönliche Gründe für seine antitürkische Haltung
- Vergleich von Brants Sichtweise mit anderen zeitgenössischen Texten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt Sebastian Brant und sein Narrenschiff als einflussreiches Werk der deutschen Literatur vor und hebt dessen Erfolg und Rezeption hervor. Sie führt in das Thema der antitürkischen Tendenzen in Brants Werk ein und skizziert die Forschungsfrage: Wie bewertete Brant die europäische Instabilität angesichts der türkischen Bedrohung, und welche Lösungsansätze bot er an? Die Einleitung betont die Bedeutung der Kapitel 98 und 99 des Narrenschiffs für die Untersuchung und kündigt den methodischen Ansatz an, den literarischen Zeitgeist, Brants Weltverständnis und seine historische Perspektive zu beleuchten.
2 Literarischer Zeitgeist: Dieses Kapitel untersucht den literarischen und politischen Kontext, in dem Brants Werk entstand. Es analysiert die allmählich steigende öffentliche Aufmerksamkeit für die Osmanen im späten Mittelalter, zunächst langsam und beeinflusst von lokalen Ereignissen, dann verstärkt durch militärische Auseinandersetzungen und die Mobilisierung von Kreuzzügen. Das Kapitel beleuchtet die Rolle der großen Handelsstädte als Zentren der Informationsverbreitung und betont den Einfluss von Übertreibungen und phantastischen Erzählungen auf die Darstellung der Türken. Die Schlacht von Nikopolis wird als Wendepunkt genannt, der das öffentliche Interesse an den "Türken" stark steigerte und zu einer Flut antitürkischer Literatur führte.
2.1 Steigendes Interesse der Öffentlichkeit an den „Türcken“ und literarische Verbreitung: Dieser Abschnitt detailliert die zunehmende Verbreitung von Informationen und Meinungen über die Türken im späten 14. und frühen 15. Jahrhundert. Er beschreibt die unterschiedlichen Quellen dieser Informationen, von den Berichten von Kaufleuten und Kriegsteilnehmern bis hin zu den Berichten von Diplomaten, wobei er die Tendenz zu Übertreibungen und der Fokus auf sensationelle Geschichten hervorhebt. Der Abschnitt erklärt, wie diese Informationen durch verschiedene Medien wie Predigten, Flugschriften, Lieder und Theaterstücke verbreitet wurden und wie sie schließlich die öffentliche Wahrnehmung der Türken formten und zur Stigmatisierung als Bedrohung für das christliche Abendland beitrugen.
Schlüsselwörter
Sebastian Brant, Das Narrenschiff, Antitürkische Tendenzen, Literarischer Zeitgeist, Spätmittelalter, Osmanisches Reich, Türkenkriege, Nikopolis, Propaganda, Christentum, Islam.
Häufig gestellte Fragen zu Sebastian Brants Narrenschiff und seinen antitürkischen Tendenzen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die antitürkischen Tendenzen in Sebastian Brants berühmtem Werk "Das Narrenschiff" im Kontext des literarischen und politischen Zeitgeists des späten Mittelalters (14. und 15. Jahrhundert). Der Fokus liegt auf der Analyse von Brants Meinungsbildung und seiner antitürkischen Haltung im Vergleich zum allgemeinen Diskurs der damaligen Zeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des antitürkischen Diskurses im Spätmittelalter, analysiert die antitürkischen Tendenzen in Brants "Narrenschiff" (insbesondere Kapitel 98 und 99), untersucht den Einfluss des literarischen Zeitgeists auf Brants Werk, erforscht Brants persönliche Beweggründe für seine antitürkische Haltung und vergleicht seine Sichtweise mit anderen zeitgenössischen Texten. Die Rolle der Kirche und politische Einflüsse, wie beispielsweise die Figur Kaiser Maximilians I., werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum literarischen Zeitgeist (inklusive eines Unterkapitels zum steigenden öffentlichen Interesse an den "Türken" und der Rolle der Kirche), ein Kapitel zur Analyse der antitürkischen Tendenzen in Brants "Narrenschiff", eine Schlussfolgerung und ein Quellenverzeichnis. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Abschnitts.
Welche Rolle spielt der literarische Zeitgeist?
Der literarische Zeitgeist des späten Mittelalters, geprägt von einer zunehmenden, wenngleich anfänglich langsam wachsenden, öffentlichen Aufmerksamkeit für die Osmanen, spielt eine zentrale Rolle. Militärische Auseinandersetzungen und die Mobilisierung von Kreuzzügen, verstärkt durch Übertreibungen und phantastische Erzählungen, beeinflussten die Darstellung der Türken in der Literatur. Die Schlacht von Nikopolis wird als Wendepunkt identifiziert, der das öffentliche Interesse erheblich steigerte und zu einer Flut antitürkischer Literatur führte. Die Arbeit analysiert auch die Rolle von Handelsstädten als Verbreitungszentren solcher Informationen.
Warum konzentriert sich die Arbeit auf Kapitel 98 und 99 des Narrenschiffs?
Kapitel 98 und 99 des Narrenschiffs werden als besonders relevant für die Untersuchung der antitürkischen Tendenzen in Brants Werk angesehen. Diese Kapitel enthalten die zentralen Aussagen und Argumentationen, die Brants Haltung gegenüber den Osmanen offenbaren.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf ein Quellenverzeichnis (im HTML nicht explizit aufgeführt, aber implizit vorhanden), welches die verwendeten Quellen für die Analyse des literarischen Zeitgeists, Brants Biografie und die Interpretation seines Werks auflistet. Es beinhaltet sowohl primäre als auch sekundäre Quellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant beschreiben, sind: Sebastian Brant, Das Narrenschiff, Antitürkische Tendenzen, Literarischer Zeitgeist, Spätmittelalter, Osmanisches Reich, Türkenkriege, Nikopolis, Propaganda, Christentum, Islam.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie bewertete Brant die europäische Instabilität angesichts der türkischen Bedrohung, und welche Lösungsansätze bot er an?
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit beleuchtet den literarischen Zeitgeist, Brants Weltverständnis und seine historische Perspektive, um seine antitürkischen Tendenzen zu verstehen und zu analysieren.
- Citation du texte
- Hans Erdmann (Auteur), 2010, Antitürkische Tendenzen in der Literatur des 14. und 15. Jahrhunderts am Beispiel Sebastian Brants "Narrenschiff", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174482