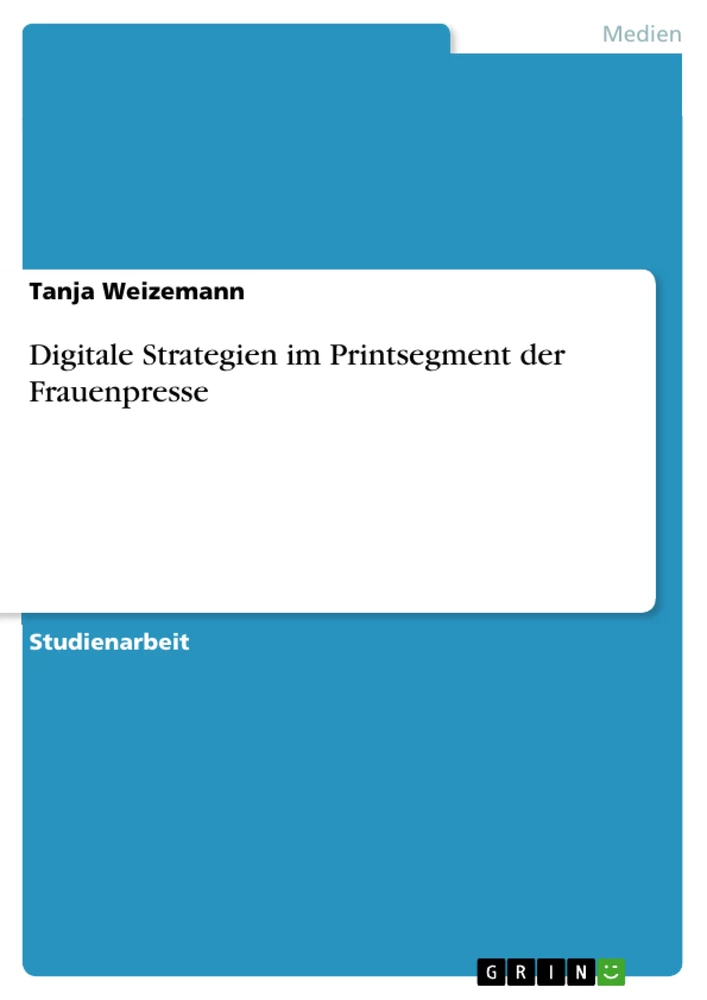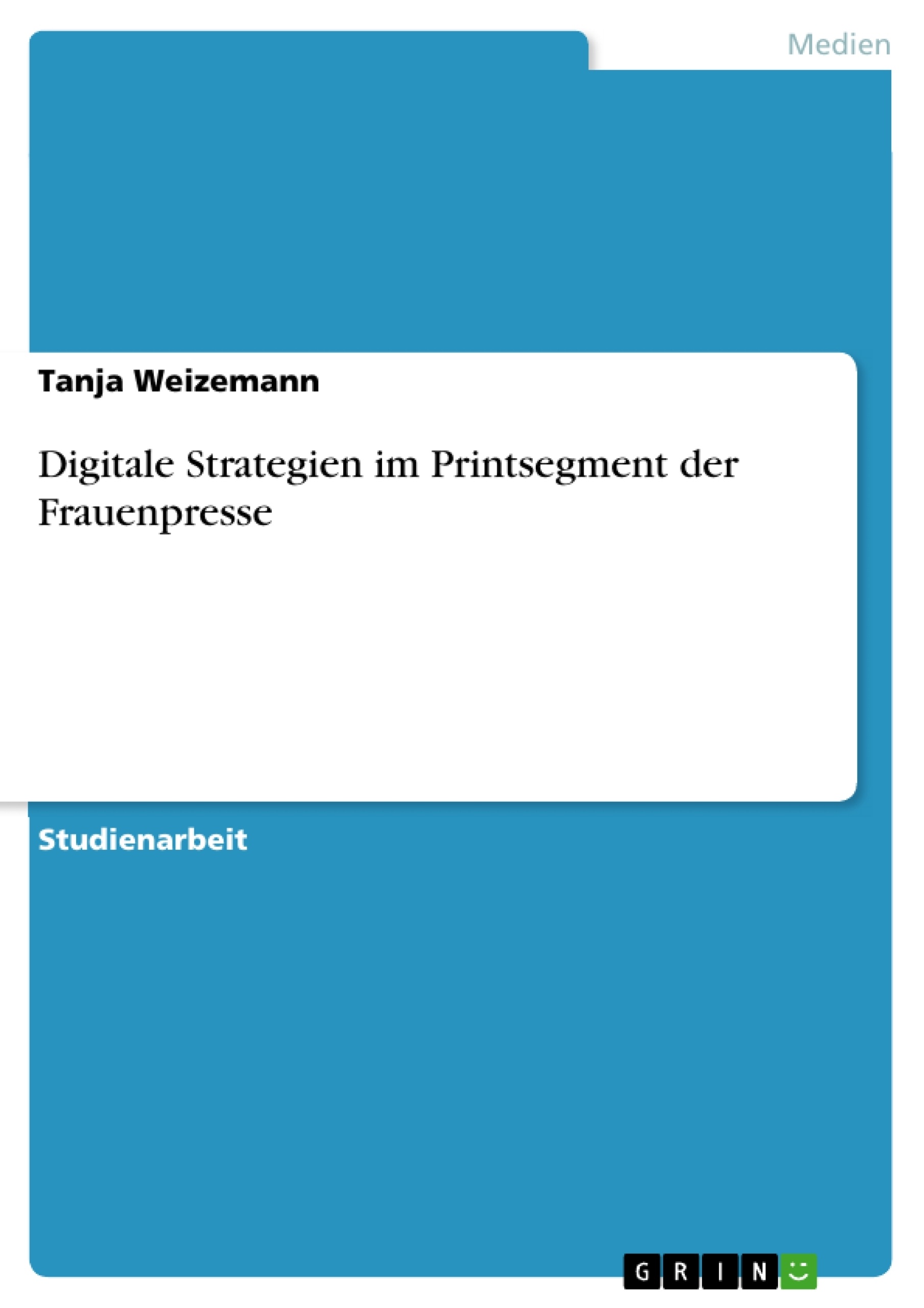Daher beschäftigt sich diese Hausarbeit mit dem Thema Print vs. Online. Zunächst einmal wird theoretisch untersucht, wie das Spannungsfeld Print und Online von Experten und aus Sicht der Verlage beurteilt wird. Außerdem möchte durchleuchtet werden, welche Herausforderungen und Chancen für die Verlagsunternehmen durch das neue Medium entstehen. Außerdem ist es wichtig zu betrachten, wie die Verlage die strategische Vernetzung von Print und Online in die Hand nehmen, auch aus theoretischer Sicht. Zuletzt werden die Zukunftsaussichten betrachtet und wie sich Print im Vergleich zu Online entwickeln wird.
Im praktischen Teil dieser Hausarbeit wird vor allem das Genre Frauenzeit-schriften untersucht. Hierzu wurden Befragungen mit den Verlagen der Cos-mopolitan, Elle, Madame, Petra und Brigitte durchgeführt, um zu sehen, wie die Frauenpresse das Medium Internet in ihre Abläufe integriert. Ziel der Un-tersuchung ist es herauszufinden, ob das Printmedium ersetzt wird durch das Internet, wie die Kompatibilität ist und ob die Zielgruppe entsprechend mit eingebunden wird. Außerdem war es wichtig zu klären, ob das Internet als Begleitmedium für das Magazin oder als eigenständiges Medium betrachtet wird. Auch die Virtualität spielt hierbei eine Rolle, um zu sehen, ob die Verla-ge die neuen Möglichkeiten richtig und zielgerichtet einsetzen. Ferner wurde untersucht, was die Gründe für die Entstehung einer passenden Internetseite zum Magazin waren. Zusätzlich dazu wird aufgezeigt, wie die beiden Medien miteinander vergleichbar sind, ob und welche Ähnlichkeiten sie miteinander haben und wie der gegenseitige Nutzen füreinander. Als letztes wird die Stra-tegie der Verlage erforscht, die Internetseite in ihr Angebot zu integrieren, und aufgezeigt, wie die Bewertung der Verlage selbst zu diesem Thema ist.
So war es möglich anhand der Ergebnisse eine Analyse durchzuführen, die zum einen zeigen soll, ob der Erfolg der einzelnen Frauenmagazine ver-gleichbar mit dem Erfolg der Internetseite ist und zum anderen welches die Erfolgsfaktoren der Verlage sind. Hierzu wurden die Kategorien Kompatibili-tät und Strategie mit Hilfe von bestimmten Kriterien bewertet und daraus ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Print contra Online - Veränderungen für die Verlage
- Das Spannungsfeld von Print und Online
- Herausforderung und Chance für Verlagsunternehmen
- Strategische Vernetzung von Print und Online
- Die Zukunftsaussichten
- Analyse aus Managementsicht an Beispielen aus der Frauenpresse
- Vorgehensweise der Untersuchung
- Die Cosmopolitan
- Vorstellung des Printprodukts Cosmopolitan
- Entstehung der Internetseite und die Gründe
- Vergleich des Printprodukts und der Internetseite
- Strategie und Bewertung
- Die ELLE
- Vorstellung des Printprodukts ELLE
- Entstehung der Internetseite und die Gründe
- Vergleich des Printprodukts und der Internetseite
- Strategie und Bewertung
- Die Madame
- Vorstellung des Printprodukts Madame
- Entstehung der Internetseite und die Gründe
- Vergleich des Printprodukts und der Internetseite
- Strategie und Bewertung
- Die Petra
- Vorstellung des Printprodukts Petra
- Entstehung der Internetseite und die Gründe
- Vergleich des Printprodukts und der Internetseite
- Strategie und Bewertung
- Die Brigitte
- Vorstellung des Printprodukts Brigitte
- Entstehung der Internetseite und die Gründe
- Vergleich des Printprodukts und der Internetseite
- Strategie und Bewertung
- Auswertung der Daten
- Erfolge von Print und Internet im Vergleich
- Erfolgsfaktoren der Verlage
- Print vs. Online - Eine Kompatibilität
- Die Strategien
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse digitaler Strategien im Printsegment der Frauenpresse. Sie untersucht, wie Verlage auf die Herausforderungen und Chancen reagieren, die durch die Digitalisierung des Medienmarktes entstehen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Vernetzung von Print- und Online-Angeboten und deren strategischer Bedeutung für den Erfolg der Verlage.
- Veränderungen im Medienmarkt durch die Digitalisierung
- Strategien zur Vernetzung von Print- und Online-Angeboten
- Analyse von Fallbeispielen aus der Frauenpresse
- Erfolgsfaktoren für Verlage im digitalen Zeitalter
- Bewertung der Zukunftsaussichten für Printprodukte im digitalen Umfeld
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz der Analyse digitaler Strategien im Printsegment der Frauenpresse heraus. Sie skizziert die Herausforderungen und Chancen, die sich durch die Digitalisierung des Medienmarktes ergeben. Kapitel 2 beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Print und Online und analysiert die Auswirkungen auf Verlagsunternehmen. Es werden Strategien zur Vernetzung der beiden Medienformen vorgestellt und die Zukunftsaussichten für Printprodukte im digitalen Umfeld beleuchtet.
Kapitel 3 präsentiert eine Fallstudienanalyse an ausgewählten Beispielen aus der Frauenpresse: Cosmopolitan, ELLE, Madame, Petra und Brigitte. Für jede Zeitschrift werden das Printprodukt, die Entstehung der Internetseite, die Vergleichbarkeit beider Medienformen sowie die verfolgte Strategie und deren Bewertung dargestellt. Die Ergebnisse der Analyse werden in Kapitel 4 ausgewertet. Es werden die Erfolge von Print und Internet im Vergleich betrachtet und Erfolgsfaktoren der Verlage herausgearbeitet. Kapitel 4.2.1 fokussiert dabei auf die Kompatibilität von Print und Online, während Kapitel 4.2.2 die Strategien der Verlage näher beleuchtet. Abschließend wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themenbereichen wie Digitalisierung, Print- und Online-Medien, Verlagsstrategien, Frauenpresse, Erfolgsfaktoren, Vernetzung, Kompatibilität, Fallstudienanalyse und Zukunftsaussichten.
Häufig gestellte Fragen
Wird das Printmedium durch das Internet ersetzt?
Die Untersuchung analysiert, ob Online-Angebote Printprodukte verdrängen oder ob sie als kompatible Begleitmedien fungieren, die einen gegenseitigen Nutzen stiften.
Welche Frauenzeitschriften wurden in der Studie untersucht?
Es wurden Fallstudien zu den Magazinen Cosmopolitan, Elle, Madame, Petra und Brigitte durchgeführt.
Was sind die Hauptgründe für Verlage, Internetseiten zu Magazinen zu erstellen?
Wichtige Motive sind die strategische Vernetzung, die Einbindung der Zielgruppe über neue Kanäle und die Nutzung digitaler Chancen zur Markenfestigung.
Wie bewerten Verlage die Kompatibilität von Print und Online?
Die Arbeit bewertet anhand spezifischer Kriterien, wie gut die Inhalte des Printprodukts mit der Internetpräsenz harmonieren und welche Strategien zum Erfolg führen.
Welche Herausforderungen ergeben sich für Verlagsunternehmen?
Verlage müssen den Spagat zwischen traditionellem Printgeschäft und hochdynamischen Online-Märkten meistern, wobei die strategische Integration beider Welten im Fokus steht.
- Quote paper
- Tanja Weizemann (Author), 2009, Digitale Strategien im Printsegment der Frauenpresse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174512