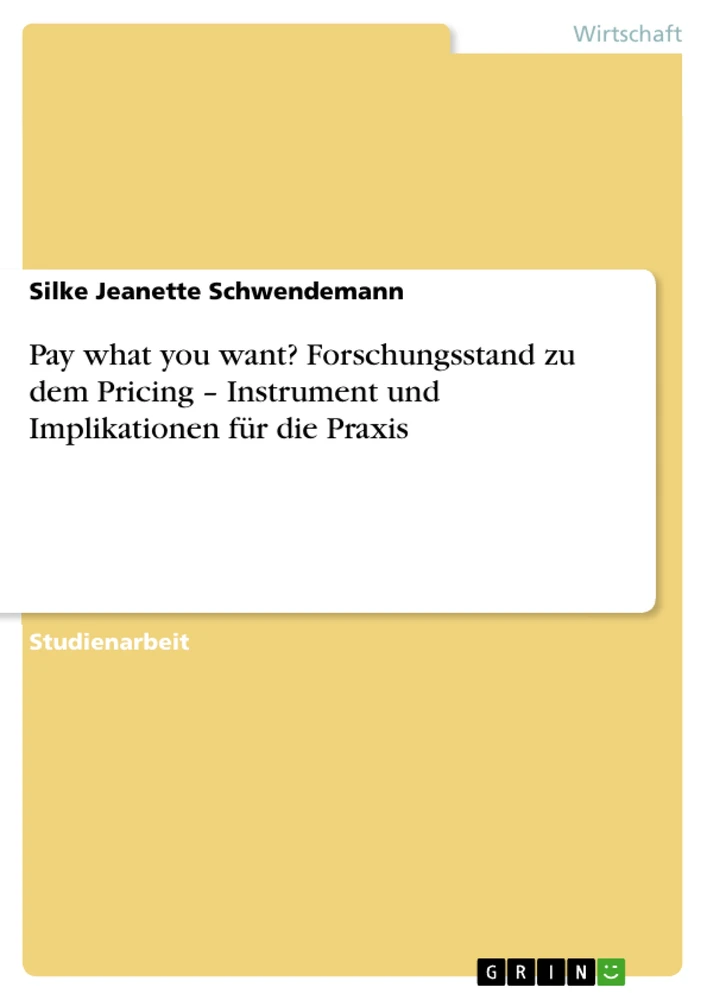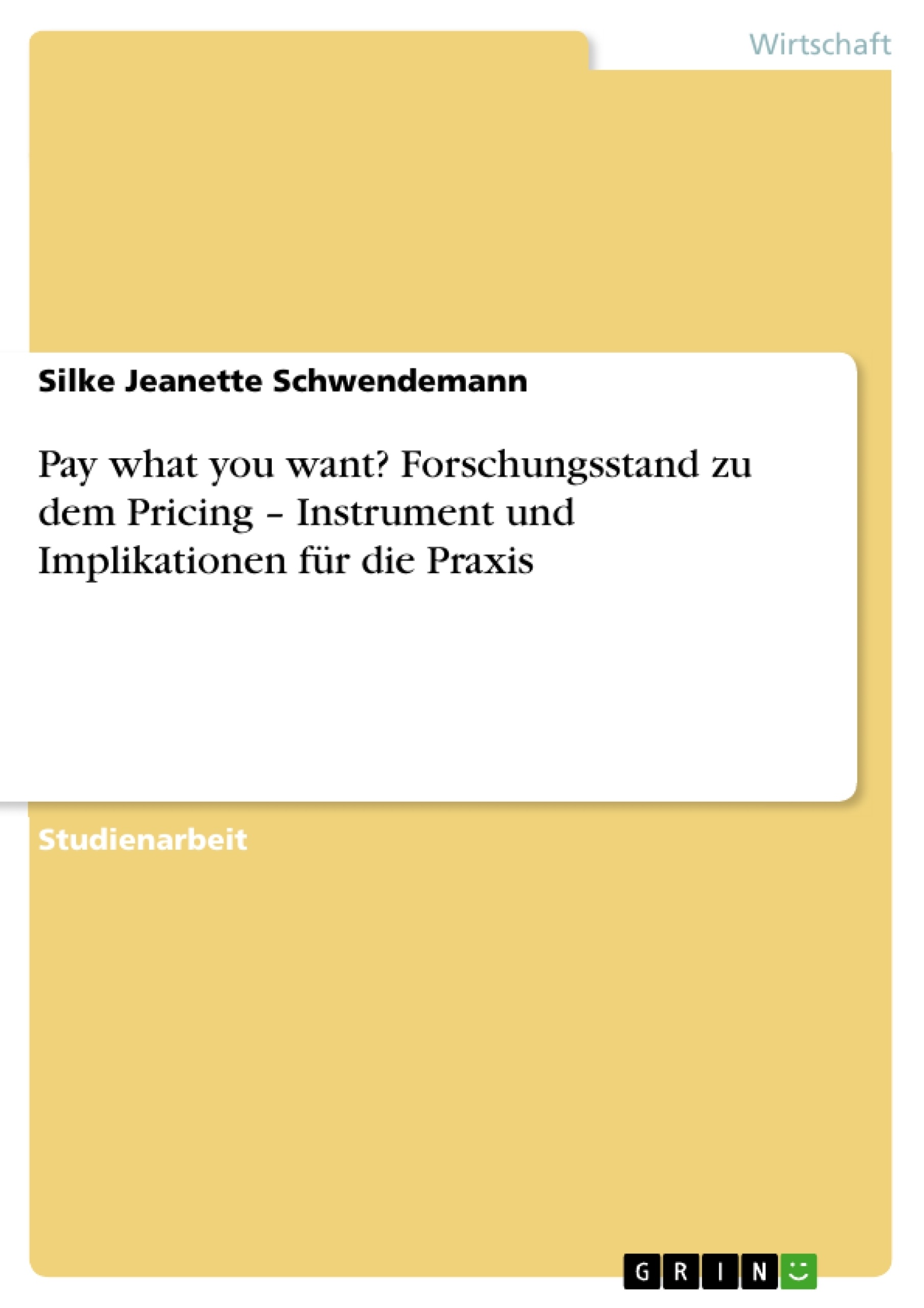Aufgrund des heutigen Überangebots an Produkten und der Sättigung der Märkte wird es für Untenehmen wie für Verkäufer immer schwieriger Gewinne zu erwirtschaften, und sich von seinen Konkurrenten abzuheben. Neben Produktinnovationen und besonderen Serviceangeboten kann man dies durch den Einsatz von speziellen Preisstrategien erzielen. Aus diesem Grund heißt es bei immer mehr Anbietern und Dienstleistern nun Pay What You Want (PWYW) -„Zahlen Sie was Sie wollen“. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein ungewöhnliches, neuartiges Bezahlverfahren, bei dem der Konsument seinen Preis für das Produkt oder die Dienstleistung selbst festlegen kann. Eigentlich müsste die Vorstellung die Preisfestlegung dem Verbraucher zu überlassen der Branche Schweißperlen auf die Stirn treiben, doch immer mehr Unternehmen entdecken das Instrument zu Marketingzwecken für sich. Häufig steht bei der Anwendung des Preisinstrumentes nicht nur die Umsatzgenerierung im Vordergrund. Vielmehr geht es stattdessen um die Neukundengewinnung, die Steigerung des Unternehmensimages sowie positive Mundpropaganda. Die Kontrolle des Konsumenten über den Transaktionspreis verleiht dem Mechanismus seinen innovativen Charakter und nimmt zugleich Rücksicht auf die Heterogenität des Konsumenten. Da jeder Konsument seinen individuellen Preis angeben kann entstehen automatisch differenzierte Preise, was auch für die Konsumenten von Vorteil ist. Trotz des großen Risikos für den Verkäufer, dass die Konsumenten ihre Preiskontrolle ausnutzen, haben Beispiele aus der Praxis bereits gezeigt, dass dieses Konzept der Preisdelegation erfolgreich umgesetzt werden kann.
Die Vorgehensweise dieser Seminararbeit wird es also sein, nach einführenden allgemeinen Grundlagen über das Preisinstrument, sowie dessen Klassifizierung, zu analysieren, in wieweit PWYW–Pricing ein sinnvolles Instrument für die Praxis darstellt. In Abschnitt 3 wird das Käuferverhalten bezüglich PWYW näher untersucht. Fragen die sich diesbezüglich ergeben sind z.B.: „Was motiviert Konsumenten einen positiven Preis zu zahlen, wenn sie die Möglichkeit haben nichts zu zahlen? Inwieweit spielt der Referenzpreis (RP) in diesem Zusammenhang eine Rolle? Kann dieses Phänomen durch verhaltenstheoretische Aspekte erklärt werden? Welche weiteren Ansätze tragen zur Erklärung dieses Verhaltens bei?“ Ein kurzer Aufriss aus dem Bereich der Spieltheorie ist Gegenstand von Abschnitt 4, der aufgrund geringer Forschungsarbeiten diesbezüglich nicht vertieft werden so
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einordnung des Preisinstruments
- 2.1 Definition und Klassifikation von PWYW als Preisinstrument
- 2.2 Vergleich PWYW mit anderen partizipativen Preisinstrumenten
- 2.3 Relevanz für die Praxis
- 2.3.1 Erkenntnisse anhand empirischer Studien
- 2.3.2 Kurz- und Langzeiteffekte von PWYW im Vergleich
- 3. Theoretische Betrachtung des Käuferverhaltens bei PWYW
- 3.1 Motive eines positiven Preis unter PWYW-Bedingungen
- 3.2 Rolle des externen/internen Referenzpreises und sein Einfluss auf den Preis bei PWYW
- 3.3 Einfluss von verhaltenstheoretischen Aspekten und sozialen Normen
- 3.3.1 Einfluss der Charakteristika des Käufers auf das Käuferverhalten
- 3.3.2 Einfluss produktbezogener Charakteristika auf das Käuferverhalten
- 4. Spieltheoretische Betrachtung und Erklärungsansätze von PWYW
- 4.1 Grundlegende Modellannahmen und Verhaltensweisen
- 4.2 Gleichgewichtssituation
- 4.3 Erweiterung des Modells hinsichtlich verhaltenstheoretischer Faktoren
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das "Pay What You Want" (PWYW)-Preisinstrument. Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Praxistauglichkeit von PWYW und die Beantwortung von Fragen zum Käuferverhalten unter diesen Bedingungen. Die Arbeit erforscht die Motive für positive Zahlungen, die Rolle von Referenzpreisen und den Einfluss verhaltenstheoretischer und sozialer Faktoren.
- Definition und Klassifizierung von PWYW
- Käuferverhalten und Motivationen bei PWYW
- Einfluss von Referenzpreisen und sozialen Normen
- Spieltheoretische Modellierung von PWYW
- Praxistauglichkeit und Implikationen von PWYW
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des PWYW-Preismodells ein und begründet dessen Relevanz im Kontext von Marktübersättigung und zunehmendem Wettbewerbsdruck. Es wird hervorgehoben, dass PWYW nicht nur Umsatzgenerierung, sondern auch Neukundengewinnung und Imageverbesserung zum Ziel haben kann. Die Arbeit skizziert den weiteren Aufbau und die Forschungsfragen.
2. Einordnung des Preisinstruments: Dieses Kapitel definiert und klassifiziert PWYW als partizipatives Preisinstrument, bei dem der Käufer die volle Kontrolle über den Preis hat. Es wird der Gegensatz zum neoklassischen Ansatz, der die Nutzenmaximierung durch Preisminimierung postuliert, herausgestellt. Empirische Studien und Beispiele aus der Praxis, wie das Frankfurter Restaurant Kish, werden angeführt, um den Erfolg des Modells zu belegen. Der Vergleich mit dem Trinkgeld-System verdeutlicht die Prinzipien von PWYW und die resultierende Preisdifferenzierung, die die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft der Konsumenten berücksichtigt. Die Reduktion von Transaktionskosten und der positive Einfluss auf Mundpropaganda werden ebenfalls thematisiert.
3. Theoretische Betrachtung des Käuferverhaltens bei PWYW: Dieses Kapitel befasst sich mit den Motiven für positive Zahlungen unter PWYW-Bedingungen. Es untersucht die Rolle des Referenzpreises (RP) und den Einfluss verhaltenstheoretischer Aspekte wie soziale Normen. Es werden die Charakteristika des Käufers und des Produkts als Einflussfaktoren auf das Käuferverhalten beleuchtet. Die Zusammenfassung synthetisiert die verschiedenen Motivationen und Einflussgrößen, um ein umfassendes Bild des Käuferverhaltens unter PWYW zu zeichnen.
4. Spieltheoretische Betrachtung und Erklärungsansätze von PWYW: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über spieltheoretische Ansätze zur Erklärung des PWYW-Phänomens. Aufgrund des begrenzten Forschungsstands in diesem Bereich wird der Fokus auf grundlegende Modellannahmen und Verhaltensweisen gelegt, sowie auf mögliche Erweiterungen des Modells um verhaltenstheoretische Faktoren. Die Komplexität und die Herausforderungen einer umfassenden spieltheoretischen Analyse werden angesprochen.
Schlüsselwörter
Pay What You Want (PWYW), Preisgestaltung, Käuferverhalten, Referenzpreis, soziale Normen, Spieltheorie, Marktübersättigung, Preisdifferenzierung, Zahlungsbereitschaft, Nutzenmaximierung, Transaktionskosten, Mundpropaganda, Marketing, Gesundheitsmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: "Pay What You Want (PWYW)"
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert das "Pay What You Want" (PWYW)-Preisinstrument. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Praxistauglichkeit von PWYW und dem Käuferverhalten unter diesen Bedingungen. Es werden Motive für positive Zahlungen, die Rolle von Referenzpreisen und der Einfluss verhaltenstheoretischer und sozialer Faktoren erforscht.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition und Klassifizierung von PWYW, Käuferverhalten und Motivationen bei PWYW, Einfluss von Referenzpreisen und sozialen Normen, spieltheoretische Modellierung von PWYW und die Praxistauglichkeit und Implikationen von PWYW. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Einordnung des Preisinstruments, eine theoretische Betrachtung des Käuferverhaltens, eine spieltheoretische Betrachtung und abschließend eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Seminararbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein. Kapitel 2 (Einordnung des Preisinstruments) definiert und klassifiziert PWYW und vergleicht es mit anderen Modellen. Kapitel 3 (Theoretische Betrachtung des Käuferverhaltens) untersucht die Motive für Zahlungen und den Einfluss von Referenzpreisen und sozialen Normen. Kapitel 4 (Spieltheoretische Betrachtung) bietet einen spieltheoretischen Ansatz zur Erklärung von PWYW. Kapitel 5 (Zusammenfassung und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschung.
Welche Methoden werden in der Seminararbeit angewendet?
Die Seminararbeit kombiniert verschiedene Methoden: Sie analysiert empirische Studien zu PWYW, betrachtet verhaltenstheoretische Aspekte des Käuferverhaltens und nutzt spieltheoretische Modelle zur Erklärung des Phänomens. Die Arbeit stützt sich auf Literaturrecherche und die Auswertung bestehender Forschungsdaten.
Welche Ergebnisse werden in der Seminararbeit präsentiert?
Die Seminararbeit präsentiert Ergebnisse zur Praxistauglichkeit von PWYW, beleuchtet die Motivationen der Käufer für positive Zahlungen und den Einfluss von Referenzpreisen und sozialen Normen auf das Preisverhalten. Die spieltheoretische Betrachtung bietet zusätzliche Erklärungsansätze für das PWYW-Modell. Die Ergebnisse werden in den einzelnen Kapiteln und der Zusammenfassung detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Pay What You Want (PWYW), Preisgestaltung, Käuferverhalten, Referenzpreis, soziale Normen, Spieltheorie, Marktübersättigung, Preisdifferenzierung, Zahlungsbereitschaft, Nutzenmaximierung, Transaktionskosten, Mundpropaganda, Marketing, Gesundheitsmanagement.
Welche praktische Relevanz hat die Seminararbeit?
Die Seminararbeit hat praktische Relevanz für Unternehmen, die innovative Preismodelle erwägen. Sie liefert Erkenntnisse zum Käuferverhalten unter PWYW-Bedingungen und kann Unternehmen bei der Entscheidung unterstützen, ob PWYW für ihr spezifisches Produkt oder ihre Dienstleistung geeignet ist. Die Ergebnisse bieten außerdem Einblicke in die Gestaltung und Optimierung von PWYW-Strategien.
- Citar trabajo
- Silke Jeanette Schwendemann (Autor), 2010, Pay what you want? Forschungsstand zu dem Pricing – Instrument und Implikationen für die Praxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175127