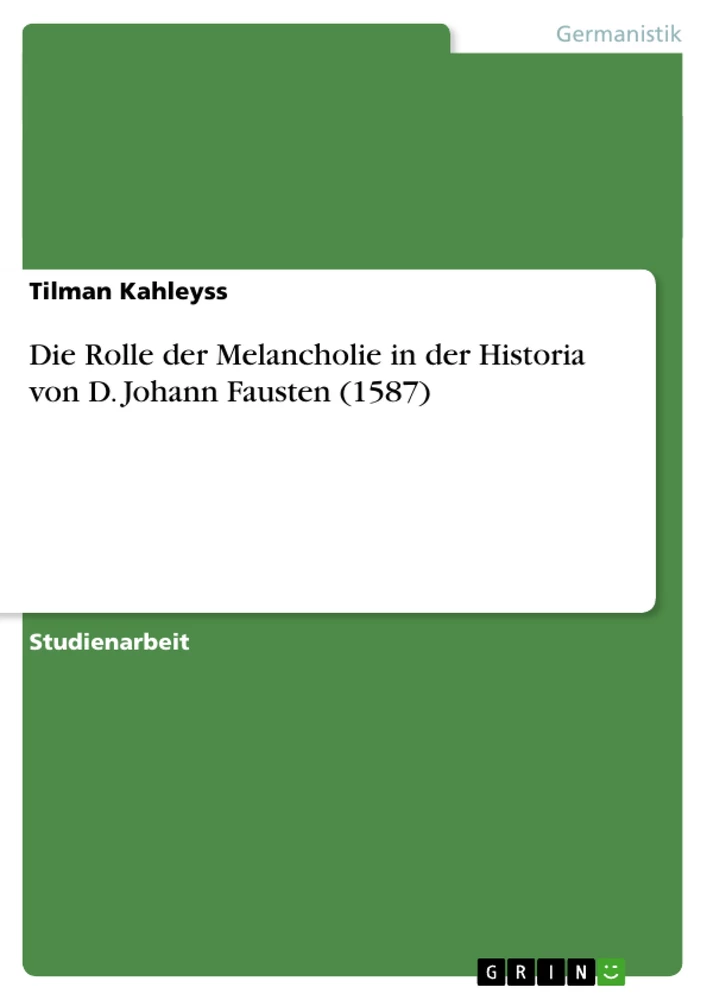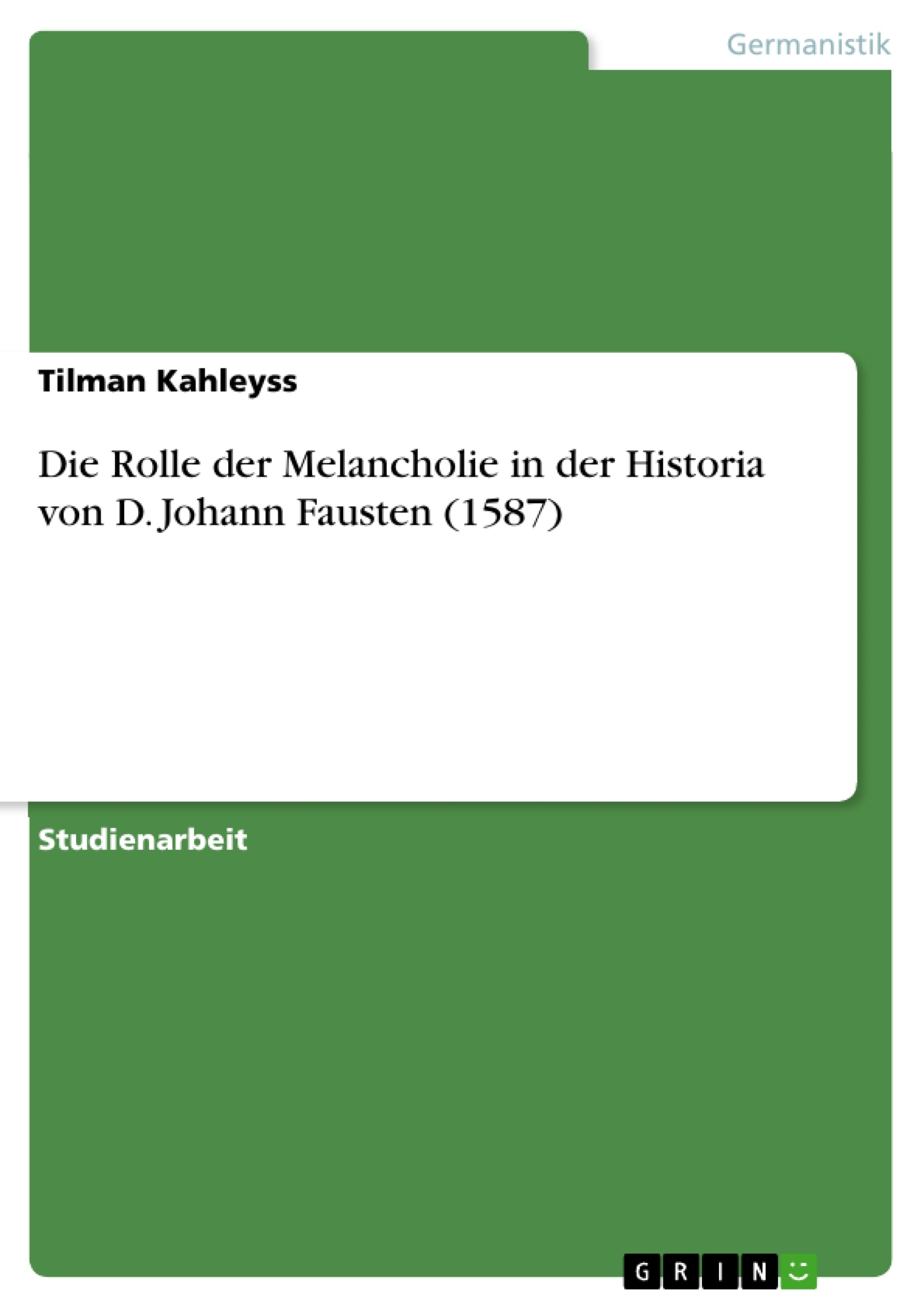Das Wort Melancholie leitet sich von dem griechischen Begriff melancholia ab, was so viel wie „schwarze Galle“ (von dem griechischen melaina chole) bedeutet. Es bezeichnet einen seelischen Zustand von Schwermut oder Traurigkeit, der in der Regel auf keinen bestimmten Auslöser oder Anlass zurückgeht. In Bezug auf eine psychische Disposition oder ein Krankheitsbild ist der Begriff Melancholie im 20. Jahrhundert weitgehend durch den Begriff der Depression ersetzt worden .
Anhand dieser Einführung kann man gut erkennen, dass es sehr verschiedene Ansätze zum Begriff der Melancholie gibt, die nicht nur zeitlich, sondern auch faktisch differenziert werden müssen.
Für die Historia des D. Johann Fausten hat die Melancholie eine besondere Bedeutung. Es wird sich zeigen, in wie weit die Beschreibung der Person des Schwarzkünstlers der damaligen Auffassung der Melancholie entspricht und worin sie sich zeigt. Fest steht, dass ohne dieses Charaktermerkmal die Erzählung so nicht hätte funktionieren können.
Zuerst gehe ich auf die Entstehungsgeschichte und die Bedeutung des Begriffs der Melancholie ein um sie danach auf die Figur des D. Johann Fausten zu übertragen und auf Übereinstimmungen zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Allgemeine Einleitung
- Begriff der Melancholie: Bedeutung und Entwicklung
- Melancholie in der Historia von 1587
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle der Melancholie in der Historia von D. Johann Fausten (1587) und analysiert, inwiefern die Beschreibung des Schwarzkünstlers der damaligen Auffassung der Melancholie entspricht.
- Die Entwicklung des Melancholie-Begriffs im Kontext der Vier-Säfte-Lehre
- Die Charakteristika des Melancholikers gemäß der mittelalterlichen Medizin und Astrologie
- Die Verbindung von Melancholie mit dem Planeten Saturn und dessen Symbolik
- Die Übertragung der Melancholie-Konzeption auf die Figur des D. Johann Fausten in der Historia
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Allgemeine Einleitung: Die Einleitung erläutert den Ursprung des Begriffs Melancholie aus dem griechischen „melancholia“ und beschreibt seine Bedeutung im Kontext der damaligen Zeit. Sie betont die besondere Relevanz der Melancholie für die Historia von D. Johann Fausten und kündigt den Fokus der Arbeit auf die Analyse der Figur des Schwarzkünstlers in Bezug auf die Melancholie-Konzeption an.
- Begriff der Melancholie: Bedeutung und Entwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Melancholie-Begriffs im Zusammenhang mit der Vier-Säfte-Lehre. Es beschreibt die Lehre der „quattuor homores“ und ihre Entstehung aus der Verbindung der pythagoräischen Zahlensymbolik, den Elementen von Empedokles und den Qualitäten dieser Elemente laut Philistion. Der Fokus liegt auf der schwarzen Galle als Ursache für Melancholie und deren Verbindung mit bestimmten Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen und körperlichen Merkmalen. Das Kapitel zeigt die Ambivalenz der Definition von Melancholie als Krankheit oder Geisteszustand auf und diskutiert die zugehörigen Symptome.
- Melancholie in der Historia von 1587: Dieses Kapitel analysiert die Figur des D. Johann Fausten in der Historia von 1587 und untersucht, inwiefern seine Beschreibung der damaligen Auffassung der Melancholie entspricht. Es beleuchtet die Verbindung zwischen Fausts Charakter und den Eigenschaften, die im vorherigen Kapitel dem Melancholiker zugeschrieben wurden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Melancholie in der Historia von D. Johann Fausten (1587), analysiert die historische Entwicklung des Melancholie-Begriffs im Kontext der Vier-Säfte-Lehre und untersucht die Verbindung von Melancholie mit dem Planeten Saturn und dessen Symbolik. Weitere wichtige Begriffe sind: Schwarze Galle, Geisteszustand, Krankheit, Charaktereigenschaften, Verhalten, Astrologie.
Häufig gestellte Fragen zur Melancholie bei Fausten
Was bedeutet der Begriff Melancholie historisch?
Der Begriff stammt vom griechischen „melancholia“ (schwarze Galle) und bezeichnete ursprünglich einen Zustand von Schwermut, der auf der Vier-Säfte-Lehre basierte.
Welche Rolle spielt die Melancholie in der Historia von D. Johann Fausten?
Die Melancholie ist ein zentrales Charaktermerkmal Fausts. Ohne diese psychische Disposition hätte die Erzählung über den Schwarzkünstler im Jahr 1587 nicht funktioniert.
Wie hängen Melancholie und der Planet Saturn zusammen?
In der mittelalterlichen Astrologie wurde der Melancholiker dem Planeten Saturn zugeordnet, was seine Eigenschaften wie Ernsthaftigkeit und Schwermut symbolisch untermauerte.
Was ist die Vier-Säfte-Lehre?
Es ist ein medizinisches Konzept der Antike, das Gesundheit und Charakter durch das Gleichgewicht von vier Körperflüssigkeiten erklärt, wobei schwarze Galle für Melancholie verantwortlich war.
Wurde Melancholie damals als Krankheit oder Geisteszustand gesehen?
Die Definition war ambivalent; sie wurde sowohl als körperliche Krankheit aufgrund eines Säfte-Ungleichgewichts als auch als spezifischer geistiger Zustand betrachtet.
- Citar trabajo
- Tilman Kahleyss (Autor), 2010, Die Rolle der Melancholie in der Historia von D. Johann Fausten (1587), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175220