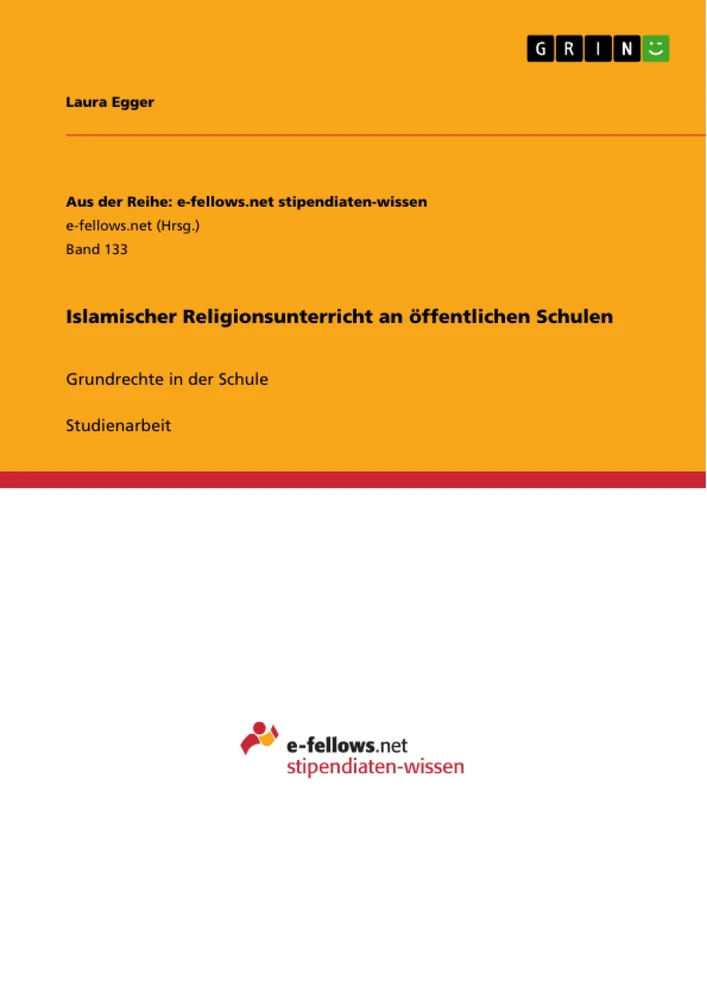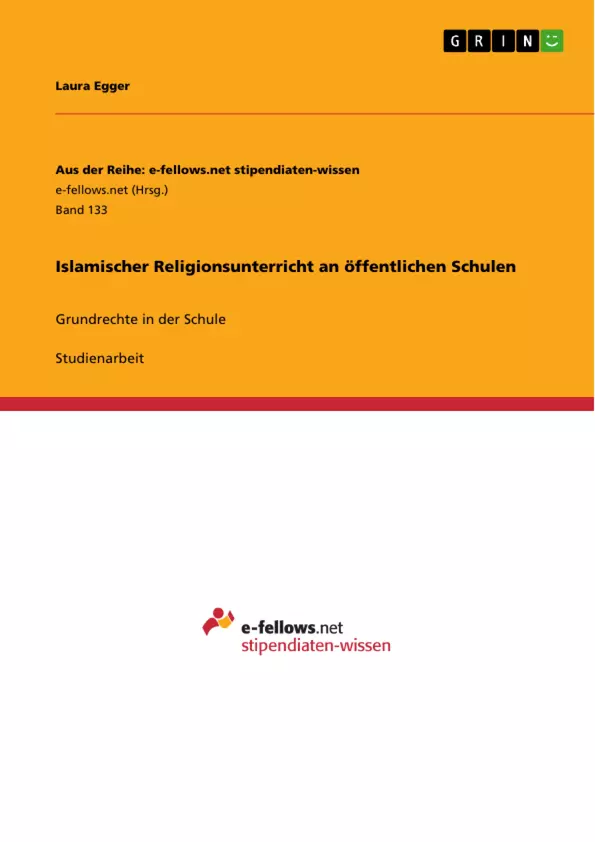Sollen muslimische Kinder an öffentlichen Schulen ebenso Religionsun-terricht in ihrem eigenen Glauben erhalten wie christliche Kinder? Diese Frage stellt sich sowohl unter dem Aspekt der staatlichen Gleichbehand-lung der verschiedenen Religionsgemeinschaften, als auch aufgrund der in Deutschland seit langem präsenten - und in den letzten Monaten wie-der verstärkt aufgeflammten - Integrationsdebatte. Ist ein islamischer Religionsunterricht an öffentlichen Schulen für die Integration von Mus-limen in unserer Gesellschaft vorteilhaft, da „die Integration der musli-mischen Bevölkerung nur gelingen kann, wenn sie auch die religiöse Seite ihres Lebens mit einbezieht“ ? Oder ist davon auszugehen, dass ein separater Religionsunterricht für muslimische Schüler Kinder unter-schiedlichen Glaubens verstärkt voneinander abgrenzt und folglich einer Integration eher entgegenwirkt? Welche Vorteile bringt es, den islami-schen Religionsunterricht auf den staatlichen Bereich der öffentlichen Schulen auszudehnen, obwohl es bereits Koranschulen gibt? Ist es besser, staatliche Kontrolle über die religiöse Unterweisung der Kinder und Ju-gendlichen zu haben und falls ja, wie weit soll der Einfluss des Staates auf den Religionsunterricht reichen dürfen?
Bevor diese integrationspolitischen Fragen beantwortet werden, soll diese Arbeit die verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen Religions-unterricht an öffentlichen Schulen klären. Das Staatskirchenrecht steht mehr und mehr „vor den Schwierigkeiten zwischen Staat und nichtchrist-lichen Religionen“ , daher liegt der Fokus hierbei auf den Rechtsfragen und der Problematik, die sich bei der Einführung eines islamischen Reli-gionsunterrichts stellen, und auf zwei bereits durchgeführten Schulversu-chen einer islamischen religiösen Unterweisung. Es stellt sich die Frage, wie mit Art. 7 Abs. 3 GG, der den Religionsunterricht zum Verfassungs-gut macht, umgegangen werden soll, wenn nicht alle seine Vorausset-zungen gegeben sind. Anschließend soll die Frage beantwortet werden, in welchem Umfang das deutsche Grundgesetz einen Anspruch auf Religionsunterricht gewährleistet. Schließlich soll der oben bereits erwähnten integrations- und gesellschaftspolitischen Bedeutung eines islamischen Religionsunterrichts Rechnung getragen werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung.
- B. Islamischer Religionsunterricht in Deutschland.
- I. Verfassungsrechtlicher Begriff des Religionsunterrichts.
- II. Anforderungen des Grundgesetzes (Art. 7 Abs. 3 GG).
- 1. Ausnahme „Bremer Klausel“ (Art. 141 GG).
- 2. Maßstab des Art. 7 Abs. 3 GG.
- a) Neutralitätsgebot des Staates
- b) Übereinstimmung mit den Religionsgemeinschaften (Selbstorganisation der Muslime als Ansprechpartner)
- aa) Strukturmerkmale
- bb) Islamische Religionsgemeinschaften.
- c) Religionsunterricht
- d) Ordentliches Lehrfach
- e) Inhalte des Religionsunterrichts
- aa) Staatlich normierte Bildungsziele
- bb) Einhaltung der Rechtsordnung
- cc) Einhaltung der staatlichen Ordnung
- C. Islamische religiöse Unterweisung
- I. Vereinbarkeit mit höherrangigem Landesrecht.
- II. Vereinbarkeit mit der Verfassung.
- 1. Vereinbarkeit mit Art. 7 Abs. 3 S. 2 GG
- a) Eingriff in das Neutralitätsgebot.
- b) Eingriff in die institutionelle Garantie und das Grundrecht der Religionsgemeinschaften.
- c) Rechtfertigung
- aa) Verfassungsnähere Rechtslage.
- bb) Ergebnis Rechtfertigung.
- D. Verfassungsrechtlicher Anspruch auf Religionsunterricht (Gewährleistungsumfang)
- I. Institutionelle Garantie
- II. Subjektive Rechte (Grundrechte).
- 1. Religionsgemeinschaften.
- a) Abwehrrecht
- b) Leistungsrecht
- 2. Eltern und Schüler
- E. Gesellschaftliche Bedeutung eines islamischen Religionsunterrichts.
- I. Staatliche Kulturaufgabe.
- II. Integrationspolitisches Interesse des Staates.
- 1. Werteerziehung zur Integrationsförderung.
- 2. Problematik der Segregation.
- 3. Kontrolle über Inhalte des religiösen Unterrichts.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Deutschland. Sie fokussiert sich auf die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz, insbesondere mit Art. 7 Abs. 3 GG, der den Religionsunterricht als Verfassungsbestandteil anerkennt. Des Weiteren wird die Frage nach dem Umfang des Anspruchs auf Religionsunterricht im deutschen Grundgesetz beleuchtet. Schließlich widmet sich die Arbeit der gesellschaftlichen Bedeutung eines islamischen Religionsunterrichts im Kontext der Integration und der kulturellen Vielfalt in Deutschland.
- Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für islamischen Religionsunterricht
- Vereinbarkeit mit Art. 7 Abs. 3 GG und dem Neutralitätsgebot des Staates
- Institutionelle Garantie und subjektive Rechte im Zusammenhang mit Religionsunterricht
- Integrationspolitische Relevanz eines islamischen Religionsunterrichts
- Kulturelle Relevanz und Bedeutung für die Förderung der Vielfalt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die grundlegende Fragestellung der Arbeit vor: Sollen muslimische Kinder an öffentlichen Schulen denselben Zugang zu Religionsunterricht in ihrem Glauben erhalten wie christliche Kinder? Die Einleitung verdeutlicht die Relevanz der Thematik sowohl im Hinblick auf die staatliche Gleichbehandlung als auch in der Integrationsdebatte. Sie stellt verschiedene Argumentationslinien und Fragen in den Vordergrund, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
Kapitel B beschäftigt sich mit dem verfassungsrechtlichen Begriff des Religionsunterrichts in Deutschland und den Anforderungen, die das Grundgesetz (Art. 7 Abs. 3 GG) an ihn stellt. Es wird die Ausnahme der „Bremer Klausel“ (Art. 141 GG) erläutert und der Maßstab des Art. 7 Abs. 3 GG im Hinblick auf das Neutralitätsgebot des Staates und die Übereinstimmung mit den Religionsgemeinschaften beleuchtet. Die Kapitel diskutieren die Anforderungen an die Strukturmerkmale, die islamischen Religionsgemeinschaften, die Inhalte des Religionsunterrichts und die staatliche Kontrolle über die Inhalte.
Kapitel C widmet sich der Vereinbarkeit einer islamischen religiösen Unterweisung mit dem höherrangigem Landesrecht und der Verfassung. Hierbei wird die Frage der Vereinbarkeit mit Art. 7 Abs. 3 S. 2 GG im Hinblick auf den Eingriff in das Neutralitätsgebot, die institutionelle Garantie und die Grundrechte der Religionsgemeinschaften behandelt. Es wird die Rechtfertigung für einen solchen Eingriff diskutiert und anhand von Beispielen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern erläutert.
Kapitel D untersucht den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Religionsunterricht, indem die institutionelle Garantie und die subjektiven Rechte (Grundrechte) der Religionsgemeinschaften, Eltern und Schüler im Detail beleuchtet werden. Der Fokus liegt auf dem Abwehrrecht und dem Leistungsrecht der Religionsgemeinschaften.
Kapitel E befasst sich mit der gesellschaftlichen Bedeutung eines islamischen Religionsunterrichts und erläutert die staatliche Kulturaufgabe, die er erfüllt. Es werden die integrationspolitischen Interessen des Staates im Hinblick auf die Werteerziehung, die Problematik der Segregation und die Kontrolle über die Inhalte des religiösen Unterrichts untersucht.
Schlüsselwörter
Islamischer Religionsunterricht, Grundgesetz, Art. 7 Abs. 3 GG, Neutralitätsgebot, Religionsgemeinschaften, staatliche Kontrolle, Integrationspolitik, kulturelle Vielfalt, Werteerziehung, Segregation, Verfassungsrecht, Schulwesen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was sagt Artikel 7 Abs. 3 des Grundgesetzes über Religionsunterricht?
Er macht den Religionsunterricht zum ordentlichen Lehrfach und stellt ihn unter den Schutz der Verfassung, sofern bestimmte Voraussetzungen der Religionsgemeinschaften erfüllt sind.
Welche Hürden gibt es für einen islamischen Religionsunterricht?
Ein Hauptproblem ist die Organisation der Muslime als klare Ansprechpartner (Religionsgemeinschaften) und die Einhaltung des staatlichen Neutralitätsgebots.
Was ist die „Bremer Klausel“ (Art. 141 GG)?
Sie stellt eine verfassungsrechtliche Ausnahme dar, nach der die Bestimmungen des Art. 7 Abs. 3 GG in Ländern, in denen am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand, keine Anwendung finden.
Fördert separater Religionsunterricht die Integration oder die Segregation?
Die Debatte ist zwiespältig: Einerseits kann er durch Wertevermittlung die Integration fördern, andererseits wird befürchtet, dass er Kinder unterschiedlichen Glaubens voneinander abgrenzt.
Welchen Vorteil hat staatlich kontrollierter islamischer Unterricht gegenüber Koranschulen?
Der Staat erhält Kontrolle über die Lehrinhalte und kann sicherstellen, dass diese mit der demokratischen Rechtsordnung und den Bildungszielen der öffentlichen Schule übereinstimmen.
- Citation du texte
- Laura Egger (Auteur), 2011, Islamischer Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175653