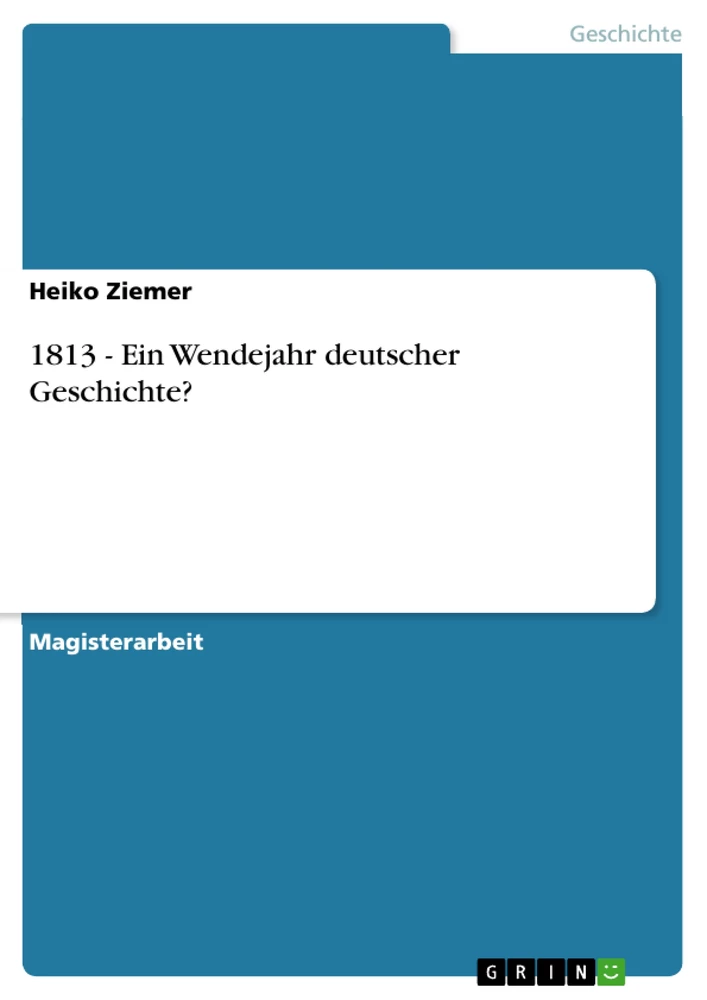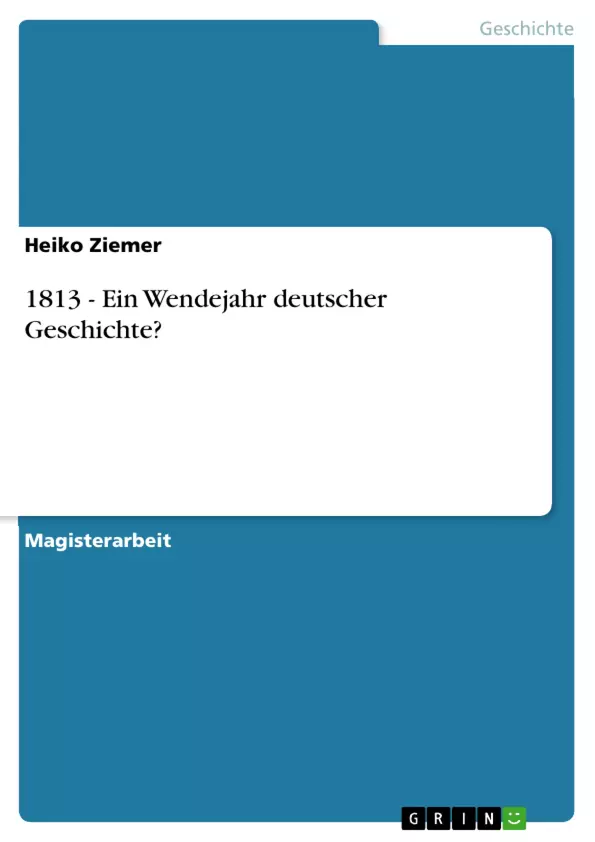Das Jahr 1813 wirkt wie ein Brennpunkt, in dem sich die epochalen Umbrüche der vorherigen Jahre sammeln und gebündelt auf die nachfolgenden Jahrzehnte weiterstrahlen. Das „Schicksalsjahr 1813“ wird von der Geschichtswissenschaft unterschiedlich beurteilt. Die Arbeit folgt den bestehenden Forschungslinien und versucht deren Objektivität zu beurteilen. Deshalb wird provokativ gefragt, ob es ein Befreiungskrieg der Fürsten war, ein Freiheitskrieg der Patrioten oder ein Volkskrieg der Armen? Wer waren die führenden Agitatoren in den Befreiungskriegen und wieviel trug ihr Handeln zur Herausbildung einer deutschen Nation bei? Die zentrale Frage lautet, wer die künftige Trägerschicht einer deutschen Nationalbewegung bildete und ob sich diese bereits 1813 erkennen ließ?
Eine zusätzliche Unterteilung erfolgt territorial: anhand des politischen und wirtschaftlichen Wandels lassen sich große regionale Unterschiede in Preußen und Norddeutschland, in den Rheinbundstaaten und in den von Frankreich annektierten linksrheinischen Gebieten aufweisen. Mit der Betrachtung der unterschiedlichen Trägerschichten und der Untersuchung verschiedener Regionen soll ein Querschnitt des „gesamten Deutschlands“ unternommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Befreiungskrieg der Fürsten?
- Preußens zerstörtes Selbstbewusstsein
- Wandel der Loyalität: Die Konvention von Tauroggen
- Friedrich Wilhelm III. - Preußens zaudernder Monarch
- Der umworbene Bündnispartner Österreich
- Die neue Souveränität der Rheinbundstaaten von Napoleons Gnaden
- Ein Freiheitskrieg der Patrioten?
- Preußisch-Deutsche Patrioten
- Konstruktion des deutschen Nationalcharakters
- Die deutsche Öffentlichkeit
- Propaganda und Presse
- Das Komitee für deutsche Angelegenheiten und die Deutsche Legion
- Das Militär- Die Schule der Nation
- Demokratisierung des Heeres
- Die Freiwilligenverbände
- Patriotische Frauen
- Das Volkstum der Deutsch-Österreicher
- Bürgerlicher Rheinbundpatriotismus
- Ein Volkskrieg der Armen?
- Preußen und Norddeutschland
- Wandel der bestehenden Ordnung und wirtschaftlicher Niedergang
- Kollektive Spendenbereitschaft und Gotteserfahrung
- Die süddeutschen Reformstaaten
- Die napoleonischen Modellstaaten
- Die Sozialdisziplinierung der linksrheinischen Gebiete
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Jahr 1813 als Wendepunkt in der deutschen Geschichte, in dem sich die Umbrüche der vorangegangenen Jahre bündeln und auf die nachfolgenden Jahrzehnte ausstrahlen. Der Fokus liegt auf der Frage, ob es sich bei den Befreiungskriegen um einen Krieg der Fürsten, der Patrioten oder der Armen handelte und wie sich diese unterschiedlichen Perspektiven im Kontext der napoleonischen Epoche gegenüberstehen. Die Arbeit untersucht die vielfältigen Strömungen, die im Jahr 1813 zusammenliefen, und beleuchtet die Bedeutung dieses Jahres für die nationale Identität und die politische Ordnung Deutschlands.
- Die Rolle Preußens im Kampf gegen Napoleon und die Entwicklung des preußischen Selbstbewusstseins
- Die Entstehung des deutschen Nationalgefühls und die Rolle von Patriotismus und Propaganda
- Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges auf die Bevölkerung in verschiedenen Regionen Deutschlands
- Die Herausbildung eines „lockeren Staatenbundes“ und die bleibende Bedeutung des Jahres 1813 für die deutsche Geschichte
- Die Ambivalenz des Jahres 1813 zwischen traditionellem Fürstenstaat und fortschrittlichem Bürgertum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt das Jahr 1813 als „Wende-Epoche“ in der deutschen Geschichte vor. Sie skizziert die wichtigsten Entwicklungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, die zum Umbruch führten, und beleuchtet die Rolle der Aufklärung, der französischen Revolution und des aufstrebenden Bürgertums. Das erste Kapitel befasst sich mit dem Befreiungskrieg aus der Perspektive der Fürsten. Es analysiert die Rolle Preußens, das zunächst zögerlich in den Krieg zog, und beleuchtet die diplomatischen Bemühungen um Bündnisse mit Österreich und Russland. Das zweite Kapitel widmet sich den „Freiheitskriegen der Patrioten“. Hier wird die Entstehung des deutschen Nationalgefühls und die Rolle von Propaganda, Presse und Militär beleuchtet. Die Bedeutung der Freiwilligenverbände und die Rolle der Frauen im Widerstand gegen Napoleon werden untersucht. Das dritte Kapitel geht auf die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges auf die Bevölkerung ein. Dabei werden die unterschiedlichen Erfahrungen in Preußen, den süddeutschen Reformstaaten, den napoleonischen Modellstaaten und den linksrheinischen Gebieten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Jahr 1813 im Kontext der napoleonischen Epoche, der deutschen Nationalgeschichte, den Befreiungskriegen, dem Fürstenstaat, dem Bürgertum, der Aufklärung, der Propaganda, dem Patriotismus, dem Militär, den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges, der Rolle der Frauen, der politischen Ordnung, der Rheinbundstaaten, dem Deutschen Bund und der „Wende-Epoche“ in der deutschen Geschichte.
- Citation du texte
- Heiko Ziemer (Auteur), 2010, 1813 - Ein Wendejahr deutscher Geschichte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175769