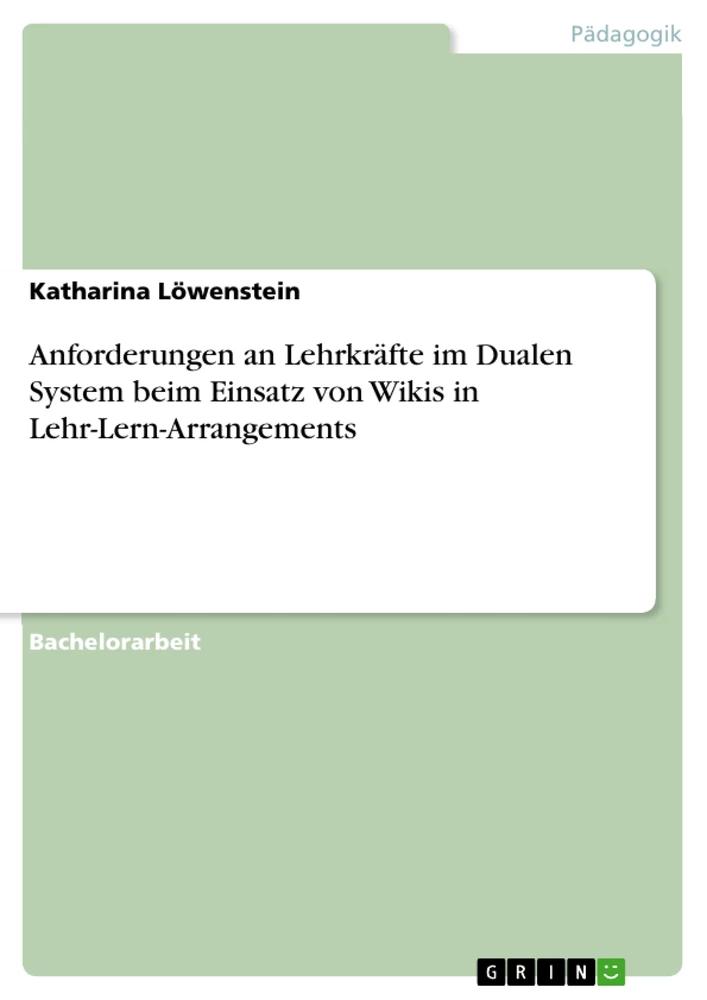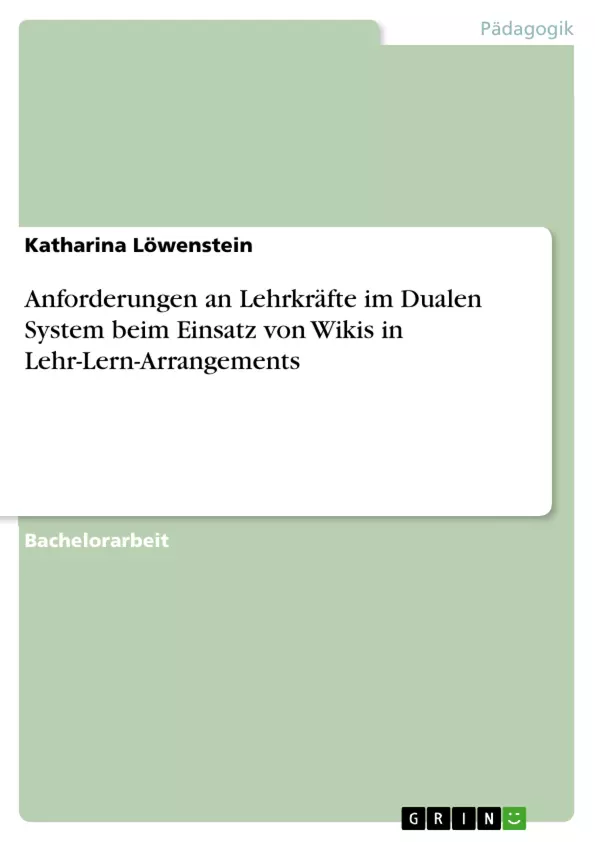Hinsichtlich der aktuellen Dynamik des Web 2.0 steht das deutsche Bildungssystem vor
der Herausforderung, auf diese Entwicklungen zu reagieren. Dies erfordert ein Lernverständnis,
das insbesondere aus konstruktivistischer Perspektive seit Jahren gefordert,
aber in der Praxis kaum durchgesetzt wird. Die Aufgabe der Wissensvermittlung steht in
einem konstruktivistisch orientierten Unterricht nicht im Vordergrund. Vielmehr werden
Lehrerinnen und Lehrer zu Experten für die Gestaltung von Lernsituationen, in denen
sie Lernprozesse moderieren, passiv begleiten und damit den Erkenntnisgewinn der Lernenden
unterstützen (vgl. RÖLL 2010, S. 246). Dementsprechend ist eine Orientierung an
bestehende Wahrnehmungsstrukturen und Lernpräferenzen von Lernenden unumgänglich.
Die Integration von Web 2.0-Technologien, wie das Wiki, eröffnet die Möglichkeit
einen Unterricht nach diesen Anforderungen zu gestalten und kann dem pädagogischen
Alltag innovative Impulse ermöglichen (vgl. RÖLL 2010, S. 201). Meine eigene Berufsschulzeit
vor einigen Jahren kann ich zusammenfassend als ein Treffen beschreiben, das
dazu diente, unsere Schulbücher zu lesen und daraus Aufgaben zu bearbeiten. Die
Unterrichtsinhalte nahm ich keinesfalls in einer Beziehung zu meiner Ausbildung wahr.
Daraus folgte mein Desinteresse zu vielen Themen und meine einzige Lernmotivation
war letztlich die Note als Evaluation meiner Leistungen. Aus diesen Erfahrungen sowie
mit der Motivation nach meinem Studium an der Universität Paderborn Berufsschullehrerin
zu werden, sehe ich das Medium Wiki als eine Chance, einen effektiven und praxisnahen
Unterricht sowohl auf der Schüler- als auch auf der Lehrerseite zu gewährleisten.
Die ursprüngliche Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern ist es, Wissen zu vermitteln
und zu teilen. Das Produkt der Arbeit von Lehrkräften steckt in den Köpfen der Schülerinnen
und Schülern. Wir alle definieren uns über unser Wissen, das aber per se nicht
sichtbar ist. Sichtbar wird es erst, wenn es festgehalten wird. Dies geschieht mit
Büchern, der Wandtafel, dem Overheadprojektor und gelegentlich auch mit dem Beamer.
Diese Medien sind alltäglicher Bestandteil von zahlreichen Schulen, haben aber
eine örtliche und zeitliche Begrenzung. Mit Wikis werden beide Grenzen überwunden:
Wissen wird weltweit, zeitgleich und jederzeit sichtbar.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Aufbau und Inhalt der Arbeit
- Web 2.0
- Wikis
- Funktionen
- Anforderungen beim Einsatz von Wikis
- Das Duale System
- Systemorganisation des Dualen Systems
- Lehrkräfte an Berufsschulen
- Anforderungen beim Einsatz von Wikis in der Berufsschule
- Anforderungen an die Berufsschule
- Anforderungen an die Lehrkräfte
- Technische Anforderungen
- Erfahrungen und Motivation
- Didaktische Integration
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit den Anforderungen an Lehrkräfte im dualen System beim Einsatz von Wikis in Lehr-Lern-Arrangements. Sie analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich aus der Integration von Web 2.0-Technologien, insbesondere Wikis, in den beruflichen Bildungsprozess ergeben. Die Arbeit untersucht die Funktionen von Wikis, die Anforderungen an ihren Einsatz sowie die spezifischen Herausforderungen für Lehrkräfte im dualen System.
- Die Rolle von Web 2.0-Technologien im Bildungssystem
- Die Funktionen und Möglichkeiten von Wikis als Lernplattform
- Die spezifischen Anforderungen an Lehrkräfte beim Einsatz von Wikis in der Berufsschule
- Die Integration von Wikis in die Organisation und Prozesse des dualen Systems
- Die Bedeutung von didaktischer Integration und den erforderlichen Kompetenzen von Lehrkräften
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die Arbeit, indem es die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen Entwicklungen im Web 2.0 und im Bildungssystem beleuchtet. Es erläutert die Notwendigkeit, Lernprozesse zu gestalten, die den Anforderungen des konstruktivistischen Lernverständnisses gerecht werden.
- Aufbau und Inhalt der Arbeit: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit und die behandelten Themenbereiche.
- Web 2.0: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in das Konzept des Web 2.0 und seine Auswirkungen auf das Bildungssystem. Es beleuchtet die Bedeutung von Web 2.0-Technologien für den Wissensaustausch, die kollaborative Zusammenarbeit und die Gestaltung innovativer Lernumgebungen.
- Wikis: Dieses Kapitel befasst sich mit den Funktionen von Wikis und deren Eignung als Lernplattform. Es werden die technischen Möglichkeiten und didaktischen Vorteile von Wikis im Kontext des Unterrichts hervorgehoben.
- Das Duale System: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Organisation und Struktur des dualen Systems. Es analysiert die spezifischen Herausforderungen und Anforderungen im beruflichen Bildungsprozess und die Rolle der Lehrkräfte in diesem System.
- Anforderungen beim Einsatz von Wikis in der Berufsschule: Dieses Kapitel untersucht die spezifischen Anforderungen an die Berufsschule und die Lehrkräfte beim Einsatz von Wikis im Unterricht. Es beleuchtet die technischen Voraussetzungen, die didaktischen Kompetenzen sowie die notwendigen Erfahrungen und Motivationen der Lehrkräfte.
Schlüsselwörter
Diese Bachelorarbeit konzentriert sich auf die Integration von Wikis im dualen System, insbesondere auf die Anforderungen an Lehrkräfte beim Einsatz dieser kollaborativen Lernplattform. Die Arbeit analysiert die Funktionen von Wikis, die Herausforderungen ihrer Implementierung im beruflichen Bildungsprozess und die damit verbundenen Kompetenzen von Lehrkräften. Zentrale Themen sind die didaktische Integration von Wikis, die Nutzung von Web 2.0-Technologien im Unterricht, die Gestaltung von lernförderlichen Umgebungen und die Bedeutung von Erfahrungen und Motivationen von Lehrkräften.
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bietet der Einsatz von Wikis in der Berufsschule?
Wikis ermöglichen einen effektiven, praxisnahen und ortsunabhängigen Wissenstransfer. Sie unterstützen kollaboratives Lernen und machen Wissen weltweit und jederzeit sichtbar.
Welche Anforderungen werden an Lehrkräfte beim Einsatz von Wikis gestellt?
Lehrkräfte müssen über technische Kompetenzen verfügen, didaktisch zur Integration in den Unterricht befähigt sein und eine hohe Motivation für innovative Lernumgebungen mitbringen.
Wie verändert sich die Rolle der Lehrer durch Web 2.0-Technologien?
Die Rolle wandelt sich vom reinen Wissensvermittler hin zum Experten für die Gestaltung von Lernsituationen, der Lernprozesse moderiert und passiv begleitet (konstruktivistischer Ansatz).
Was ist das Ziel des konstruktivistischen Lernverständnisses?
Im Vordergrund steht nicht die reine Wissensvermittlung, sondern die Unterstützung der Lernenden beim aktiven Erkenntnisgewinn in selbst gestalteten Lernumgebungen.
Welche spezifischen Herausforderungen gibt es im dualen System?
Die Herausforderung liegt in der Koordination zwischen den Lernorten und der Anpassung der Wiki-Nutzung an die organisatorischen Strukturen der Berufsschule und der Ausbildungsbetriebe.
- Quote paper
- Katharina Löwenstein (Author), 2011, Anforderungen an Lehrkräfte im Dualen System beim Einsatz von Wikis in Lehr-Lern-Arrangements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175898