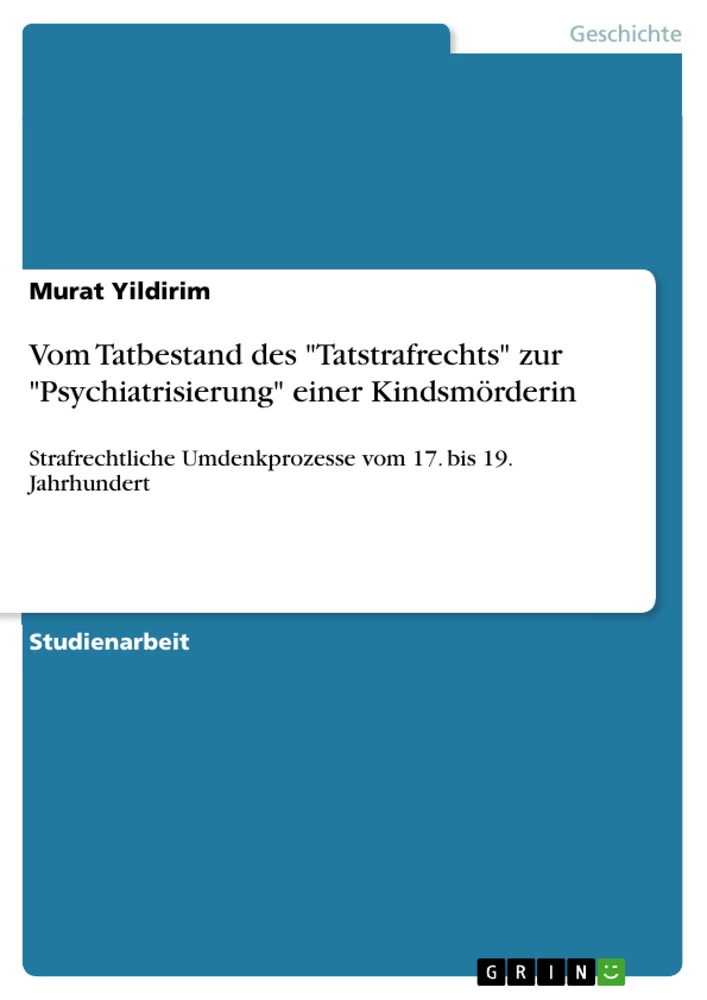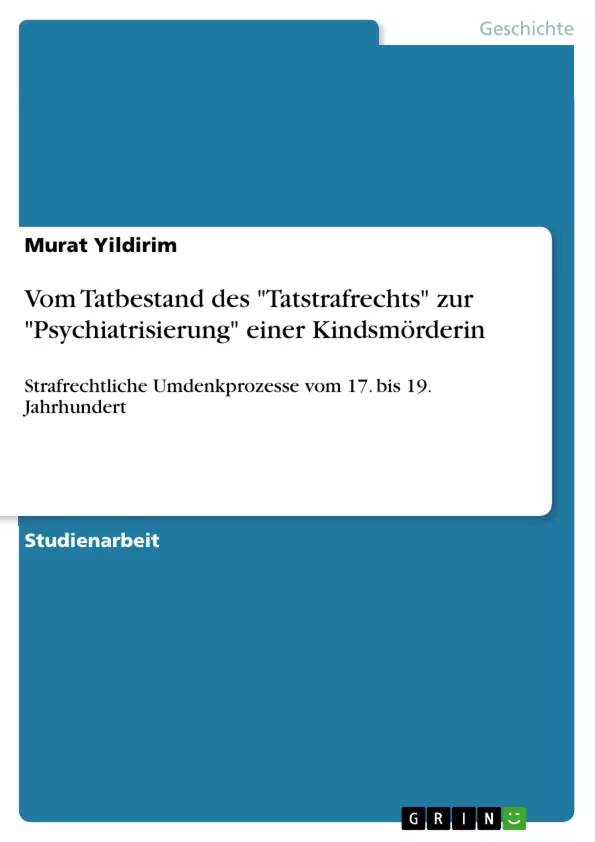Die Wandlung in der Behandlung, der Herangehensweise und dem Strafmaß eines Kindsmordes und an seiner mütterlichen Mörderin im Strafrecht der „Constitutio criminalis Bambergensis“ und aus deren Grundlage entstehende „Constitutio criminalis Carolina“ hat sich im Laufe des barockschen und aufklärerischen epochalen Zeitalter gewandelt. S
tand unter dem Tatbestand des Mordes am eigenen neugeborenen Kind noch zu Beginn des 16.Jhd die Todesstrafe durch Ertränken oder auch, zur effektiveren Abschreckung der Öffentlichkeit, das lebendig Begraben, Pfählen und auch mit glühenden Zangen auseinandergerissen zu werden, so hat sich an diesem Strafmaß an Kindsmörderinnen in diesen Epochen etwas geändert.
Im Rahmen der Aufklärung fand zu dieser Zeit ein Umdenkprozess in Bezug auf das strafrechtliche Denken der Menschen, geprägt durch die idealistische – humane, epochenspezifische Zeitströmung, statt. In dieser Arbeit sollen die Umdenkprozesse näher beleuchtet werden, die die Wandlung des Tatstrafrechts zu einer Hinterfragung der Persönlichkeit des Täters führt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialgeschichtliche Betrachtung des Kindsmordes
- Die Situation der typischen Kindsmörderin- Milieu und Beschäftigung
- Ursachen und Motive des Kindsmordes in der Literatur
- Bestrafung des Kindsmordes- Kindsmord im Strafrecht
- Das Strafrecht in der „Constitutio criminalis Carolina“
- Tat-, und Strafmaßbewertung
- Umdenkprozesse- Strafrechtliches Denken in der Zeit der Aufklärung
- Der Pionier: Friedrich II., König von Preußen (1740-1786)
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wandlung in der Behandlung und Bestrafung von Kindsmord und dessen Täterinnen im Strafrecht vom 17. bis 19. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf den Umdenkprozessen im strafrechtlichen Denken während der Aufklärung, die von der Tatbestandsbewertung hin zu einer Betrachtung der Persönlichkeit der Täterin führten.
- Sozialgeschichtlicher Kontext des Kindsmordes
- Ursachen und Motive des Kindsmordes
- Strafrechtliche Entwicklungen im 17. und 18. Jahrhundert
- Einfluss der Aufklärung auf das Strafrecht
- Wandel des strafrechtlichen Denkens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entwicklung der Strafverfolgung von Kindsmord und dessen Täterinnen, insbesondere den Wandel vom Fokus auf die Tatbestandsbewertung hin zu einer Betrachtung der Persönlichkeit der Täterin im Kontext der Aufklärung. Sie skizziert den Schwerpunkt der Arbeit: die Untersuchung der Umdenkprozesse im strafrechtlichen Denken dieser Epoche.
Sozialgeschichtliche Betrachtung des Kindsmordes: Dieses Kapitel analysiert die soziale Situation typischer Kindsmörderinnen, die überwiegend aus den unteren sozialen Schichten stammten und als Dienst- oder Bauernmägde arbeiteten. Die schwierigen Lebensumstände dieser Frauen, die oft Voll- oder Halbwaisen waren und von geringen Einkünften abhängig lebten, werden im Detail dargestellt und als potenzieller Hintergrund für Kindsmorde diskutiert. Der häufige Aufenthalt in Gemeinschaftsquartieren wird als weiterer Faktor für den Beginn einer unehelichen Lebensführung und somit potenziellen Motiv für Kindsmord genannt. Die Arbeit erklärt die soziale Situation und Lebensbedingungen dieser Frauen ausführlich, um den Kontext der Straftaten zu beleuchten.
Ursachen und Motive des Kindsmordes in der Literatur: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Ursachen und Motive für Kindsmord, wie Angst vor gesellschaftlichem Ansehen, materielle Not und impulsive Handlungen oder Unwissenheit. Es wird betont, dass eine detaillierte Untersuchung der Tatmotive den Rahmen der Arbeit sprengen würde und daher nur ein oberflächlicher Einblick gegeben wird.
Bestrafung des Kindsmordes- Kindsmord im Strafrecht: Das Kapitel beschreibt die Bestrafung von Kindsmord im Strafrecht der "Constitutio criminalis Carolina" und anderen Rechtsquellen. Es wird auf die drakonischen Strafen zu Beginn des 16. Jahrhunderts eingegangen, wie Ertränken, lebendig Begraben oder Töten mit glühenden Zangen, und die allmähliche Veränderung der Strafpraxis im Laufe der Zeit erläutert. Die Unterschiede in der Tat- und Strafmaßbewertung werden hier analysiert, und die verschiedenen Aspekte der rechtlichen Behandlung von Kindsmord werden beleuchtet.
Umdenkprozesse- Strafrechtliches Denken in der Zeit der Aufklärung: Hier wird der Wandel im strafrechtlichen Denken während der Aufklärung behandelt. Der Fokus liegt auf dem Übergang von einer rein auf die Tat ausgerichteten Bestrafung hin zu einer Betrachtung der Umstände und der Persönlichkeit der Täterin. Der König Friedrich II. von Preußen wird als ein Beispiel für den Beginn eines humaneren Strafrechts genannt, der den Weg für eine differenziertere Betrachtung von Straftaten ebnete. Das Kapitel analysiert den Einfluss der humanistischen Ideale der Aufklärung auf die Entwicklung des Strafrechts.
Schlüsselwörter
Kindsmord, Strafrecht, Aufklärung, Constitutio criminalis Carolina, Sozialgeschichte, Dienstmägde, Täterpersönlichkeit, Umdenkprozesse, Strafmaß, Motivforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wandel in der Behandlung und Bestrafung von Kindsmord
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Behandlung und Bestrafung von Kindsmord und dessen Täterinnen im Strafrecht vom 17. bis 19. Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt auf den Umdenkprozessen im strafrechtlichen Denken während der Aufklärung, die von der Tatbestandsbewertung hin zu einer Betrachtung der Persönlichkeit der Täterin führten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sozialgeschichtliche Aspekte des Kindsmordes, die Ursachen und Motive, die strafrechtliche Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert, den Einfluss der Aufklärung auf das Strafrecht und den Wandel des strafrechtlichen Denkens. Besonderes Augenmerk liegt auf der sozialen Situation der typischen Kindsmörderinnen (meist Dienst- oder Bauernmägde aus niederen sozialen Schichten).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur sozialgeschichtlichen Betrachtung des Kindsmordes, zu den Ursachen und Motiven, zur Bestrafung des Kindsmordes im Strafrecht (inkl. der „Constitutio criminalis Carolina“), zu den Umdenkprozessen in der Aufklärung (mit Fokus auf Friedrich II. von Preußen), eine Schlussbemerkung und ein Literaturverzeichnis.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Rechtsquellen und literarische Texte, um die Bestrafung von Kindsmord und die Entwicklung des Strafrechts darzustellen. Eine detaillierte Auflistung der verwendeten Literatur findet sich im Literaturverzeichnis.
Wie wird die soziale Situation der Kindsmörderinnen dargestellt?
Die Arbeit analysiert die schwierigen Lebensumstände der typischen Kindsmörderinnen, die oft aus armen Verhältnissen stammten, als Dienst- oder Bauernmägde arbeiteten und in Gemeinschaftsquartieren lebten. Diese Faktoren werden als potenzieller Hintergrund für Kindsmorde diskutiert.
Welche Motive für Kindsmord werden behandelt?
Die Arbeit gibt einen Überblick über verschiedene Motive, wie Angst vor gesellschaftlichem Ansehen, materielle Not, impulsive Handlungen oder Unwissenheit. Eine detaillierte Motivforschung würde jedoch den Rahmen der Arbeit übersteigen.
Wie wird die Bestrafung von Kindsmord im historischen Kontext beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die drakonischen Strafen des frühen 16. Jahrhunderts (Ertränken, lebendig Begraben etc.) und die allmähliche Veränderung der Strafpraxis im Laufe der Zeit. Die „Constitutio criminalis Carolina“ dient als wichtige Rechtsquelle. Die Unterschiede in der Tat- und Strafmaßbewertung werden analysiert.
Welche Rolle spielt die Aufklärung im Kontext der Arbeit?
Die Aufklärung wird als entscheidender Wendepunkt dargestellt, der einen Wandel im strafrechtlichen Denken von einer tatbezogenen hin zu einer persönlichkeitsorientierten Bestrafung einleitete. Friedrich II. von Preußen wird als Beispiel für einen humaneren Ansatz im Strafrecht genannt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung wird in einem gesonderten Kapitel zusammengefasst. Der genaue Inhalt der Schlussfolgerung ist aus dem vorliegenden Textfragment nicht vollständig ersichtlich.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Kindsmord, Strafrecht, Aufklärung, Constitutio criminalis Carolina, Sozialgeschichte, Dienstmägde, Täterpersönlichkeit, Umdenkprozesse, Strafmaß, Motivforschung.
- Citar trabajo
- Murat Yildirim (Autor), 2011, Vom Tatbestand des "Tatstrafrechts" zur "Psychiatrisierung" einer Kindsmörderin, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176174