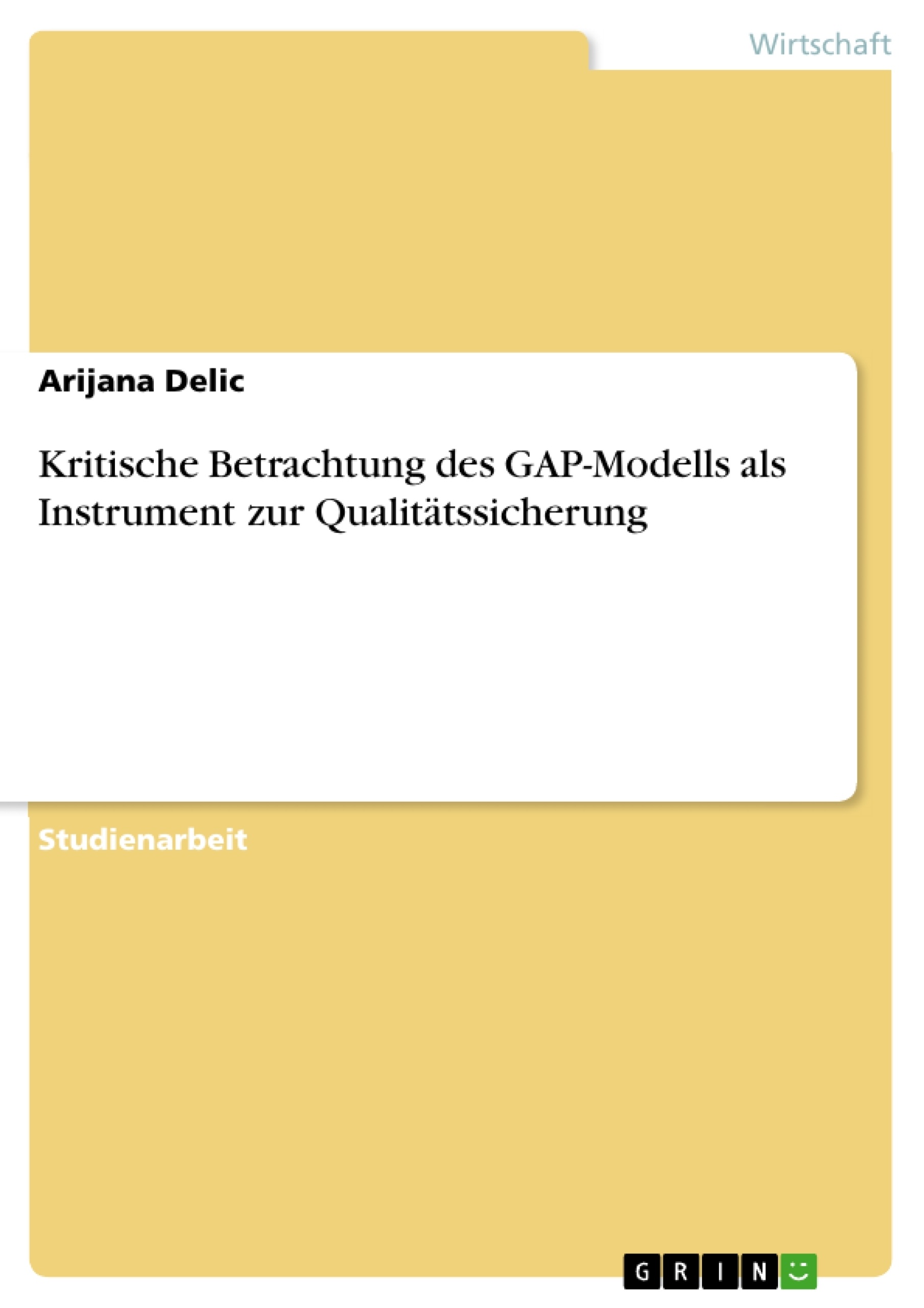Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis III
Abkürzungsverzeichnis III
1. Einleitung 1
2. Dienstleistungsqualität und Qualitätssicherung 2
3. Die Darstellung des GAP-Modells 4
4. Kritische Würdigung des GAP-Modell 9
5. Resümee 11
Literaturverzeichnis 13
1. Einleitung
Neben der wachsenden Bedeutung des tertiären Sektors in den letzten Jahren und der damit verbundenen steigenden Wettbewerbsintensität zwischen den einzelnen Dienstleistungsunternehmen , sowohl auf regionaler als auch internationaler Ebene, haben die steigenden Qualitätsansprüche der Kunden zusätzlich dazu beigetragen, dass sich die Erstellung einer hohen Dienstleistungsqualität [DLQ] zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor entwickelt hat.
Zudem haben Forschungsergebnisse und Erfahrungen in verschieden Unternehmen verdeutlicht, dass das Vorhandensein einer hohen DLQ sich positiv auf Kostenersparnisse, Gewinne und Marktanteile auswirkt.
Deshalb hat sich die Meinung durchgesetzt, dass eine ständige Op-timierung und Sicherstellung von DLQ in Anlehnung an die Kundenwünsche (Kundenorientierung), grundlegend für den Erfolg und die Überlebensfähigkeit von Unternehmen im Zuge der verschärften Konkurrenz sind.
Anschließend wird im zweiten Kapitel ein kurzer Überblick über DLQ und dessen Qualitätssicherung gegeben.
Das dritte Kapitel widmet sich der Darstellung des GAP-Modells nach den amerikanischen Forschern A. Parasuraman, V. A. Zeithaml und L. L. Berry. Auf diesen beiden Kapiteln aufbauend wird dann im vierten Kapitel, dem Hauptteil dieser Hausarbeit, eine kritische Betrachtung des GAP-Modells vorgenommen. Mit einem Resümee schließen die Ausführungen dieser Arbeit in Kapitel fünf ab.
Das zentrale Ziel dieser Arbeit ist die Überprüfung der Eignung des GAP-Modells als Instrument zur Qualitätssicherung von Dienstleis-tungen [DL].
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Dienstleistungsqualität und Qualitätssicherung
- 3. Die Darstellung des GAP-Modells
- 4. Kritische Würdigung des GAP-Modells
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Eignung des GAP-Modells als Instrument zur Qualitätssicherung von Dienstleistungen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Dienstleistungsqualität im Kontext der wachsenden Wettbewerbsintensität im tertiären Sektor und den steigenden Qualitätsansprüchen der Kunden.
- Die Definition von Dienstleistungsqualität und Qualitätssicherung
- Die Darstellung und Funktionsweise des GAP-Modells
- Die kritische Bewertung des GAP-Modells in Bezug auf seine Anwendbarkeit und Grenzen
- Die Herausforderungen und Chancen der Qualitätssicherung im Dienstleistungssektor
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Das Kapitel führt in das Thema Dienstleistungsqualität und Qualitätssicherung ein. Es beschreibt die zunehmende Bedeutung von Dienstleistungsqualität im Wettbewerb und erklärt die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Optimierung und Sicherstellung der Dienstleistungsqualität, um den Erfolg und die Überlebensfähigkeit von Unternehmen zu gewährleisten.
- Kapitel 2: Dienstleistungsqualität und Qualitätssicherung - Dieses Kapitel definiert Dienstleistungsqualität anhand der Qualitätsdefinition des Deutschen Instituts für Normung und beleuchtet verschiedene Qualitätsbegriffe. Es betont insbesondere die Bedeutung des kundenorientierten und produktbezogenen Qualitätsbegriffs im Kontext der Dienstleistungsqualität.
- Kapitel 3: Die Darstellung des GAP-Modells - Dieses Kapitel stellt das GAP-Modell nach Parasuraman, Zeithaml und Berry vor. Es beschreibt die einzelnen Komponenten des Modells und erläutert, wie es die Lücke zwischen den Erwartungen der Kunden und der tatsächlichen Leistungserbringung analysiert.
Schlüsselwörter
Dienstleistungsqualität, Qualitätssicherung, GAP-Modell, Kundenorientierung, Wettbewerb, Dienstleistungsunternehmen, tertiärer Sektor, Kundenwünsche, Qualitätsmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das GAP-Modell?
Das GAP-Modell ist ein Instrument zur Analyse der Dienstleistungsqualität, das Lücken zwischen Kundenerwartungen und tatsächlicher Leistung aufzeigt.
Wer entwickelte das GAP-Modell?
Es wurde von den amerikanischen Forschern A. Parasuraman, V. A. Zeithaml und L. L. Berry entwickelt.
Warum ist Dienstleistungsqualität ein entscheidender Wettbewerbsfaktor?
Hohe Qualität führt zu Kundenzufriedenheit, Kostenersparnissen, höheren Gewinnen und einer stärkeren Marktposition im tertiären Sektor.
Welche zentralen Lücken analysiert das Modell?
Das Modell untersucht Diskrepanzen in der Wahrnehmung des Managements, der Spezifikation der Dienstleistung und der externen Kommunikation gegenüber dem Kunden.
Wo liegen die Grenzen des GAP-Modells?
Die Arbeit unterzieht das Modell einer kritischen Würdigung hinsichtlich seiner Anwendbarkeit und theoretischen Grenzen in der Praxis.
- Citation du texte
- Arijana Delic (Auteur), 2009, Kritische Betrachtung des GAP-Modells als Instrument zur Qualitätssicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176601