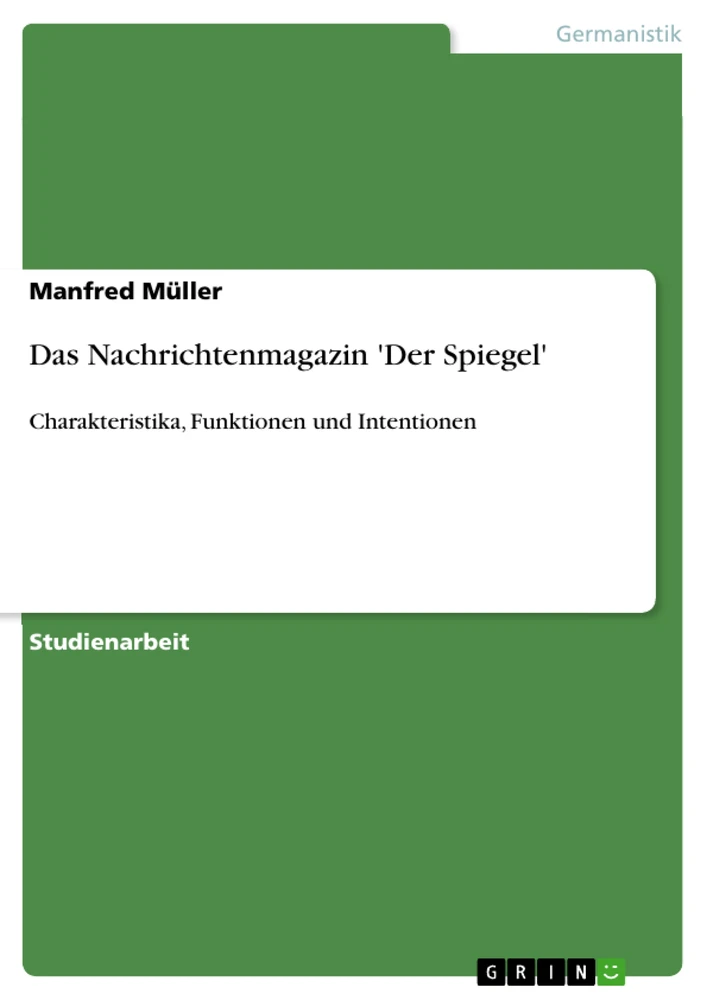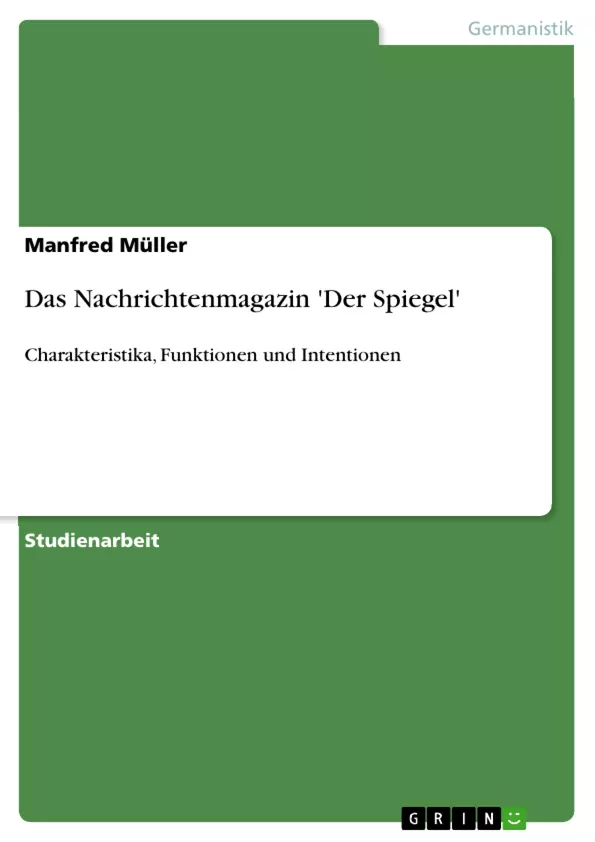Gegenstand dieser Arbeit ist das Nachrichtenmagazin "DER SPIEGEL". Dabei sollen der Aufbau des Magazins im allgemeinen und die Funktionen und Intentionen und deren Umsetzung, unter Berücksichtigung der gewählten Sprache, im besonderen berücksichtigt werden.
Zunächst wird eine Zusammenfassung bisher geleisteter Analysen als Kombination von externen, aber auch internen Ansichten, vorgenommen, während danach die Anwendbarkeit der erarbeiteten Ergebnisse auf aktuelle Ausgaben des SPIEGEL überprüft werden soll.
Dies erscheint umso notwendiger, als die Quellen des Eingangteils
überwiegend aus den 70er Jahren datieren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorbemerkungen
- II. Der Aufbau des SPIEGEL
- 1. Die SPIEGEL-Story
- 2. Die Leseanreize
- Der Lead, die Bildunterschrift, der Titel
- III. Funktionen und Intentionen des SPIEGEL
- 1. SPIEGEL-Leser wissen mehr!?
- 1.1 Die Leserspezifität
- 1.2 Die Leserinteressen
- 2. Herr Augstein, was sagen Sie dazu?
- 3. Kritik- und Urteilsfähigkeit
- 3.1 Kritik contra Konformität
- 3.2 Urteil über die Kritik und Kritik an den Urteilen
- 1. SPIEGEL-Leser wissen mehr!?
- IV. Die Sprache des SPIEGEL
- 1. Die Wortwahl
- V. Aktuelle Textbeispiele
- 1. Die Stilmittel
- 2. Die Story "Alle Enkel pleite"
- VI. Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Nachrichtenmagazin "DER SPIEGEL", fokussiert auf dessen Aufbau, Funktionen, Intentionen und die gewählte Sprache. Es werden frühere Analysen zusammengefasst und die Anwendbarkeit der Ergebnisse auf aktuelle Ausgaben geprüft. Die subjektive Natur der Analyse aufgrund der notwendigen Textauswahl wird dabei explizit angesprochen.
- Der Aufbau des SPIEGEL und insbesondere der "Story" als dominierender Texttypus.
- Die Funktionen und Intentionen des SPIEGEL im Hinblick auf die Leser und deren Erwartungen.
- Die Rolle von Kritik und Urteilsfähigkeit im SPIEGEL.
- Die sprachlichen Charakteristika des SPIEGEL, insbesondere die Wortwahl.
- Analyse aktueller Textbeispiele zur Veranschaulichung der gefundenen Muster.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vorbemerkungen: Dieses Kapitel legt den Fokus der Arbeit fest: die Analyse des Nachrichtenmagazins "DER SPIEGEL" hinsichtlich Aufbau, Funktion, Intention und Sprache. Es wird auf die Notwendigkeit der Überprüfung bestehender Analysen (vorwiegend aus den 70er Jahren) anhand aktueller Ausgaben hingewiesen und die subjektive Natur der Textauswahl und -bewertung betont. Die Grenzen der Untersuchung in Bezug auf die Vollständigkeit werden explizit benannt.
II. Der Aufbau des SPIEGEL: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur des SPIEGEL, wobei der Schwerpunkt auf der "Story" als vorherrschendem Texttyp liegt. Es wird die Definition der Story nach SPIEGEL-Statut erläutert und die Gefahr der impliziten Kommentierung sowie die Kombination aus Faktenbericht und subjektivem Kommentar hervorgehoben. Die Struktur der Story (Lead, Mittelteil, Schluss) wird detailliert dargestellt, wobei die Funktion des Leads als Leseanreiz und die Bedeutung des Schlusses als abschließender Eindruck betont werden.
III. Funktionen und Intentionen des SPIEGEL: Dieser Abschnitt untersucht die Funktionen und Intentionen des SPIEGEL, indem er die Leserschaft (ihre Spezifität und Interessen) und die Rolle von Kritik und Urteilsfähigkeit im Magazin beleuchtet. Es wird diskutiert, inwiefern der SPIEGEL die Leser informierender und kritischer machen möchte und wie Konformität und Kritik im Magazin aufeinander treffen. Der Abschnitt geht auch auf die Frage ein, welche Rolle die Meinungen von Personen wie Herrn Augstein spielen.
IV. Die Sprache des SPIEGEL: Hier wird die Sprache des SPIEGEL analysiert, insbesondere die Wortwahl. Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel, die zur Erreichung der Intentionen und Funktionen des Magazins eingesetzt werden. Leider fehlt im vorliegenden Textfragment eine detailliertere Beschreibung des Inhalts.
V. Aktuelle Textbeispiele: In diesem Kapitel werden aktuelle Textbeispiele des SPIEGEL analysiert, um die zuvor beschriebenen Charakteristika zu veranschaulichen. Es werden die Stilmittel und eine konkrete Story ("Alle Enkel pleite") herangezogen, um die theoretischen Ausführungen zu konkretisieren und zu illustrieren. Die Analyse der gewählten Story dient als Fallbeispiel zur Vertiefung der bisherigen Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
DER SPIEGEL, Nachrichtenmagazin, Story, Leseanreize, Lead, Bildunterschrift, Titel, Funktionen, Intentionen, Leserspezifität, Kritik, Urteilsfähigkeit, Sprache, Wortwahl, Textanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf das Nachrichtenmagazin "DER SPIEGEL", untersucht dessen Aufbau, Funktionen, Intentionen und die verwendete Sprache. Dabei werden frühere Analysen zusammengefasst und auf aktuelle Ausgaben angewendet. Die subjektive Natur der Analyse aufgrund der Textauswahl wird explizit thematisiert.
Welche Aspekte des SPIEGEL werden untersucht?
Die Analyse umfasst folgende Schwerpunkte: den Aufbau des SPIEGEL und insbesondere die "Story" als dominierenden Texttyp; die Funktionen und Intentionen des SPIEGEL im Hinblick auf die Leser und deren Erwartungen; die Rolle von Kritik und Urteilsfähigkeit; die sprachlichen Charakteristika, insbesondere die Wortwahl; und die Analyse aktueller Textbeispiele zur Veranschaulichung der gefundenen Muster.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Vorbemerkungen (Festlegung des Fokus und der methodischen Vorgehensweise); Der Aufbau des SPIEGEL (mit Schwerpunkt auf der "Story"); Funktionen und Intentionen des SPIEGEL (Leserschaft, Kritik und Urteilsfähigkeit); Die Sprache des SPIEGEL (Wortwahl und sprachliche Mittel); Aktuelle Textbeispiele (Analyse von Stilmitteln und einer konkreten Story); und Schlußbemerkungen.
Was wird in Kapitel II ("Der Aufbau des SPIEGEL") behandelt?
Kapitel II beschreibt die Struktur des SPIEGEL, insbesondere die "Story" als vorherrschenden Texttyp. Es erläutert die Definition der Story nach SPIEGEL-Statut, die Gefahr impliziter Kommentierung und die Kombination von Faktenbericht und subjektivem Kommentar. Die Struktur der Story (Lead, Mittelteil, Schluss) wird detailliert dargestellt, inklusive der Funktion des Leads als Leseanreiz und der Bedeutung des Schlusses.
Worauf konzentriert sich Kapitel III ("Funktionen und Intentionen des SPIEGEL")?
Kapitel III untersucht die Funktionen und Intentionen des SPIEGEL, indem es die Leserschaft (Spezifität und Interessen), die Rolle von Kritik und Urteilsfähigkeit beleuchtet. Es diskutiert, wie der SPIEGEL Leser informieren und kritischer machen möchte und wie Konformität und Kritik im Magazin aufeinandertreffen. Die Rolle von Meinungen wichtiger Personen wie Herrn Augstein wird ebenfalls thematisiert.
Was ist der Inhalt von Kapitel IV ("Die Sprache des SPIEGEL")?
Kapitel IV analysiert die Sprache des SPIEGEL, insbesondere die Wortwahl. Es konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel zur Erreichung der Intentionen und Funktionen des Magazins. Eine detailliertere Beschreibung des Inhalts fehlt im vorliegenden Textfragment.
Wie werden die Ergebnisse veranschaulicht?
Kapitel V ("Aktuelle Textbeispiele") analysiert aktuelle Textbeispiele, um die beschriebenen Charakteristika zu veranschaulichen. Es werden Stilmittel und eine konkrete Story ("Alle Enkel pleite") herangezogen, um die theoretischen Ausführungen zu konkretisieren und zu illustrieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: DER SPIEGEL, Nachrichtenmagazin, Story, Leseanreize, Lead, Bildunterschrift, Titel, Funktionen, Intentionen, Leserspezifität, Kritik, Urteilsfähigkeit, Sprache, Wortwahl, Textanalyse.
Welche Einschränkungen der Analyse werden erwähnt?
Die subjektive Natur der Analyse aufgrund der notwendigen Textauswahl wird explizit angesprochen, ebenso wie die Grenzen der Untersuchung in Bezug auf Vollständigkeit.
Wo finde ich weitere Informationen?
Der vorliegende Text ist eine Zusammenfassung und Vorschau. Für detailliertere Informationen ist die vollständige Analyse einzusehen.
- Quote paper
- Manfred Müller (Author), 1994, Das Nachrichtenmagazin 'Der Spiegel', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176677