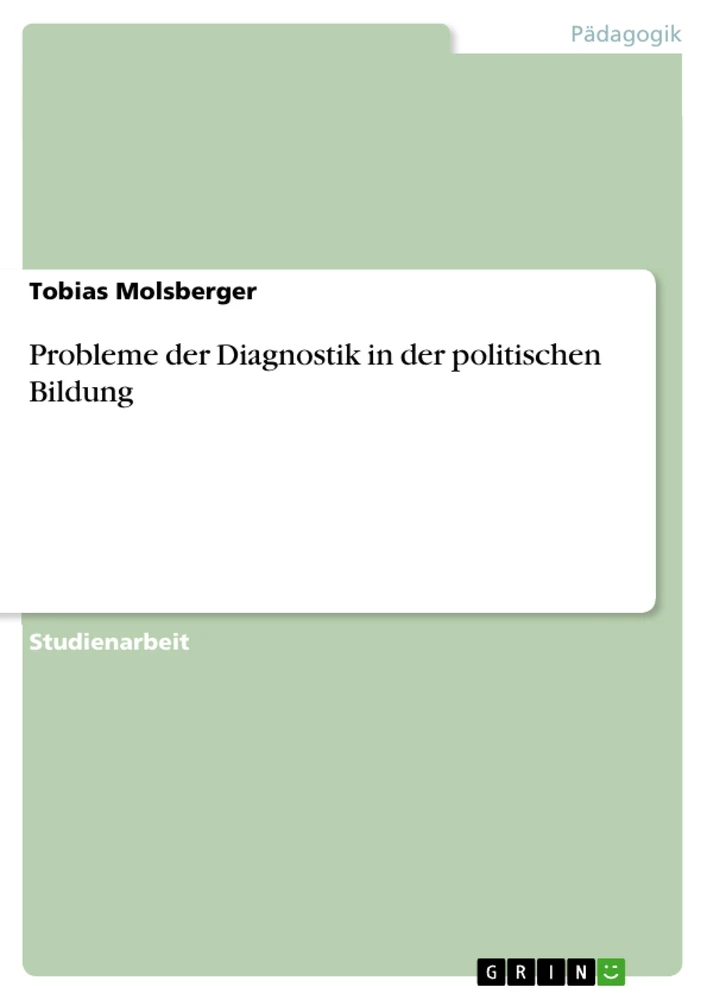Die Geschichte der politischen Bildung im demokratischen Sinne in Deutschland ist so jung, wie die deutsche Demokratie selbst.
Die politische Bildung, die stets mit der Institution Schule in Kontakt stand und bis heute steht, ist wohl so alt wie die öffentliche Schule selbst, das heißt sie geht auf das 18. und 19. Jahrhundert zurück. Der damalige Sinn der politischen Erziehung bestand jedoch in erster Linie aus der Erziehung zur Konformität mit dem damaligen, je nach Region an der Macht stehenden Herrscher. So sollte durch die systematische Erziehung der ausschließlich männlichen Jugend die Akzeptanz und Unveränderlichkeit der Herrschaftslegitimität des Herrschers bewirkt werden. So sah der preußische Kaiser Friedrich Wilhelm IV. die Verantwortung für „die Anwendung seiner Unterthanen“ in der „irreligiösen Massenweisheit“, einzig und allein bei den Lehrern...
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Probleme der Diagnostik in der politischen Bildung
- Allgemeiner Definitionsansatz von „Diagnostik“
- Herausforderungen und Probleme der Diagnostik
- Theoriegeleitetes Erfassen von Lernvoraussetzungen
- Theoriegeleitetes Erfassen von Lernentwicklung
- Theoriegeleitete Ermöglichung der Förderung
- Möglicher Lösungsansatz in der Unterrichtspraxis
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Herausforderungen und Probleme der Diagnostik im Fachbereich der politischen Bildung. Sie konzentriert sich auf die Schwierigkeiten, die bei der Erfassung von Lernvoraussetzungen und Lernentwicklungen auftreten, sowie auf die Frage, wie die Diagnostik zur Förderung des Lernens beitragen kann.
- Definition von „Diagnostik“ in der politischen Bildung
- Herausforderungen bei der Erfassung von Lernvoraussetzungen
- Schwierigkeiten bei der Erfassung von Lernentwicklung
- Möglichkeiten zur Förderung des Lernens durch Diagnostik
- Lösungsansätze für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert einen einführenden Überblick über die Geschichte der politischen Bildung in Deutschland und erläutert die Bedeutung der Diagnostik in diesem Kontext. Im zweiten Kapitel wird ein allgemeiner Definitionsansatz von „Diagnostik“ im schulischen Kontext vorgestellt und die Herausforderungen und Probleme der Diagnostik in der politischen Bildung beleuchtet. Dabei werden insbesondere die Schwierigkeiten bei der Erfassung von Lernvoraussetzungen und Lernentwicklungen, sowie die Problematik der theoriegeleiteten Förderung des Lernens behandelt. Das dritte Kapitel diskutiert mögliche Lösungsansätze für die Praxis und zeigt auf, wie die Diagnostik in der politischen Bildung effektiver eingesetzt werden kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: politische Bildung, Diagnostik, Lernvoraussetzungen, Lernentwicklung, Förderung, Kompetenzbereiche, Unterrichtspraxis, Bildungsstandards, politische Urteilsfähigkeit, Theoriegeleitetes Erfassen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Diagnostik in der politischen Bildung schwierig?
Politische Bildung zielt auf Urteilsfähigkeit und Einstellungen ab, die schwerer messbar sind als rein faktisches Wissen in anderen Schulfächern.
Wie hat sich die politische Erziehung historisch entwickelt?
Im 18. und 19. Jahrhundert diente sie oft der Erziehung zur Konformität mit dem Herrscher; die demokratische politische Bildung ist eine relativ junge Entwicklung.
Was bedeutet "theoriegeleitetes Erfassen von Lernvoraussetzungen"?
Es bedeutet, den Wissensstand und die politischen Vorstellungen der Schüler vorab auf Basis didaktischer Modelle zu analysieren, um den Unterricht darauf abzustimmen.
Welche Rolle spielen Bildungsstandards bei der Diagnostik?
Bildungsstandards definieren Kompetenzbereiche, die Lehrer dabei unterstützen sollen, die Lernentwicklung der Schüler systematischer zu beurteilen.
Gibt es Lösungsansätze für die Diagnoseprobleme in der Praxis?
Die Arbeit schlägt vor, Diagnostik stärker als Förderinstrument zu nutzen und Methoden zu entwickeln, die über einfache Wissensabfragen hinausgehen.
- Quote paper
- Tobias Molsberger (Author), 2010, Probleme der Diagnostik in der politischen Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176707