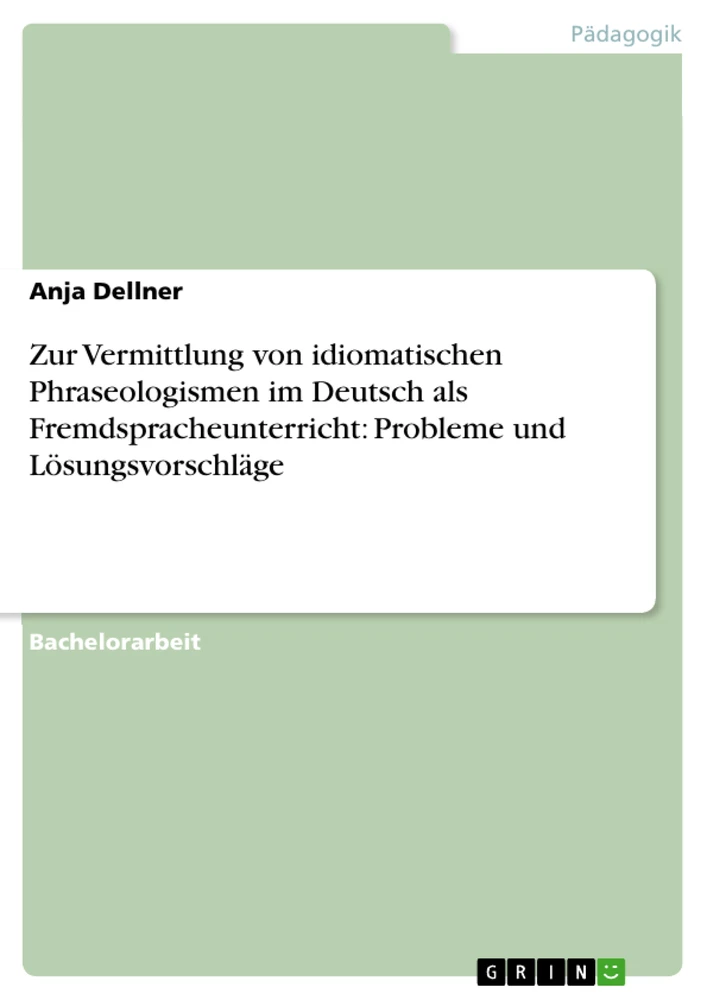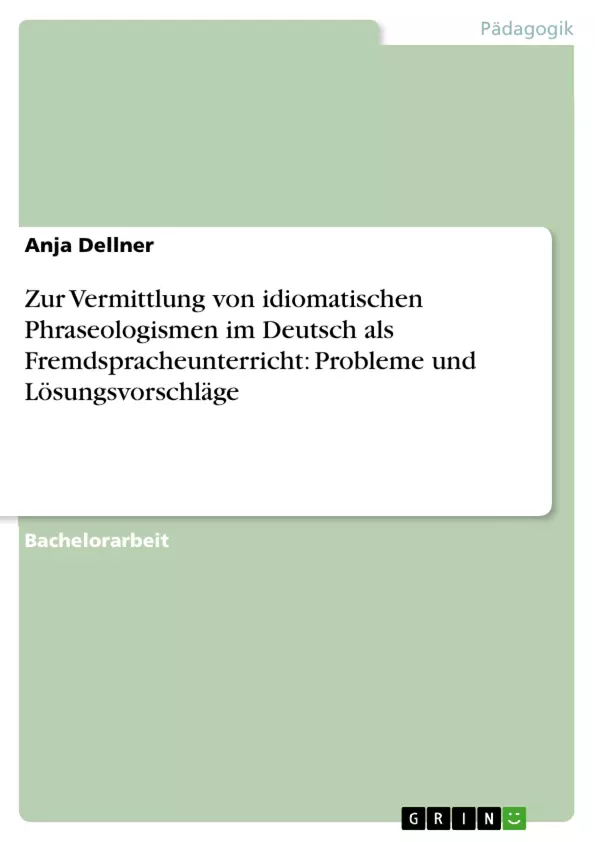Die vorliegende Arbeit widmet sich primär dem Phänomen der idiomatischen Phraseologismen und deren Vermittlung im Deutsch als Fremdspracheunterricht. Idiomatische Phraseologismen gelten wegen ihrer komplexen Semantik, ihrer relativ starren Struktur und ihren eingeschränkten Gebrauchsmöglichkeiten als schwer erlern- und vermittelbar. Dennoch wirken sie auf Lerner motivierend. Sie werden aufgrund des Spaßes am Bildhaften, der Möglichkeiten zum Sprachspiel und des „kulturellen Schatzes“, der durch sie vermittelt wird, gern gelernt (vgl. u.a. Hirschfeld 1996: 31). Das Fach Deutsch als Fremdsprache befindet sich heute nicht mehr in dem von Peter Kühn 1987 postulierten „phraseodidaktischen Dornröschenschlaf“ (Kühn 1987: 62), allerdings wurden die Fortschritte der Phraseodidaktik noch nicht ausreichend in fachdidaktischen Handbüchern festgehalten (vgl. Ettinger 1998: 202ff.).
Ziel dieser Arbeit ist es, auf die Probleme, die sich für Deutschlerner beim Erlernen und angemessenen Anwenden von idiomatischen Phraseologismen ergeben, hinzuweisen und die wichtigsten Verfahren zur Vermittlung dieser sprachlichen Einheiten im Deutsch als Fremdspracheunterricht vorzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung und Basisklassifikation
- 2.1. Begriffsbestimmung
- 2.2. Basisklassifikation
- 2.3. Einige spezielle Klassen
- 2.3.1. Modellbildungen
- 2.3.2. Zwillingsformeln
- 2.3.3. Komparative Phraseologismen
- 2.3.4. Kinegramme
- 2.3.5. Onymische Phraseologismen
- 2.3.6. Phraseologische Termini
- 2.3.7. Orthonymische Phraseologismen
- 3. Sprachliche Besonderheiten von Phraseologismen
- 3.1. Polylexikalität
- 3.2. Festigkeit
- 3.2.1. Gebräuchlichkeit
- 3.2.2. Psycholinguistische Festigkeit
- 3.2.3. Strukturelle Festigkeit
- 3.2.3.1. Morphosyntaktische Irregularitäten
- 3.2.3.2. Restriktionen
- 3.2.4. Relativierung der strukturellen Festigkeit
- 3.2.5. Pragmatische Festigkeit
- 3.2.5.1. Konnotationen und Expressivität
- 3.2.5.2. Gebrauchsrestriktionen und Stilistik
- 3.3. Idiomatizität
- 3.4. Motiviertheit und Motivierbarkeit
- 3.5. Zusammenfassung des Kapitels
- 4. Die Vermittlung von idiomatischen Phraseologismen im Deutsch als Fremdspracheunterricht: Probleme und Lösungsvorschläge
- 4.1. Lernschwierigkeiten
- 4.2. Lernziele
- 4.3. Auswahl
- 4.3.1. Kriterien und Probleme
- 4.3.2. Fazit
- 4.4. Vorgehensweisen bei der Vermittlung von idiomatischen Phraseologismen im Deutsch als Fremdspracheunterricht
- 4.4.1. Überblick
- 4.4.2. Der ,phraseodidaktische Dreischritt' - Erkennen, Verstehen, Anwenden
- 4.4.2.1. Phraseologismen erkennen
- 4.4.2.2. Phraseologismen verstehen
- 4.4.2.3. Phraseologismen festigen und anwenden
- 4.4.3. Kontrastives Verfahren
- 4.4.4. Etymologisierung und phonetische Sensibilisierung
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit widmet sich der Vermittlung von idiomatischen Phraseologismen im Deutsch als Fremdspracheunterricht. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich für Lernende beim Erlernen und Anwenden dieser sprachlichen Einheiten ergeben, und stellt verschiedene pädagogische Ansätze vor.
- Die Arbeit beleuchtet die sprachlichen Besonderheiten von Phraseologismen, insbesondere die Idiomatizität und Festigkeit.
- Sie analysiert die Lernschwierigkeiten und -ziele beim Erlernen von Phraseologismen.
- Die Arbeit stellt verschiedene Methoden für die Vermittlung von Phraseologismen im Unterricht vor, z.B. den ,phraseodidaktischen Dreischritt' und das kontrastive Verfahren.
- Sie befasst sich mit der Auswahl von Phraseologismen für den Unterricht.
- Die Arbeit gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Phraseodidaktik.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Arbeit und stellt den Kontext der Thematik dar. Es wird auf die Relevanz von Phraseologismen für den Sprachgebrauch hingewiesen und die Herausforderungen für Deutsch als Fremdsprachelerner beschrieben.
Kapitel zwei definiert den Begriff „Phraseologismus“ und skizziert eine Basisklassifikation. Es werden verschiedene Typen von Phraseologismen vorgestellt und deren spezifische sprachliche Eigenschaften erläutert.
Kapitel drei befasst sich mit den sprachlichen Besonderheiten von Phraseologismen. Es werden die Konzepte der Polylexikalität, Festigkeit und Idiomatizität sowie die Bedeutung von Motiviertheit und Motivierbarkeit für das Verständnis dieser Wortverbindungen erörtert.
Kapitel vier stellt die zentralen Probleme und Lösungsvorschläge zur Vermittlung von idiomatischen Phraseologismen im Deutsch als Fremdspracheunterricht vor. Es werden Lernschwierigkeiten, Lernziele und Auswahlkriterien sowie verschiedene pädagogische Verfahren zur Vermittlung von Phraseologismen behandelt.
Schlüsselwörter
Idiomatische Phraseologismen, Deutsch als Fremdspracheunterricht, Phraseodidaktik, Lernschwierigkeiten, Lernziele, Auswahl, Vermittlung, kontrastives Verfahren, Etymologisierung, phonetische Sensibilisierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind idiomatische Phraseologismen für Deutschlerner schwierig?
Sie zeichnen sich durch eine komplexe Semantik (Bedeutung ergibt sich nicht aus den Einzelwörtern), eine starre Struktur und eingeschränkte Gebrauchsmöglichkeiten aus.
Was ist der „phraseodidaktische Dreischritt“?
Dies ist ein Vermittlungsverfahren, das aus den Stufen Erkennen, Verstehen und Anwenden von Phraseologismen besteht.
Welche Rolle spielt die Motiviertheit bei Redewendungen?
Die Motiviertheit beschreibt, wie gut die Bedeutung einer Redewendung aus ihrem Bild (z. B. „jemandem den Kopf waschen“) hergeleitet werden kann. Dies erleichtert das Lernen.
Was versteht man unter einem kontrastiven Verfahren in der Phraseodidaktik?
Beim kontrastiven Verfahren werden Redewendungen der Zielsprache mit entsprechenden Ausdrücken in der Muttersprache der Lerner verglichen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu verdeutlichen.
Was sind Kinegramme?
Kinegramme sind Phraseologismen, die eine konventionalisierte Körpersprache sprachlich kodieren, wie zum Beispiel „die Achseln zucken“.
- Arbeit zitieren
- Anja Dellner (Autor:in), 2011, Zur Vermittlung von idiomatischen Phraseologismen im Deutsch als Fremdspracheunterricht: Probleme und Lösungsvorschläge, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176711