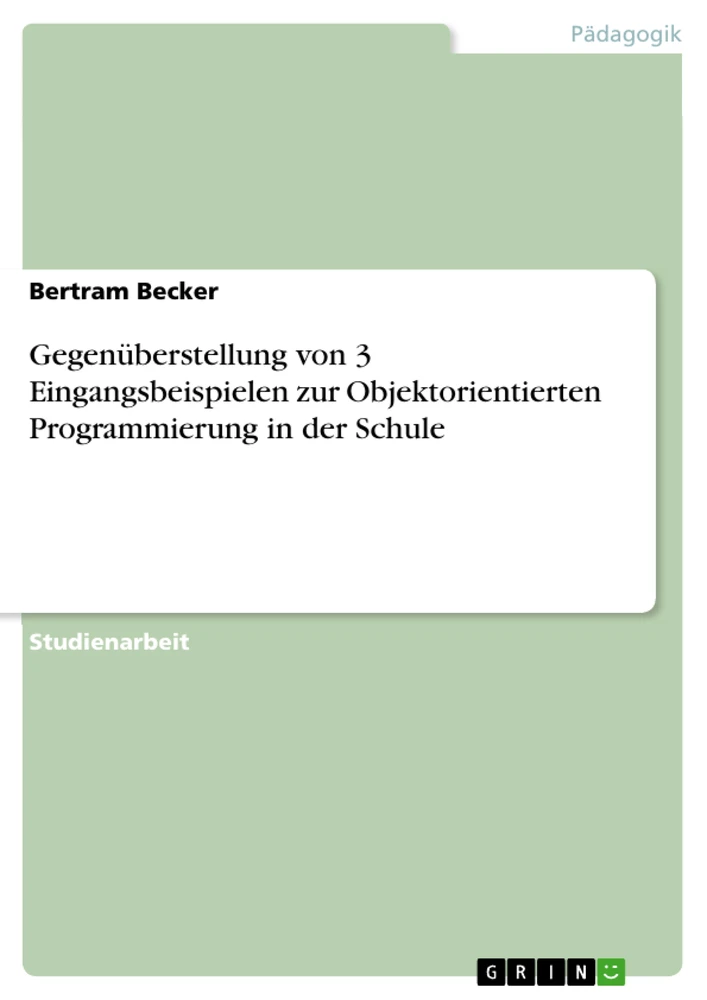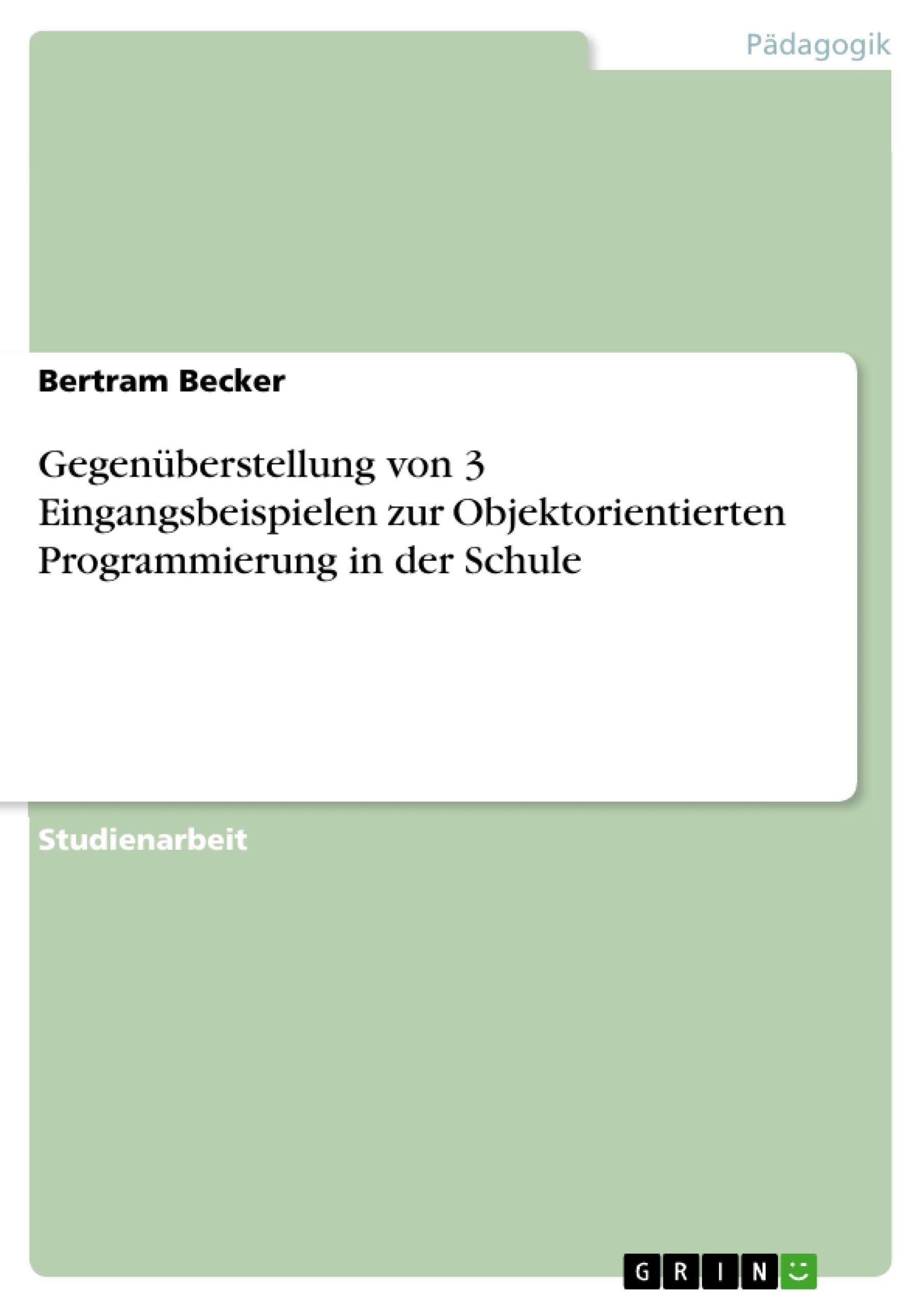Seminararbeit im Fach Informatik für das Lehramt an der Freien Universität Berlin.
In den Informatik-Lehrplänen der einzelnen Bundesländer ist das Objektorientierte Programmieren nur sporadisch zu finden. Im Berliner Rahmenplan ist von Ansätzen einer objektorientierten Sichtweise die Rede, im Brandenburger ist immerhin das objektorientierte Modellieren enthalten. Eigene Erfahrungen und solche, die im Seminar gesammelt wurden, liessen darauf schliessen, dass die Informatiklehrer selbst eine Vielzahl an Meinungen über die Relevanz objektorientierter Programmierung (in der Schule) haben.
So sind manche davon überzeugt, dass es sich dabei um das Programmierkonzept der Zukunft handelt und unbedingt so früh wie möglich vermittelt werden muss. Für andere wiederum stehen Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Verlässlichkeit oder Selbstorganisation an oberster Stelle, da diese ausreichen, um später im Leben nahezu jede Situation zu meistern, oder zumindest zu wissen, wo es anzusetzen gilt. Ebenso vielfältig wie die Meinungen zum Thema selbst, sind auch die Herangehensweisen der verschiedenen Lehrer, wie man Objektorientierung einführt, was es an Nutzen bringt und wo sich Schwierigkeiten ergeben könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Objektorientierte Programmierung in der Schule
- Einführung zu Threshold-Concepts
- Objektorientierung als Threshold in der Schule
- Einführung von Objektorientierung in der Schule
- Das Geheimnis der Einführungsbeispiele
- Beispiel 1 - Flaschendrehen
- Beispiel 2 - System Schule
- Beispiel 3 - System Post
- Implementierung der Einführungsbeispiele
- Überblick Greenfoot
- Greenfoot-Realisierung vom Flaschendrehen
- Greenfoot-Realisierung vom System Schule (Ansatzüberlegungen)
- Greenfoot-Realisierung vom System Post
- Vergleich der Greenfoot-Realisierungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Einführung von objektorientierter Programmierung (OOP) im Schulunterricht. Sie untersucht verschiedene Ansätze und Beispiele, um OOP Schülern näherzubringen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Verwendung von Threshold-Concepts, um das Verständnis von OOP als fundamentales Konzept der Informatik zu fördern.
- Einführung von OOP als Threshold-Concept
- Analyse von geeigneten Einführungsbeispielen
- Implementierung der Beispiele in der Entwicklungsumgebung Greenfoot
- Vergleich der Implementierungen und Diskussion von Vor- und Nachteilen
- Bewertung der Relevanz von OOP im Schulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich dem Konzept der Threshold-Concepts und erläutert deren Bedeutung im Informatikunterricht. Es wird argumentiert, dass OOP ein wichtiges Threshold-Concept darstellt, das die Grundlage für weitere Programmierarbeiten bildet. Im zweiten Kapitel werden drei verschiedene Beispiele für die Einführung von OOP in der Schule vorgestellt: Flaschendrehen, System Schule und System Post.
Im dritten Kapitel werden die drei Beispiele anhand der Entwicklungsumgebung Greenfoot implementiert. Es werden dabei die spezifischen Herausforderungen und Besonderheiten jeder Implementierung diskutiert.
Schlüsselwörter
Objektorientierte Programmierung, Threshold-Concepts, Einführungsbeispiele, Greenfoot, Schulunterricht, Informatikdidaktik
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Seminararbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Einführung der objektorientierten Programmierung (OOP) im Informatikunterricht an Schulen und vergleicht verschiedene Einführungsbeispiele.
Welche drei Einführungsbeispiele werden analysiert?
Es werden die Beispiele "Flaschendrehen", "System Schule" und "System Post" zur Einführung von OOP-Konzepten untersucht.
Welche Software-Umgebung wird für die Implementierung genutzt?
Die Beispiele werden mithilfe der didaktischen Entwicklungsumgebung Greenfoot realisiert und verglichen.
Was sind "Threshold-Concepts" im Kontext dieser Arbeit?
Threshold-Concepts sind Schwellenkonzepte, die ein fundamentales Verständnis der Informatik ermöglichen. Die Arbeit argumentiert, dass OOP ein solches Konzept darstellt.
Wie ist die aktuelle Situation von OOP in deutschen Lehrplänen?
OOP ist in den Lehrplänen oft nur sporadisch zu finden; während Berlin Ansätze einer objektorientierten Sichtweise nennt, enthält Brandenburg immerhin das objektorientierte Modellieren.
- Citar trabajo
- Bertram Becker (Autor), 2007, Gegenüberstellung von 3 Eingangsbeispielen zur Objektorientierten Programmierung in der Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177055