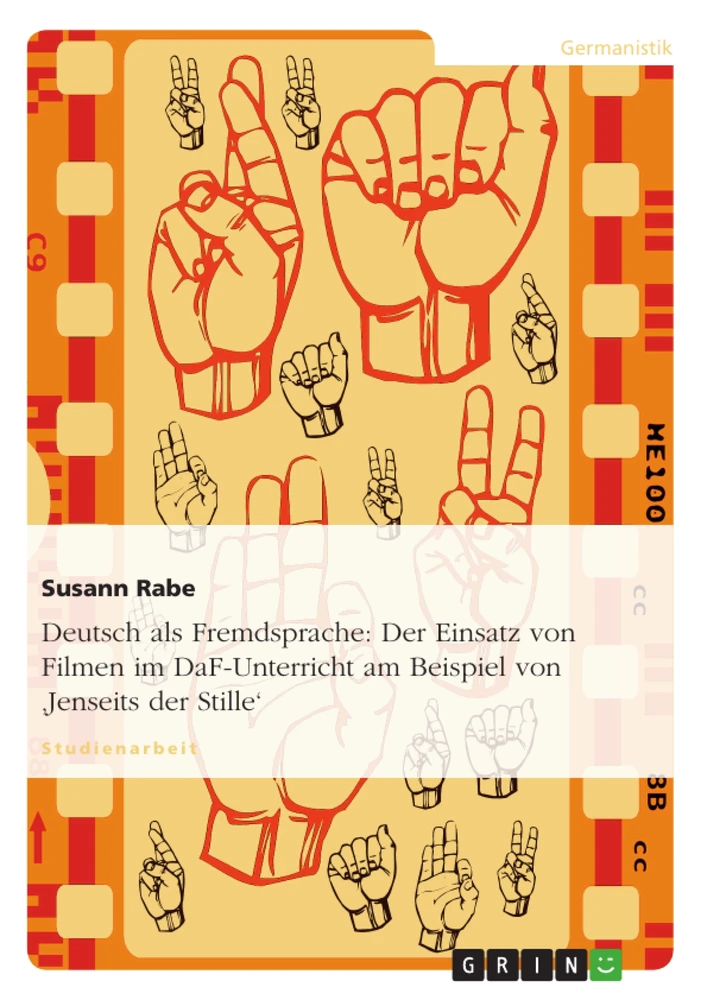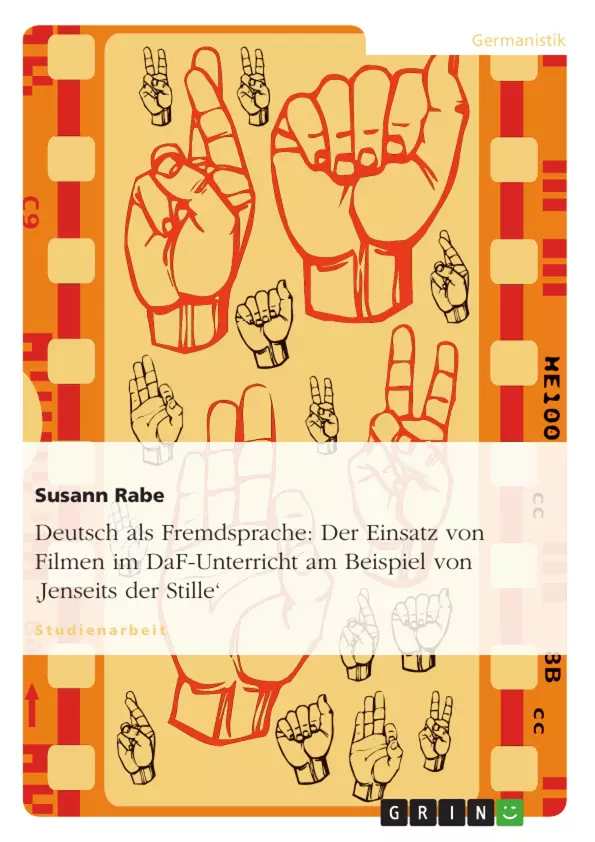Sowohl die Gewinnung als auch die Aufrechterhaltung des Interesses und der Aufmerksamkeit von Lernern ist einer der Hauptaspekte des Unterrichtens. So wie bei jeder Wissensaneignung, beginnen auch Fremdsprachenerwerbsprozesse mit Wahrnehmungen, die vor allem das Interesse der Hörer wecken sollen. Denn "nur was wir mit den Augen fixieren oder mit den Ohren fokussieren, hat eine Chance konzeptuell und bewusst zu Wissen verarbeitet zu werden. Mit dem Aufmerken beginnt das Merken" (ASSMANN, zit. n. BALLSTAEDT 2004: 625).
Damit die Aufmerksamkeit bestehen bleibt, sich authentische Sprechanlässe entwickeln und die Lerner sich etwas merken können, ist es wichtig, möglichst „ungewöhnliche und/ oder mit dem eigenen Leben verknüpfte Inhalte zu zeigen“ (SASS 2007: 6). Den Lehrpersonen stehen dabei mannigfaltige Möglichkeiten zur Verfügung, visuell-auditive Medien im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht einzubauen, da kurze Filmsequenzen oder ganze Filme zahlreicher Genres heutzutage ohne großen technischen und finanziellen Aufwand gezeigt werden können.
Filme beziehungsweise audiovisuelle Dokumente sind aus unserer heutigen medialisierten Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Kulturweit werden sie jeden Tag über das Fernsehen, Kino, Internet oder mittels geliehener beziehungsweise gekaufter DVDs konsumiert. Worte können, aber müssen dabei keine allzu wichtige Rolle spielen, denn Filme erzielen ihre Wirkung vorrangig mithilfe von Bildern respektive durch ein Zusammenspiel von Bild und Ton. Neben zahlreichen anderen Lernzielen kann mittels der Verwendung des Mediums Film diese Wirkung im schulischen beziehungsweise universitären Rahmen auf analytischer Ebene untersucht werden.
Wie das Medium im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden kann und sollte, welche Vorteile sich daraus ergeben, was das Besondere an audiovisuellen Medien ist, wie man die Unterrichtsarbeit gestalten kann und was man dabei beachten muss, soll Gegenstand dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Medium,,Film“ im Fremdsprachenunterricht
- Bedeutung des audiovisuellen Mediums und fremdsprachliche Zielkompetenzen
- Methoden und Aufgaben für den Fremdsprachenunterricht – illustriert am Film,,Jenseits der Stille\" von Caroline Link
- Zur Arbeit mit dem Film
- Filmdidaktik
- Vor dem Sehen
- Während des Sehens
- Nach dem Sehen
- Schlusswort
- Literatur-/ Medienverzeichnis
- Anhang
- Filmbilder
- Interview mit Niki Reiser (gekürzte Fassung)
- Kurzbeschreibungen/ Inhaltsangaben zu „Jenseits der Stille“
- Fernsehzeitung (Online)
- DVD-Hülle
- Filmtechnisch-ästhetische Aspekte
- ,,Ton: Musik, Sprache, Geräusche“
- ,,Wichtige Begriffe rund um das Kino“
- ,,Die Kamera als Erzählerin“
- Taubstummen-Verständigungssystem
- Deutsches Fingeralphabet und Beispiele
- Arbeitsanregungen für den Unterricht
- Filmkritiken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Einsatz von Filmen im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht am Beispiel von „Jenseits der Stille“. Die Zielsetzung ist es, die didaktische Potenziale des Mediums Film aufzuzeigen und konkrete methodische Vorschläge für die Arbeit mit Filmen im Unterricht zu entwickeln.
- Die Bedeutung des audiovisuellen Mediums Film für den Fremdsprachenunterricht
- Die Förderung fremdsprachlicher Kompetenzen durch den Einsatz von Filmen
- Methodische Ansätze für die Arbeit mit Filmen im Unterricht
- Die Analyse und Interpretation des Films „Jenseits der Stille“
- Die Entwicklung von didaktisch-methodischen Materialien für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Interesses und der Aufmerksamkeit von Lernern im Unterricht dar und hebt die Bedeutung von Filmen als Medium für den Fremdsprachenunterricht hervor. Kapitel 2 untersucht die Wirkungsweise des Mediums „Film“ und die Voraussetzungen für dessen Einsatz im Unterricht. Es wird betont, dass Film als ein komplexes Medium zu verstehen ist, welches rezeptive und produktive Fertigkeiten fördert und kritisch betrachtet werden muss.
Kapitel 3 behandelt die Bedeutung von audiovisuellen Dokumenten für Fremdsprachenlerner und die verschiedenen Fertigkeiten, die durch den Einsatz von Filmen gefördert werden können.
Kapitel 4 stellt die didaktisch-methodischen Vorschläge für die Arbeit mit dem Film „Jenseits der Stille“ von Caroline Link im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht vor. Dabei werden formale, inhaltliche und thematische Aspekte des Films analysiert und konkrete Übungsvorschläge für den Unterricht präsentiert.
Schlüsselwörter
Film, Fremdsprachenunterricht, audiovisuelle Medien, Filmdidaktik, „Jenseits der Stille“, Caroline Link, Methoden, Aufgaben, Deutsch als Fremdsprache, Lernmotivation, Aufmerksamkeit, Filmsprache, Filminterpretation, Filmanalyse, Unterrichtsmaterial.
- Citar trabajo
- Susann Rabe (Autor), 2011, Deutsch als Fremdsprache: Der Einsatz von Filmen im DaF-Unterricht am Beispiel von 'Jenseits der Stille', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177159