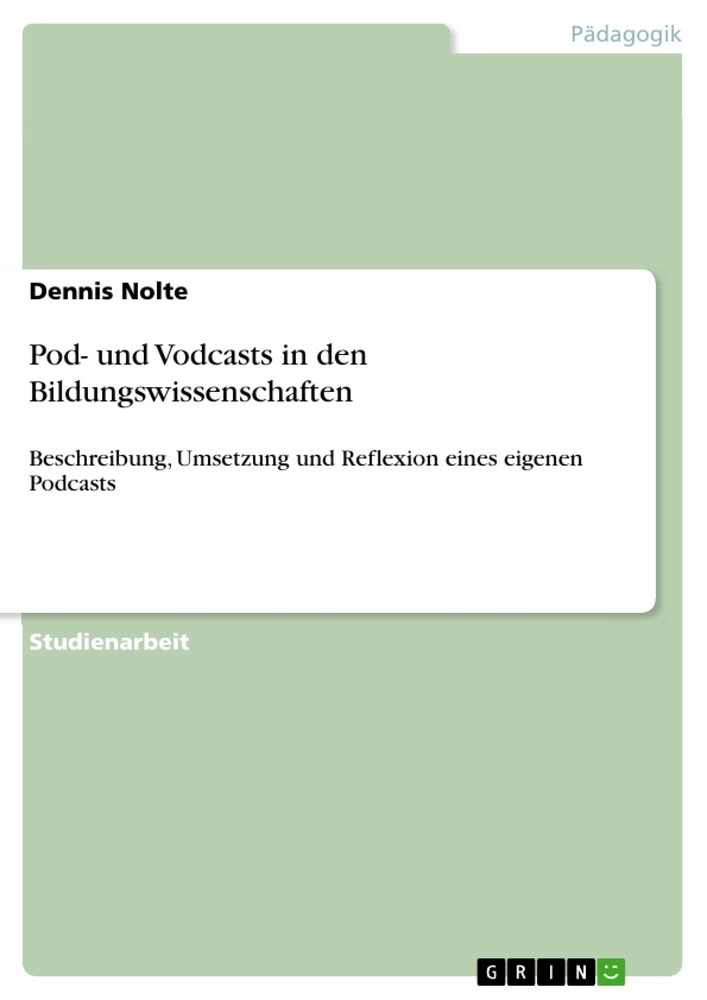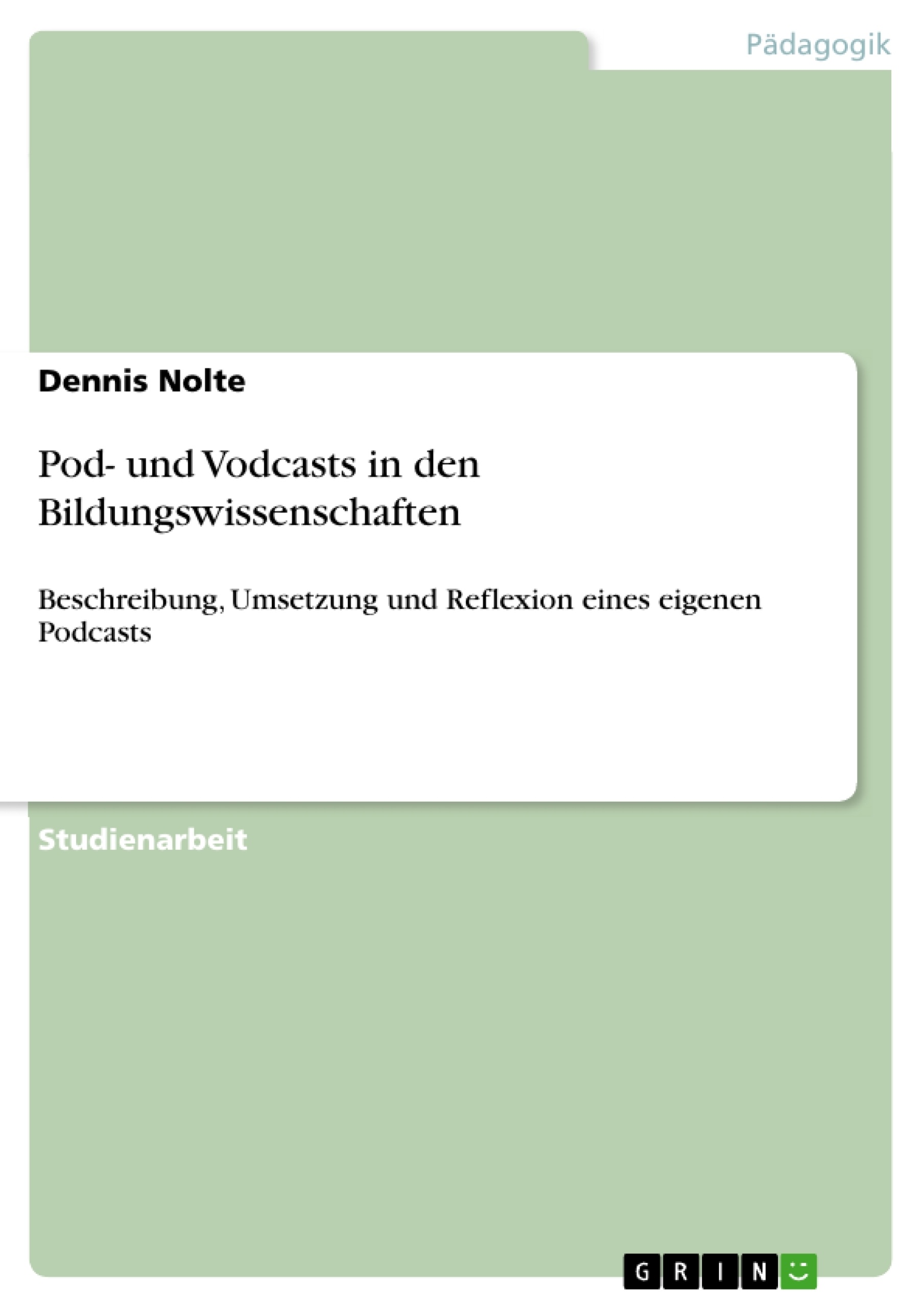Eine der wesentlichen Intentionen bei der Erfindung des Internets war es, ein Medium zu schaffen, in dem Menschen sich treffen, zusammen lesen und arbeiten können, auch wenn sie sich an unterschiedlichen Orten befinden. Zum einen ging dieser von Tim Berners-Lee (geb. 1955) – dem Erfinder des Internets – gehegte Traum 1993 mit der Entwicklung des ersten Internetbrowsers (vgl. Richardson 2011, 15) und zum anderen mit dem ab etwa 2004 aufkommenden Web 2.0 in Erfüllung (vgl. Alby 2008, 15). Somit war es jetzt den Nutzern des Internets nicht nur möglich, von einem beliebigen Punkt in der Welt Daten abzufragen und so mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, sondern auch ein aktiver Bestandteil des Webs zu werden. Im Internet der zweiten Generation besitzt man nämlich zusätzlich eine bestimmte Online-Identität, mit der man sein Wissen aktiv in die semantischen Strukturen des Webs beispielsweise in Weblogs, Wikis, sozialen Netzwerken sowie Podcasts einbringt und so einen regen Wissensaustausch der Benutzer untereinander anregt (vgl. Bastiaens et al. 2010, 19). Doug Rushkoff (2004) spricht in seinem Podcast „Renaissance Prospects“ sogar darüber, dass sich die Menschheit in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen befindet, ähnlich wie dies damals in der Renaissance der Fall war. Das Internet mit seinem umfassenden Wissensbestand fördert durch die aktive Teilnahme jedes Einzelnen eine „Gesellschaft von Autoren“. Somit schreibt die Menschheit mit der Teilnahme aller, welche über einen Internetzugang verfügen, ihre eigene Geschichte weiter (vgl. Rushkoff 2004).
Multimediale Inhalte im Netz wie der eben erwähnte Podcast, die aktiv von den Nutzern des Webs gestaltet und jederzeit abgerufen werden können, stehen für eine neue Möglichkeit multimedialen Lernens. Heutzutage findet man auf den gängigen Podcast-Portalen wie podster.de oder auch auf thematischen Podcast-Portalen wie epnweb.org eine Vielzahl von Podcasts, die in dem Bereich der Bildung angesiedelt sind. Darüber hinaus bieten viele Universitäten ihre Vorlesungen als Pod- oder sogar Vodcasts an.
Die hier vorliegende Abschlussarbeit des dritten Moduls des Masterstudiengangs „Bildung und Medien“ (eEducation) möchte im Wesentlichen die Funktionen und Motive von Pod- und Vodcasts in den Bildungswissenschaften darstellen sowie das Thema, das Konzept, den Aufbau und das Design eines eigenen Podcasts vorstellen und reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pod- und Vodcasts
- Definition und Einteilung
- Chancen auditiver und visueller Darstellungen
- Die Funktionsweise von Pod- und Vodcasts
- Pod- und Vodcasts in den Bildungswissenschaften
- Lernen mit Pod- und Vodcasts - Einige Beispiele
- Der Podcast „Methodenvernetzung im Ethik- und Philosophieunterricht“
- Vorüberlegungen
- Die fünf fachspezifischen Methoden
- Überlegungen zu lernrelevanten Kontexten
- Struktur, Aufbau und technische Umsetzung
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit im Studiengang „Bildung und Medien“ (eEducation) befasst sich mit der Rolle von Pod- und Vodcasts in den Bildungswissenschaften. Sie analysiert die Funktionsweise und Motive dieser Medienform im Bildungskontext und stellt ein eigenes Podcast-Konzept vor.
- Die Funktionsweise und der Einsatz von Pod- und Vodcasts in der Bildung
- Die Chancen auditiver und visueller Darstellungen in Lernmedien
- Die Gestaltung und Entwicklung eines eigenen Podcasts
- Die Möglichkeiten und Herausforderungen von multimedialem Lernen
- Die Rolle von Pod- und Vodcasts im Kontext der digitalen Transformation
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Internets für den Wissensaustausch und die Entstehung einer „Gesellschaft von Autoren“. Sie argumentiert, dass multimediale Inhalte wie Podcasts neue Möglichkeiten für multimediales Lernen eröffnen.
- Kapitel 2 definiert Pod- und Vodcasts, beschreibt ihre Funktionsweise und erläutert die Chancen auditiver und visueller Darstellungen in Lernmedien. Es werden verschiedene Podcast-Arten vorgestellt und die Relevanz von Pod- und Vodcasts im Bildungsbereich hervorgehoben.
- Kapitel 3 widmet sich dem konkreten Beispiel des Podcasts „Methodenvernetzung im Ethik- und Philosophieunterricht“. Es werden Vorüberlegungen, die Auswahl von Methoden, die Einbettung in lernrelevante Kontexte und die technische Umsetzung des Podcasts dargestellt.
Schlüsselwörter
Podcasting, Vodcasting, Bildungswissenschaften, multimediales Lernen, digitale Medien, Bildungstechnologie, Wissensvermittlung, Online-Lernen, Unterrichtsmethoden, Ethik, Philosophie, Podcast-Gestaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Masterarbeit?
Die Arbeit untersucht die Funktionen und Motive von Pod- und Vodcasts in den Bildungswissenschaften sowie die Konzeption und Gestaltung eines eigenen Bildungspodcasts.
Welche Rolle spielt das Web 2.0 für das Lernen?
Das Web 2.0 ermöglicht es Nutzern, aktiv Wissen einzubringen und Teil einer „Gesellschaft von Autoren“ zu werden, was den Austausch und multimediales Lernen fördert.
Welches konkrete Podcast-Beispiel wird in der Arbeit vorgestellt?
Es wird der Podcast „Methodenvernetzung im Ethik- und Philosophieunterricht“ hinsichtlich seiner Struktur, fachspezifischen Methoden und technischen Umsetzung detailliert beschrieben.
Was sind die Vorteile von Pod- und Vodcasts in der Bildung?
Sie bieten Chancen durch auditive und visuelle Darstellungen, sind zeitlich flexibel abrufbar und unterstützen die digitale Transformation an Universitäten und Schulen.
Wo findet man heutzutage Bildungs-Podcasts?
Neben speziellen Portalen wie podster.de oder epnweb.org bieten viele Universitäten mittlerweile Vorlesungen als Pod- oder Vodcasts an.
- Quote paper
- Dennis Nolte (Author), 2011, Pod- und Vodcasts in den Bildungswissenschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177504