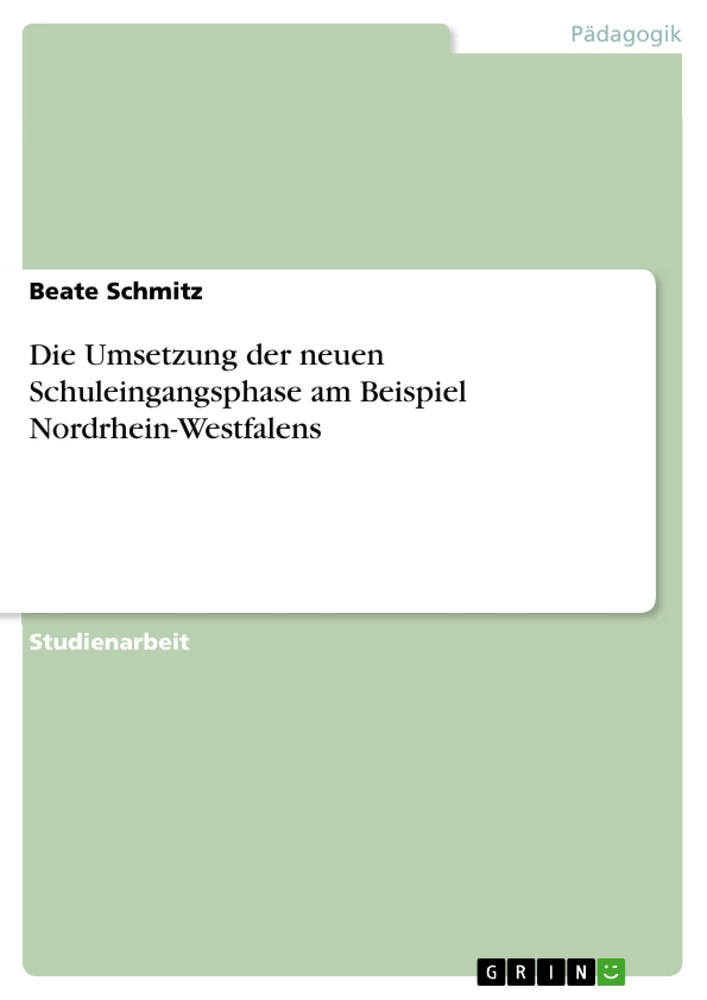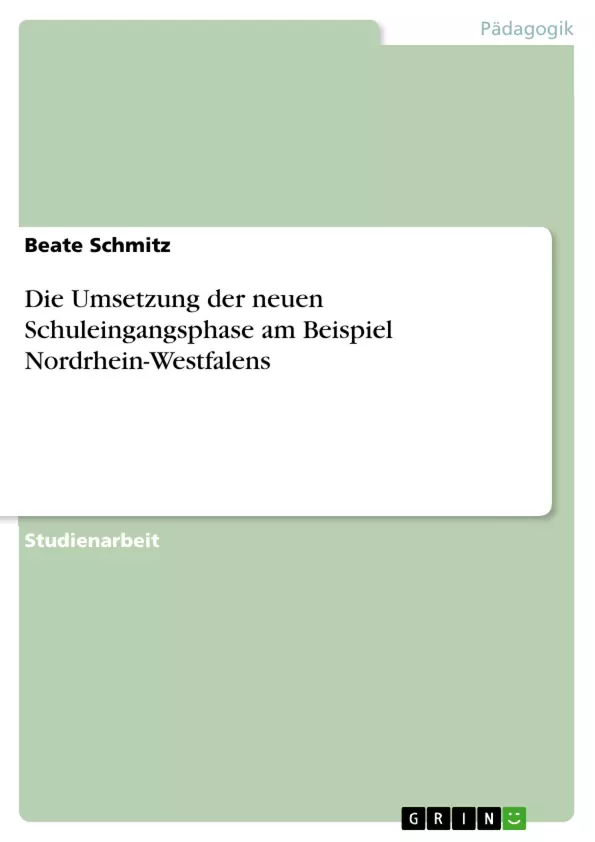Das deutsche Schul- und Bildungssystem ist sehr umstritten und keineswegs einheitlich in den einzelnen Bundesländern geregelt. Die PISA (Programme for International Student Assessment)-Studie zeigt, dass Deutschland im internationalen Vergleich nicht mithalten kann. Deshalb bedarf es zum einen bestimmter Veränderungen hinsichtlich der Struktur und der Organisation der Schule und zum anderen einer Weiterentwicklung der Unterrichtskonzepte und der Methodik.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- VERÄNDERUNGEN DER ORGANISATION UND DER STRUKTUR
- Einschulung
- Anmeldeverfahren
- Auflösung der Schulkindergärten
- WEITERENTWICKLUNG DER UNTERRICHTS-KONZEPTE UND DER METHODIK
- Heterogenität im Anfangsunterricht
- Entwicklungen des jahrgangsübergreifenden Unterrichts
- Aspekte jahrgangsübergreifenden Lernens
- Förderdiagnostik und Förderpläne
- Tätigkeit des pädagogischen Personals
- Veränderte Rolle der Lehrkraft
- Ressourcen
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
- Quellen
- Darstellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Umsetzung der neuen Schuleingangsphase in Nordrhein-Westfalen. Sie untersucht, wie die Organisation und Struktur der Grundschule verändert wurden, welche Weiterentwicklungen in den Unterrichtskonzepten und der Methodik stattgefunden haben und welche Herausforderungen sich daraus ergeben.
- Veränderungen in der Organisation und Struktur der Grundschule
- Entwicklungen in den Unterrichtskonzepten und der Methodik
- Herausforderungen und Chancen der neuen Schuleingangsphase
- Die Rolle der Lehrkraft in der neuen Schuleingangsphase
- Die Förderung der Schulfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- EINLEITUNG: Die Einleitung beleuchtet die Problematik des deutschen Schulsystems im Vergleich zu anderen Ländern und die Notwendigkeit von Schulreformen. Sie führt die neue Schuleingangsphase ein und ihre Zielsetzung, alle Kinder eines Jahrgangs zu fördern.
- VERÄNDERUNGEN DER ORGANISATION UND DER STRUKTUR: Dieses Kapitel analysiert die neuen Einschulungsmodalitäten in NRW, die veränderte Rolle der Schulfähigkeit und das neue Anmeldeverfahren. Es thematisiert auch die Kritik am fehlenden gesetzlichen Rahmen für die Förderung von Kindern im Elementarbereich.
- WEITERENTWICKLUNG DER UNTERRICHTS-KONZEPTE UND DER METHODIK: Dieser Abschnitt fokussiert auf die Herausforderungen, die die heterogene Schülerschaft im Anfangsunterricht mit sich bringt. Er beschreibt die Entwicklungen des jahrgangsübergreifenden Unterrichts, die Förderung durch Förderdiagnostik und Förderpläne und die Rolle des pädagogischen Personals in der neuen Schuleingangsphase.
Schlüsselwörter
Neue Schuleingangsphase, Schulfähigkeit, Einschulung, Anmeldeverfahren, Unterrichtskonzepte, jahrgangsübergreifender Unterricht, Förderdiagnostik, Heterogenität, Ressourcen, Lehrkraft, Nordrhein-Westfalen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die neue Schuleingangsphase in NRW?
Ein Konzept, bei dem das erste und zweite Schuljahr als Einheit gesehen werden, um Kinder individuell nach ihrem Tempo zu fördern.
Was bedeutet jahrgangsübergreifender Unterricht?
Kinder verschiedener Altersstufen lernen gemeinsam, wodurch sie voneinander profitieren und soziale Kompetenzen stärken.
Wie wird die Schulfähigkeit heute bewertet?
Statt Kinder zurückzustellen, wird versucht, jedes Kind dort abzuholen, wo es steht, und Defizite direkt in der Schule auszugleichen.
Was sind Förderpläne?
Individuelle Pläne, die Lernziele und Unterstützungsmaßnahmen für jedes einzelne Kind festlegen.
Welche Herausforderung bringt die Heterogenität mit sich?
Lehrkräfte müssen den Unterricht stark differenzieren, um den unterschiedlichen Entwicklungsständen der Kinder gerecht zu werden.
- Quote paper
- Beate Schmitz (Author), 2006, Die Umsetzung der neuen Schuleingangsphase am Beispiel Nordrhein-Westfalens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177518