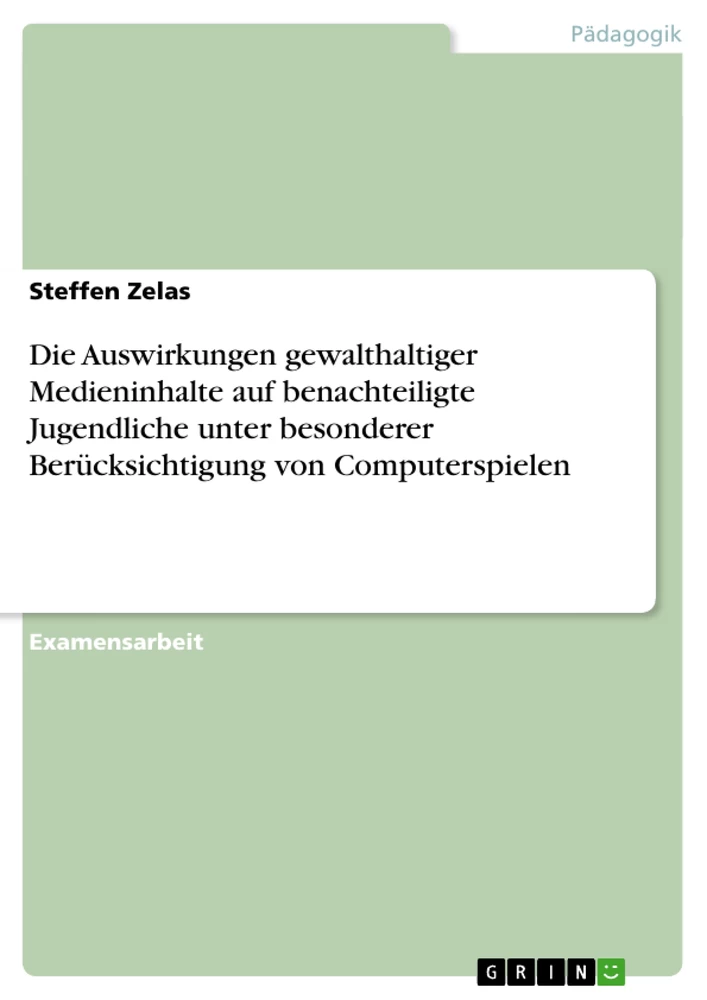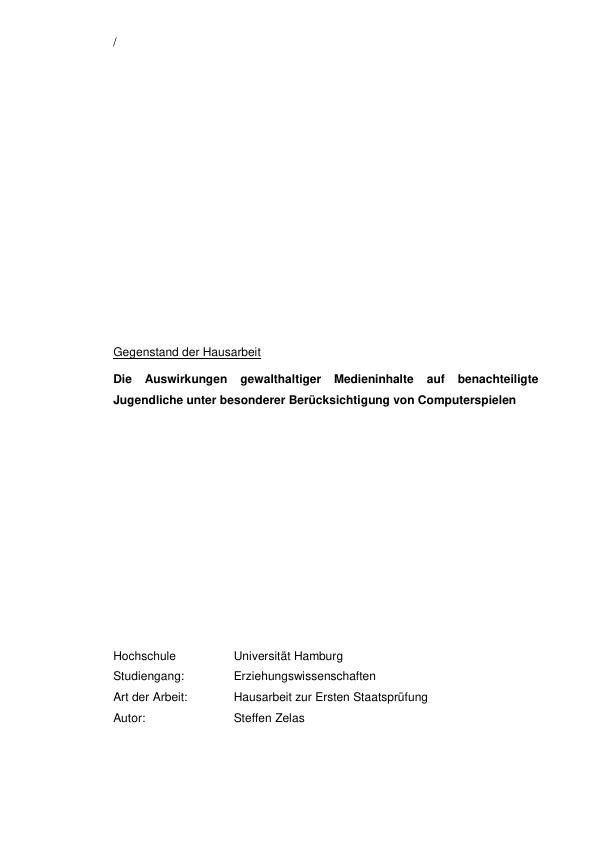[...] Die Intention dieser Arbeit ergibt sich aus der Erkenntnis heraus, dass die
Wirkung von violenten Computerspielen auf Jugendliche bisher nur sporadisch
untersucht wurde. Der Fokus der Wissenschaft liegt derzeit noch auf der
Wirkung von violenten Filmen oder Fernsehinhalten. Dies sollte sich hinsichtlich
der stetig wachsenden Rolle von Video- bzw. Computerspielen in der
Freizeitgestaltung von Jugendlichen ändern. Belegbar ist dieser Trend anhand
des wirtschaftlichen Wachstums der Spieleindustrie. So wurde 2004 mehr Geld
mit Video- und Computerspielen umgesetzt als mit Kinofilmen – es handelt sich
weltweit um 18,8 Milliarden Euro.1 Weiter wird dieser Trend durch die JIMStudie
2009 belegt: 47% der 13- bis 19-Jährigen spielen täglich oder mehrfach
pro Woche Video- bzw. Computerspiele.2 Computerspiele sind also als fester
lebensweltlicher Bestandteil von Jugendlichen anzusehen. Des Weiteren
werden besonders violente Computerspiele häufig in Presse und Medien zur
Verantwortung gezogen, sobald Jugendliche schwere Gewalt ausüben. Dieses
Phänomen basiert jedoch nicht auf empirischen Untersuchungen, sondern
spiegelt vielmehr die Meinung einiger Menschen. Die Debatte beschränkt sich
vor allem auf schwere Gewalt an Schulen, alltägliche Formen von Gewalt
werden weitesgehend außer Acht gelassen. Ein weiterer Grund zur
Themenwahl dieser Arbeit ist die Zielgruppe. Es gilt herauszufinden, welche
Jugendlichen welche Spiele spielen, um konkrete Aussagen zur Wirkung auf
eine bestimmte Personengruppe treffen zu können. So gilt das Interesse in
dieser Arbeit den benachteiligten Jugendlichen und den Auswirkungen von
violenten Computerspielen auf diese.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielgruppenbestimmung
- Benachteiligte Jugendliche
- Soziodemographische Strukturmerkmale benachteiligter Jugendlicher
- Einflussfaktoren auf Benachteiligungen
- Begriffsbestimmung: Benachteiligte Jugendliche
- Migration
- Schulischer Werdegang
- Geschlecht
- Kein direkter Übergang in die Ausbildung
- Belasteter familiärer Hintergrund (belastete Sozialsituation)/soziale Herkunft
- Marktbenachteiligung
- Das Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen
- Die Geräteausstattung von Jugendlichen bzw. von deren Haushalten
- Mediennutzungsverhalten
- Welche Computer- bzw. Videospiele werden gespielt?
- Begriffsbestimmung: Der Spieler gewalthaltiger Video- bzw. Computerspiele
- Risikogruppen — Gefährdete Jugendliche
- Benachteiligte Jugendliche als Spieler von gewalthaltigen Video- bzw. Computerspielen
- Benachteiligte Jugendliche
- Gewalt
- Begriffsbestimmung
- Mediengewalt
- Formen von Gewalt
- Psychische Gewalt
- Physische Gewalt
- Strukturelle Gewalt
- Einflussfaktoren gewalttätigen Verhaltens — Risikogruppen
- Trieb- und instinkttheoretische Ansätze/genetische Ansätze
- Lerntheoretische Ansätze
- Wechselwirkungen von Gewaltursachen
- Formen von Gewalt an Schulen
- Jugendliche und Video- bzw. Computerspiele
- Das Videospiel/Computerspiel
- Genres von Video- bzw. Computerspielen
- Der Shooter
- Die Faszination von Video- und Computerspielen
- Faszination von Gewalt in Computer- bzw. Videospielen
- Das Videospiel/Computerspiel
- Wirkungen gewalthaltiger Video- bzw. Computerspiele
- Die Entstehung gewalttätigen/aggressiven Verhaltens durch Video- bzw. Computerspiele
- Die Katharsisthese (Katharsiseffekt)
- Cognitive Neoassiation Theory und Priming Theory
- Habitualisierungsthese
- Medienwirkungsmodell von Fritz
- Empirische Studien zur Wirkung von violenten Computerspielen
- Aggressive Dispositionen
- Risiken jenseits der Gewaltdebatte
- Gesundheit
- Sucht
- Reale Gewalttaten und ihre Beziehung zu medialer Gewalt
- Middleton 1999
- Erfurt 2002
- Winnenden 2009
- Chancen für den Spieler
- Die Entstehung gewalttätigen/aggressiven Verhaltens durch Video- bzw. Computerspiele
- Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfelder
- Staatliche Handlungsfelder
- Der Jugendmedienschutz
- Staatliche Programme: Die Eltern-LAN-Veranstaltungsreihe
- Pädagogische Handlungsmöglichkeiten
- Medienerziehung und Medienkompetenz
- Zum Umgang mit Gewalt an Schulen
- Handlungsmöglichkeiten von Eltern und/oder Erziehungsberechtigten
- Staatliche Handlungsfelder
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Auswirkungen von gewalthaltigen Medieninhalten auf benachteiligte Jugendliche, wobei der Fokus auf den Einfluss von violenten Video- bzw. Computerspielen liegt. Die Arbeit analysiert die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen im Hinblick auf ihr Mediennutzungsverhalten und ihre Präferenzen für Computerspiele, insbesondere gewalthaltige Spiele. Sie untersucht verschiedene Theorien zur Wirkung von Mediengewalt und beleuchtet empirische Studien zu diesem Thema. Darüber hinaus werden Risiken jenseits der Gewaltdebatte wie gesundheitliche Auswirkungen und Suchtpotenzial erörtert. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion über Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfelder für den Umgang mit violenten Computerspielen im Lebensumfeld benachteiligter Jugendlicher, wobei staatliche, pädagogische und elterliche Maßnahmen beleuchtet werden.
- Definition und Charakterisierung von benachteiligten Jugendlichen
- Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen, insbesondere von benachteiligten Jugendlichen
- Wirkung von gewalthaltigen Computerspielen auf Jugendliche, insbesondere auf benachteiligte Jugendliche
- Risikofaktoren und Chancen im Zusammenhang mit Computerspielen
- Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfelder für den Umgang mit violenten Computerspielen im Lebensumfeld benachteiligter Jugendlicher
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel zwei definiert den Begriff „benachteiligte Jugendliche" und untersucht die soziodemographischen Merkmale dieser Gruppe. Es werden Einflussfaktoren auf Benachteiligung und das Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen, insbesondere von benachteiligten Jugendlichen, analysiert. Kapitel drei beschäftigt sich mit dem Begriff „Gewalt" und differenziert verschiedene Formen von Gewalt. Es werden Einflussfaktoren und Risikogruppen für gewalttätiges Verhalten erörtert sowie Formen von Gewalt an Schulen vorgestellt. Kapitel vier bietet eine Einführung in die Welt von Video- und Computerspielen und beleuchtet die Faszination, die diese Medien auf Jugendliche ausüben. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Faszination von Gewalt in Computerspielen. Kapitel fünf analysiert die Wirkung von gewalthaltigen Video- und Computerspielen auf benachteiligte Jugendliche. Es werden verschiedene Theorien zur Medienwirkung vorgestellt und die Ergebnisse empirischer Studien berücksichtigt. Außerdem werden Risiken jenseits der Gewaltdebatte wie gesundheitliche Auswirkungen und Suchtpotenzial erörtert. Kapitel sechs diskutiert Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfelder für den Umgang mit violenten Computerspielen im Lebensumfeld benachteiligter Jugendlicher. Es werden staatliche, pädagogische und elterliche Maßnahmen beleuchtet. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und reflektiert die Erkenntnisse im Hinblick auf die Fragestellung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen benachteiligte Jugendliche, Computerspiele, Mediengewalt, Gewaltprävention, Medienerziehung, Medienkompetenz, Jugendmedienschutz, Risikogruppen, Auswirkungen, Handlungsmöglichkeiten, Handlungsfelder, Sozialisation, Schule, Familie, Gesellschaft, Mediennutzung, und Jugendgefährdung. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von violenten Computerspielen auf benachteiligte Jugendliche und erörtert die Rolle verschiedener Institutionen und Akteure im Umgang mit diesem Thema.
Häufig gestellte Fragen
Welche Jugendlichen gelten in der Studie als „benachteiligt“?
Als benachteiligt gelten Jugendliche mit Migrationshintergrund, schwierigem schulischen Werdegang, belastetem familiären Umfeld oder fehlendem Übergang in die Berufsausbildung.
Wie viele Jugendliche spielen laut der JIM-Studie 2009 regelmäßig Computerspiele?
Etwa 47% der 13- bis 19-Jährigen gaben an, täglich oder mehrfach pro Woche Video- bzw. Computerspiele zu nutzen.
Was besagt die Katharsisthese im Kontext von gewalthaltigen Spielen?
Die Katharsisthese vermutet, dass das Ausleben von Aggressionen in der virtuellen Welt zu einem Abbau von realen Aggressionen führt – eine These, die wissenschaftlich stark umstritten ist.
Welche Risiken bestehen jenseits der Gewaltdebatte?
Die Arbeit thematisiert auch gesundheitliche Risiken durch Bewegungsmangel sowie das Potenzial für eine Computerspielsucht.
Welche pädagogischen Handlungsmöglichkeiten werden vorgeschlagen?
Im Vordergrund stehen die Förderung von Medienkompetenz, Elternabende (z.B. Eltern-LAN) und eine gezielte Medienerziehung in der Schule.
- Citation du texte
- Steffen Zelas (Auteur), 2010, Die Auswirkungen gewalthaltiger Medieninhalte auf benachteiligte Jugendliche unter besonderer Berücksichtigung von Computerspielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177615